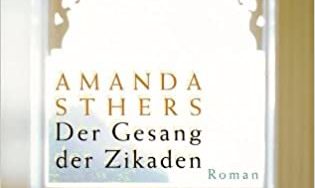von Carolin Hensler
Die Stille spielt in diesen Geschichten ihre Hauptrolle. Und doch sind es die kleinen Töne, die kaum hörbaren, die sanften Farbtupfer im bedrückenden Grau, die das Ende zu einem Finale ohne Schwermut und die Geschichte zu einer Liebeserklärung an das Leben werden lassen.
Die wirklich guten Geschichten schreibt das Leben nicht, es malt sie. In festen, einprägenden Strichen werden Lebenslinien nachgezeichnet, wandeln sich die Handlungsstränge zu einem Farbspiel aus allen Tönen. Manchmal schnell und ohne erkennbares Muster, manchmal langsam und tiefgehend, als zeichnete der Pinsel nicht lediglich eine Geschichte, sondern ein Lebensgefühl nach — einer Melodie gleich, deren schwerem, melancholischen Takt der Hauch eines stillen Crescendos innewohnt. Die Stille spielt in diesen Geschichten ihre Hauptrolle. Und doch sind es die kleinen Töne, die kaum hörbaren, die sanften Farbtupfer im bedrückenden Grau, die das Ende zu einem Finale ohne Schwermut und die Geschichte zu einer Liebeserklärung an das Leben werden lassen.
Die Immobilienmaklerin Madeleine verbringt ihr Leben als alleinstehende Frau in der Bretagne. Nicht nur die kahlen Felsküsten und das beständig ungemütlich feuchte Klima ihrer Umgebung verdüstern Madeleines Alltag, sondern auch die Selbstzweifel und daraus resultierende Einsamkeit zehren an der 40-Jährigen. Als der adrette Pariser Geschäftsmann Antoine Castellot auf der Suche nach einem Anwesen in der Bretagne in ihr Leben tritt, fühlt sich Madeleine stark zu ihm hingezogen. Mit Castellot, der kühl und abweisend wirkt, verbindet sie ein stilles Gefühl der Vertrautheit. Ihr kleines, durch überromantisierte Fernsehserien und ihren burschikosen Großvater in den Bahnen gehaltenes Leben wird nach hastigem Sex mit Castellot völlig durcheinander geworfen. Castellot flüchtet sich überstürzt in die Arme von Ehefrau und Kindern, während Madeleine, gefangen in Kindheitserinnerungen, mit ihren Selbstzweifeln und nagender Einsamkeit zurückbleibt. Die Stille der Bretagne hält Madeleine fest in ihrem Griff, bis Castellot eines Tages mit seinem Leben im Gepäck vor ihrer Tür steht …
Die Bretagne zeigt sich der Protagonistin in Amanda Sthers Frauenporträt „Der Gesang der Zikaden” als ebenso rau, kalt und farblos wie es Madeleines eigene Lebensgeschichte ist. Um Erinnerungen aus ihrem früheren Leben zu verdrängen, umgibt Madeleine sich mit einer Fassade aus Sehnsüchten. Der Serienstar Brandon Bradley, dessen Soapleben sie intensiv verfolgt, verkörpert die Komprimierung all ihrer Wünsche. In ihrer naiven Leidenschaft für die Serienfigur offenbart sich Madeleines Verzweiflung an der selbsterzwungenen Emotionslosigkeit, an der hilflosen Liebe in ihr, die in aller Einsamkeit für niemanden bestimmt sein darf. Dennoch hütet Madeleine den freien Platz neben sich auf der Fernsehcouch für den Mann ihrer Träume, in der beständigen Hoffnung, den Geistern ihrer Vergangenheit, die sie letztendlich zu einer beinahe im Sumpf ihrer Lebenserfahrungen ertrinkenden Frau gemacht haben, entfliehen zu können. Und so ersehnt Madeleine sich mehr als nur einen Kerl, der sich darauf beschränkt, den Eingang zu ihr zu finden, nur um unmittelbar danach den Wohnungsausgang zu suchen.
Der geheimnisvolle Castellot scheint genau dieser ersehnte Retter zu sein. Doch Castellot hat mit seinen eigenen Geistern zu kämpfen. Er steht nicht weniger neben dem Leben als Madeleine, ist nicht weniger lediglich ein Zuschauer seiner eigenen unzufrieden stellenden Entscheidungen. Auch er fühlt sich, wohl gerade aus diesem Grund, zu Madeleine hingezogen, und doch jagen ihn in seinem persönlichen, stillen Chaos die Erinnerungen an seine Kindheit: an den Vater, der seinem Sohn jeden Sommer Kaninchen schenkte, um sie letztendlich bei lebendigem Leib zu enthäuten und seiner Familie zum Essen vorzusetzen. Den Vater-Sohn-Konflikt konnte Castellot zu Lebzeiten seiner Eltern nicht aus der Welt schaffen — eine Tatsache, für die er sich schuldig fühlt und für die er in der Bretagne, der Begräbnisstätte seines Vaters, Absolution erhofft. Sein Aufenthalt bei Madeleine ist für ihn weitaus mehr als nur ein flüchtiges Entkommen aus dem Alltag. In den Monaten, die er schließlich bei ihr verbringt, unterzieht er sich selbst einem Entzug ebendieser verstörenden Lebenserfahrungen. Verzweifelte Leidenschaftlichkeit und emotionale Sterilität wechseln sich im Lauf dieser von verstehendem Schweigen geprägten Zeit ab.
Durch die stille Zweisamkeit mit Castellot, den Rausch an Gefühlen in der ansonsten so trostlosen Atmosphäre, lernt Madeleine langsam, ihre Traumata zu bewältigen. Die Erinnerungen an eine lieblose Mutter, den prügelnden Säufer-Vater und nicht zuletzt ihren Stiefvater treten mit jeder Minute, in der Madeleine endlich sich, ihren Körper und ihr Leben zu lieben lernt, zurück.
Amanda Sthers schuf mit „Der Gesang der Zikaden” ein stilles, jedoch ausdrucksstarkes und nicht minder verstörendes Porträt einer von ihren Mitmenschen und nicht zuletzt dem Leben geprägten Frau. Geschickt vermag sie es, durch die melancholisch anmutende Zeichnung einer kahlen Bretagne einen treffenden Hintergrund für die zarte Liebesgeschichte zweier unterschiedlicher und doch so ähnlicher Menschen zu erschaffen. Das Porträt Madeleines wird durch die Darstellung des gebrochenen Charakters Castellots an Ausdrucksstärke bereichert. Mit Sinn für die wichtigen Kleinigkeiten im Leben und einem Hauch traurigen Humors zeichnet sie ein Gemälde zweier Menschen, die sich beinahe aufgegeben hatten, letztendlich jedoch aneinander wachsen. Für Madeleine und Castellot kündigt der Gesang der Zikaden keineswegs das Ende ihrer Leben an — er bringt für beide die Gewissheit, nach der Bruchlandung, die sich Leben nennt, endlich wieder flügge zu werden.