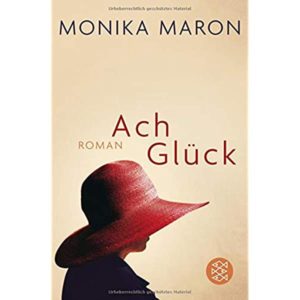die Geschichte der Maudi Lathur, des ‚letzten Herzensmenschen‘ im fiktiven rheintalischen Städtchen Jacobsroth […], ein Allerweltsort, in dem den Menschen die Sehnsucht […] verlorengegangen ist. Maudi ist ein Engel, biologisch ein als Frau geborener Mann […], der den entzauberten Menschen das Herz höher schlagen lassen soll, der Wärme und Zuversicht schaffen will in trostloser Zeit6.Für das Feuilleton erscheint indes „nicht immer nachvollziehbar”7, auf welche Weise dieser Prozess vonstatten geht. Dass Maudi dabei nicht nur als ‚Engel‘, sondern auch als Hermaphrodit dargestellt wird, erscheint Sigrid Löffler in der Zeit innerhalb des Erzählzusammenhangs nur vordergründig plausibel; dass der Umstand von Maudis Zwei- oder Zwischengeschlechtlichkeit im Roman auf eine biologische Ursache rückgeführt wird, löst Unverständnis aus:
Wer solche Wunder vollbringt, der muss übernatürlich begabt sein. In der Tat: Maudi ist ein Engel […]. Und wie es Engeln zukommt, legt Robert Schneider seine Heldin zwiegeschlechtlich an: ‚Maudi ist ein Mann, der phänomenologisch eine Frau ist […]‘. Nicht dass dieses sonderbare Gebrechen — ‚Syndrom der testikulären Feminisierung‘, wie uns der Autor pedantisch informiert — für den Fortgang der Geschichte den allergeringsten Belang hätte (Löffler 1998: 42).Dieser Aussage sollen im Folgenden Zweifel entgegengebracht werden. Im Zuge der nachstehenden Lektüre des Romans soll die Bedeutung der doppelten ‚Besonderheit‘ Maudis — als Engel und Hermaphrodit im medizinischen Sinne — näher analysiert werden. Die Besonderheit des hermaphroditischen Körpers stellt indes schon seit Jahrtausenden einen Diskussionsgegenstand der Wissenschaften und Künste dar. Dieser Beitrag geht nun von der These aus, dass Schneider in Die Luftgängerin in der Konzeption seiner Protagonistin unterschiedliche diskursive Diskussionszusammenhänge zum Thema Hermaphroditismus aufnimmt, um sie auf neue Weise miteinander zu verknüpfen. Bevor es im Folgenden heißt, näher auf den Roman und seine Protagonistin einzugehen, werden zunächst die Entwicklungslinien dieser diskursiven Zusammenhänge kurz vorgestellt. Im Anschluss daran soll in der Lektüre des Romans unter Bezugnahme auf Konzepte von Emmanuel Lévinas (1987), Jacques Derrida (1999, 2003) sowie Margrit Shildrik (2002) und Judith Butler (2009) der Frage nachgegangen werden, auf welche Art und Weise die dargestellten diskursiven Zusammenhänge in Die Luftgängerin neu zu einander in Beziehung gesetzt werden. Dabei gilt es insbesondere Maudis Funktion innerhalb des „komplexen Beziehungsgeflechtes”8 des Romans genauer auf den Grund zu gehen. Ziel ist es, herauszufiltern, auf welche Weise Maudi das oben erwähnte Nähe-Verhältnis zu den ihr größtenteils fremden, d. h. unbekannten, Figuren im Roman herstellt resp. welcher Art diese Beziehung ist. Auf diese Weise soll es gelingen, eine Antwort auf die Frage zu finden, welche Bedeutung dem Umstand von Maudis hermaphroditischem Körper innerhalb des Romangefüges zukommt.
Der Hermaphrodit als Sinnbild der Vollkommenheit
Die Rätselhaftigkeit des hermaphroditischen Körpers, d. h. jenes Körpers, der sowohl traditionell männlich als auch traditionell weiblich konnotierte Geschlechtsmerkmale aufweist, beschäftigt die Menschheit seit Jahrtausenden. In antiker Zeit bilden sich dabei unterschiedliche Bewertungen des zwischen- oder zweigeschlechtlichen Körpers heraus. Innerhalb des ersten hier vorgestellten diskursiven Zusammenhangs stellt Hermaphroditismus ein göttliches Attribut dar. Demgemäß sind aus der griechischen Antike Gottheiten überliefert, welche körperliche Züge beider Geschlechter aufweisen, so ist z. B. für das 4. Jahrhundert vor Christus für den Raum von Athen das Entstehen eines Fruchtbarkeitkults um einen zweigeschlechtlichen Gott namens Hermaphroditos belegt (vgl. Ajootian 1995: 93). Zudem tauchen in Verbildlichungen von Gottheiten immer wieder als gemischtgeschlechtliche Doppelwesen dargestellte Zwillingspaarungen auf (vgl. Aurnhammer 1986: 13f.). Diese Doppelungen bringen eine Idee der Vollkommenheit zum Ausdruck — die Göttinnen und Götter verfügen zusammen über Wissen, das einem Geschlecht verwehrt ist. Dementsprechend verkörpern hermaphroditisch angelegte Gottheiten sowie die genannten Zwillingspaarungen ein Konzept von Androgynie, das nach Aurnhammer als „Relation zweier komplementärer Elemente” verstanden werden kann, „die eins waren, eins sind oder eins sein möchten” (1986: 2). Diese Ganzheit, die durch das Zusammenfügen zweier komplementärer Teile hergestellt wird, kann in der griechischen Antike im Allgemeinen nur von Gottheiten erreicht werden, während es für den Menschen der Antike gilt, die Geschlechtertrennung zu leben. Jene berühmte, dem Komödiendichter Aristophanes in den Mund gelegte Erzählung aus Platons Symposion (189c2-193d5) zeigt allerdings, dass in der Antike Konzepte kursieren, die die Geschlechtertrennung als abgeleitetes Stadium eines vormals androgynen Status des Menschen sehen. In Platons Text wird von den Urmenschen in Kugelgestalt berichtet, die entweder aus einem Mann und einer Frau, aus zwei Männern oder aus zwei Frauen zusammengesetzt sind. Diese Kugelmenschen werden den Göttern zu mächtig, was sie dazu veranlasst, diese in zwei Hälften zu teilen. Von da an heißt es für die Menschen, ihre verlorene Hälfte zu suchen (vgl. Ajootian 1995: 99). Laut diesem Mythos ist dem Menschen damit die Verschmelzung zu einem Ganzen nur kurzfristig im Akt der sexuellen Vereinigung möglich (vgl. Aurnhammer 1986: 31)9. Platons Erzählung löst die Androgynie aus dem religiös-kultischen Bereich (vgl. Aurnhammer 1986: 32)10 und stellt eine Verbindung zwischen Hermaphroditen und Konzepten von Begehrensstrukturen und Sexualität her, die bis ins 21. Jahrhundert für Philosophie und Literatur wirkmächtig bleibt.Der Hermaphrodit als Sinnbild jungfräulicher Selbstvollkommenheit
Eine zweite berühmte Erzählung aus der (römischen) Antike — eine Episode aus Ovids Metamorphosen (IV, 274–391) — behandelt ähnliche Aspekte des Themas, gibt ihnen jedoch eine andere Färbung. Der jungfräuliche Knabe Hermaphroditos befindet sich zu Beginn der Geschichte in einem Zustand kindlich vergnügter, unschuldiger Selbstgenügsamkeit. Durch die sexuellen Annäherungsversuche von Seiten der Nymphe Salmacis wird dieser Zustand des Hermaphroditos gestört, Hermaphroditos wehrt sich erfolglos gegen Salmacis und verschmilzt schließlich mit der Nymphe in einer Quelle zu einem zweigeschlechtlichen Lebewesen. Ovid entfaltet in dieser mythischen Erzählung drei, über die Jahrhunderte weiter tradierte Möglichkeiten, die Figur des Hermaphroditos und das mittels ihrer versinnbildlichte Konzept der Androgynie zu fassen. Zunächst wird Hermaphroditos‘ anfängliche, androgyn11 „engelhafte Vollkommenheit aus sich selbst” in einen späteren, an Platon erinnernden Zustand der Vollkommenheit überführt, welcher mittels der „Ergänzung durch die andere Hälfte” (beide Zitate Aurnhammer 1986: 22) im Zuge des Sexualakts hergestellt wird. Über die Jahrhunderte konkurrieren schließlich Vorstellungen des Hermaphroditen als hypersexueller Figur mit ‚Verbildlichungen‘ von Androgynie, die geschlechtslos wirken: U. a. in der Renaissance tauchen Engelsdarstellungen auf, die als androgyn gelten (vgl. Krauss 2000: 82f.). Dass Hermaphroditos den Zustand der (sexuellen) Ergänzung durch eine andere Hälfte negativ bewertet, wird daran deutlich, dass er nach der Metamorphose verzweifelt seine göttlichen Eltern anruft, sie mögen die Quelle verfluchen, auf dass alle, die sie später betreten, ein ähnliches Schicksal erlitten wie er. Diese unheimlich anmutenden Vorgänge machen auf einen dritten Aspekt des Hermaphroditen aufmerksam, den Ajootian wie folgt kommentiert: „[T]he darker aspect of Hermaphroditos’ character that we see here may reflect a surviving concern with such sexual mischwesen in nature […]” (1995: 104). Denn den Vorstellungen des Hermaphroditen als Sinnbild von ‚Vollkommenheit‘ steht die Tatsache gegenüber, dass in der Antike ‚reale‘ hermaphroditische Menschen als Bedrohung und Strafe der Götter angesehen werden, die auf dem Meer ausgesetzt und damit ermordet werden (vgl. Ajootian 1997: 229). Auch wenn diese Einschätzung nach und nach an Gültigkeit verliert und der Körper des ‚realen‘ Hermaphroditen in der römischen Antike zunehmend als ‚Laune‘ der Natur eingeschätzt wird (vgl. Ajootian 1995: 103), bleibt dessen ‚Image‘ des Bedrohlichen und monströs ‚Anderen‘ über Jahrhunderte erhalten. Dieser Umstand führt aber dazu, dass die Wissenschaft beginnt, sich des Themas anzunehmen.Der Hermaphrodit als medizinischer Fall
Wiewohl seit der Antike körperinduzierte Theorien über die Ursprünge des menschlichen Hermaphroditismus diskutiert werden, gelingt es bis zum Ende des 18. Jahrhunderts nicht, eindeutige körperliche Ursachen für das Phänomen anzugeben (vgl. Fausto-Sterling 2000: 34). Die neuen naturwissenschaftlichen Forschungsrichtungen, welche sich an der Schwelle zum 19. Jahrhundert herausbilden (u. a. Embryologie, Pathologie, Teratologie12), schaffen aber mittels neu entwickelter methodologischer Herangehensweisen neuartige Zugänge zum menschlichen Körper. Hermaphroditismus zählt von nun an zu den embryonalen Fehlentwicklungen. Auf diese Weise kommt es im Laufe des 19. Jahrhunderts zwar zu einer Naturalisierung des Hermaphroditismus, damit einhergehend allerdings auch zu dessen Pathologisierung (vgl. Mehlmann 2006: 88ff.). Hermaphroditismus tritt in den Bereich der Medizin, denn „der Arzt wird auf gewisse Weise die täuschenden Anatomien zu entkleiden haben und hinter den Organen, die die Formen des entgegengesetzten Geschlechts angenommen haben können, das einzig wahre Geschlecht wieder finden müssen” (Foucault 1998: 9). Wiewohl an der Schwelle zum 20. Jahrhundert ein Übergang von Ideen des ‚wahren‘ Geschlechts zu Ideen des ‚passenderen‘ Geschlechts festzustellen ist, verbleibt die Deutungshoheit darüber, einen hermaphroditischen Körper einem bestimmten Geschlecht zuzuweisen, bis zur heutigen Zeit vor allem bei den MedizinerInnen in Zusammenarbeit mit VertreterInnen anderer Naturwissenschaften (vgl. Lang 2006: 66)13.Der Hermaphrodit als Sinnbild von Hybridität
Gegen Ende des 20. Jahrhunderts nehmen sich die Gender Studies des Themas des Hermaphroditismus an, deren Anliegen insbesondere auf einer umfassenden kritischen Sichtweise der epistemologischen Herangehensweise seitens der Naturwissenschaften und Medizin an das Thema ‚Geschlecht‘ basiert. Vorgeworfen wird den Naturwissenschaften, das seit dem 18. Jahrhundert als ‚natürlich‘ angesehene System des Geschlechterdimorphismus reflexionslos zu perpetuieren (vgl. Lang 2006: 46ff.). Im Gegensatz dazu gilt es im Rahmen der Gender Studies, die konstitutive Macht naturwissenschaftlicher Körperdiskurse offen zu legen. Der spezifisch ‚weibliche‘ oder ‚männliche‘ Körper stellt sich innerhalb der Gender Studies als Produkt historisch kontingenter Körperdiskurse dar (vgl. Maihofer 1995, Butler 1997). Hermaphroditen stellen in diesem Zusammenhang ein in der Forschung vielfach zitiertes Beispiel für die Kontingenz eines rigiden binären Systems dar, das nur ‚entweder/oder‘ kennt (vgl. Butler 2009: 97–122). Der Hermaphrodit wird zu einer paradigmatischen Gestalt von Hybridität, die allerdings keine zu erreichende (antike, ideale) ‚Ganzheit‘ zum Ausdruck bringt, sondern eine allen Wesen inhärente Gespaltenheit (vgl. Babka 2008: 248).Die Luftgängerin
Robert Schneiders Roman Die Luftgängerin greift auf die oben vorgestellten Konzepte zurück, wenn es darum geht, seine Protagonistin und deren Beziehung zu ihren Mitmenschen zu zeichnen. Der Text fungiert dergestalt als Interdiskurs14, nimmt also eine re-integrierende Funktion in Bezug auf sein diskursives Umfeld ein. Diskurselemente aus wissenschaftlichen Spezialdiskursen oder Kunstdiskursen werden in den Roman eingebunden, dabei neu zueinander in Beziehung gesetzt und in ihrer Gültigkeit verhandelt. Wissen und Konzepte werden aufgenommen, allerdings nach einer eigenen Logik reproduziert (vgl. Engelhardt 2004: 23). Unter Bezugnahme auf Theoriekonzepte von Lévinas (1987), Derrida (2003), Shildrick (2002) sowie Butler (2002) gilt es in der folgenden Lektüre herauszufiltern, in welchen Bedeutungszusammenhang der Roman Die Luftgängerin die aufgenommenen Diskurselemente stellt.Die besondere Protagonistin
Robert Schneider siedelt seinen Roman in der fiktiven vorarlbergischen Stadt Jacobsroth an. Hier wird Maudi Lahtur im Jahre 1970 als Tochter von Amrei Lahtur und Ambros Bauermeister geboren. Wie eingangs erwähnt, stellt Maudi in vielen Belangen eine besondere Protagonistin dar. Innerhalb des Romangeschehens nimmt sie wenig Platz ein, da sich eine Vielzahl an Figuren im Text tummelt, deren Geschichten von der mitunter recht geschwätzigen Erzählinstanz in unzähligen ausschweifenden Episoden miterzählt wird. Die Erzählinstanz gibt den LeserInnen zudem keine Innenansichten in Maudis Denkweise. Was wir von Maudis Entwicklung erfahren, macht dennoch deutlich, dass sie von Geburt an außergewöhnlich ist. Schon als Kind spricht sie wenig, verfügt allerdings als Vierjährige bereits über den Blick „eines erwachsenen Menschen” (LG 52)15, der u. a. den Vater Ambros mit „einer solchen Wärme durchdringt — einer Wärme, die er noch keinmal von einem Menschen erhalten hatte” (LG 52). Gerade dieses Erlebnis des Angeblickt-Werdens von Seiten seiner vierjährigen Tochter weckt in Ambros den Wunsch, Maudi eine besondere Erziehung zukommen zu lassen — er bringt ihr das ‚Luftgängertum‘ nahe:Ein Luftgänger ist ein Mensch, der nur auf sein Herz hört. Er gehorcht niemandem auf der Welt. Der Luftgänger tut, was er will. Der Luftgänger hat vor nichts und niemandem Angst. Vor allem nicht vor sich selbst. Und weil er keine Angst hat und immer auf sein Herz hört, kann er durch die Lüfte gehen (LG 255).Maudi wird im Roman als Person dargestellt, die gemäß der Theorie ihres Vaters lebt, d. h. sie versucht, kompromisslos nach eigenen Vorstellungen und Konzepten zu leben. Zudem zeigt sich Maudi in der Lage, ihren Mitmenschen in der Begegnung ein Gefühl des Angenommenseins, der Nähe, zu vermitteln:
Maudi war von so berührendem Wesen, dass, als sie an Margots Hand [der Hand ihrer Großmutter, Anm. A. B.] durch den Mittelgang schritt, sich Frauen wie Männer nach ihr umblickten. Und diese Frauen und Männer wunderten sich einen Moment, weshalb sie der Kleinen so intensive Beachtung geschenkt hatten. Ein ganz normales Mädchen. Hübsch, aber nicht außergewöhnlich hübsch. Interessant, aber nicht umwerfend interessant. Warum eigentlich? Die wenigen, deren Augen kurz ihre Augen berührten, verspürten plötzlich etwas ungemein Behagliches. Eine warme Brise, die ihr Herz umfing. Der Ton in den Augen des Mädchens gab ihnen auf unerklärliche Weise Mut. Und sie fühlten sich wundersam von der Welt angenommen, gehalten, geliebt. Wohlig wurde ihnen, den lebenslang Gekränkten (LG 128).Maudis Präsenz erzeugt also Momente der Harmonie in ihrer Umgebung. Dabei scheint Maudi gemäß den Maximen ihres Vaters weder vor Bekannten noch vor Unbekannten Angst zu haben:
Es stimmte, dass die junge Frau nicht in der Lage war, zwischen Freunden und Fremden, Bekannten und Unbekannten zu unterscheiden. Wer ihr begegnete und sich von ihrem ausgeruhten, seegrünen Augenlicht erwärmen ließ, dem geschah es, dass er plötzlich von ihr umarmt war und gehalten. […] Eine noch nie gesehene Person bedeutete Wiedersehn (LG 235).Die Besonderheit Maudis äußert sich allerdings nicht nur in ihrem Wesen, sondern, wie bereits aufgezeigt, auch in ihrer körperlichen Konstitution. Im Alter von 15 Jahren verschwindet Maudi plötzlich für einige Tage und wird halb tot mit Würgemalen und einer von einem Menschen zugefügten Bisswunde am Arm aufgefunden (vgl. LG 147ff.). Wer hinter dem Angriff auf Maudis Leben steckt, bleibt im Roman lange Zeit unklar16. Im Zuge des Krankenhausaufenthaltes nach dieser Attacke stellt sich heraus, dass Maudi im medizinischen Sinne ein Hermaphrodit ist, d. h. in diesem Falle eine Frau mit männlichem Chromosomensatz:
Und doch wird im Verlaufe dieser Untersuchung eine mysteriöse Entdeckung gemacht. Das Mädchen verfügt über einen männlichen Chromosomensatz. Zwar ist Maudis äußerer Phänotyp vollkommen weiblich, aber die Gebärmutter ist nicht ausgebildet, sie fehlt überhaupt. Desgleichen die Eierstöcke. Darum die so lange ausgebliebene Menarche, die auch nie geschehen kann. Maudi wird nicht gebären. Sie leidet am Syndrom der testikulären Feminisierung. […] Und das medizinisch so Verblüffende: Kann sich ein Mensch nicht männlich ausbilden, erhält er den weiblichen Habitus. Ein gleichsam ungeschriebenes Gesetz. Der sinus urogenitalis differenziert sich in feminine Richtung. […] Maudi ist ein Mann, der phänomenologisch eine Frau ist (LG 157).Wie in der medizinischen Literatur nachzulesen ist, besagt das Syndrom der testikulären Feminisierung, dass manche Körper im Embryonalstadium aufgrund genetischer Veränderungen keine Androgene binden können — aus diesem Grund wird das Phänomen auch Androgenresistenz genannt — , was dazu führt, dass sich kein männliches Genitale ausbildet (vgl. Breckwoldt 2002: 9f.). Dass Maudi am Syndrom der testikulären Feminisierung leidet, wird von den Figuren im Roman nicht weiter problematisiert, Maudis ‚weibliche‘ Geschlechtsidentität nicht in Frage gestellt. Lediglich die extra-diegetische Erzählinstanz erinnert sich der Diagnose wiederholt und fragt in Verwunderung: „Wer war Maudi Lahtur? […] Auf was für ein Leben richtete sich dieser Mensch ein? […] Wer war diese Frau, die im medizinischen Sinn gar keine Frau war?” (LG 238). Die Tatsache, dass Maudis körperliche Konstitution auf Handlungsebene kaum Erwähnung findet, legt in Kombination mit Maudis besonderer Wirkung auf ihre Mitmenschen nahe, dass — wie Sigrid Löffler (1998: 42) oben festgestellt hat — Maudis Zwei- oder Zwischengeschlechtlichkeit als physische Manifestation ihres ‚Engelswesens‘ verstanden werden solle. Die Erzählinstanz nennt Maudi dementsprechend einen „Engel” (LG 9) oder den „letzten Herzmenschen von Jacobsroth” (LG 10). Die von ihr verkörperte Androgynie könnte somit als Ausdruck der Vollkommenheit ihres ‚seraphischen‘ Wesens gedeutet werden. Als ‚Engel‘ scheint Maudi dabei nicht nur weibliche und männliche Qualitäten zu verbinden, sondern auch ein Dasein zwischen Leben und Tod, zwischen Menschsein und Göttlichkeit zu führen. Ihrer Großmutter erläutert Maudi, „dass es Menschen [wie sie selbst, Anm. A. B.] auf dieser Welt gebe, die in einer Art Mischzustand existierten. Sie wüssten nicht, ob sie den Toten gehören oder den Lebenden” (LG 179). Die in sich ruhende, Gegensätze ausgleichende Maudi erinnert somit an den jungen, selbstgenügsamen Hermaphroditos aus Ovids Metamorphosen. Die Luftgängerin greift zudem auf eine Weiterentwicklung dieses Konzepts in der Figur des androgynen Engels zurück, das u. a. von Rilke, den Maudi im Roman zitiert (LG 260), verarbeitet wird. Nach Aurnhammers Rilke-Lektüre erscheint der Engel in zahlreichen Gedichten als Gegenstück zum Menschen, denn „[w]ährend das [menschliche, Anm. A. B.] Ich in der dissonanten Welt steht, schwebt der Engel als Synthese über der Welt der Antinomien” (Aurnhammer 1986: 228). Der androgyne, unschuldige Engel verkörpert das Ideal einer Einheit, die vom Menschen nicht erreicht werden kann, die aber als Ideal eines zu erreichenden Zustandes stets präsent bleibt. In Schneiders Roman wird schließlich — ähnlich den Konzepten in Rilkes zweiter Duineser Elegie17, aber auch in Platons Symposion oder in Ovids Metamorphosen — die heterosexuelle Vereinigung als Annäherung an dieses Ideal der Vollkommenheit vorgestellt. Im Text werden drei Liebes-Begegnungen präsentiert, in denen zumindest die beteiligten Männer, aus deren Perspektive die Begegnungen jeweils geschildert werden, das Gefühl haben, ihrer „Zwillingsseele” (LG 263) begegnet zu sein. Diese Begegnungen — im Zitat unten findet sich jene zwischen Maudis Eltern — stellen eine Art Leitmotiv im Text dar, da sie drei Mal beinahe identisch formuliert werden:
Er sah sie sofort. Im ersten Moment. In der Sekunde. Ohne Umweg. Augenblicklich. Jäh. Sie. Kein Gedanke, der Wort werden konnte. […] Seine Augen stürzten auf sie und begriffen den Menschen auf einmal in seiner ganzen, seraphischen Erscheinung. Nichts Fremdes an ihm. Nichts Unbekanntes. Immer bei ihm gewesen. Bei ihm gewohnt. Ihn immer geliebt (LG 20; vgl. LG 247 und LG 350).Der Roman scheint also im Sinne eines antiken Androgynie-Ideals die Idee der Versöhnung von Gegensätzen, der komplementären Unifikation von zwei Menschen in der Liebe zu behandeln. Maudi als Engelsfigur könnte in diesem Sinne als Symbol dieses Ideals angesehen werden, dem sich die anderen Figuren nähern wollen. Der Text bricht allerdings gerade durch die Figur Maudi und ihre Engelsmission mit diesem Konzept, wobei zum einen Maudis besondere Art und Weise Beziehungen zu ihren Mitmenschen herzustellen und zum anderen Maudis medizinisch definierter Hermaphroditismus eine entscheidende Rolle spielen.
Maudi und die Anderen
Bezüglich der Begegnungen zwischen Maudi und ihren Mitmenschen zeigt sich, dass Maudi ein anderes Ziel verfolgt, als dies in den ‚seraphischen‘ Liebesbeziehungen der Fall ist. Eine Auflösung von Grenzen im Sinne einer alles umfassenden Einigkeit und Harmonie ist überhaupt nicht Ziel der Annäherung Maudis an ihre Mitmenschen. Wie der Roman darlegt, entsteht Nähe dadurch, dass man den Anderen, den man nicht kennt, der fremd ist, sein lässt und vor dessen Fremdheit nicht angsterfüllt zurückschreckt:Das Lieben und das Lassen geschah an Maitagen, in November- und Dezembernächten folgender Jahre. Je in anderer Gestalt und je in der endlichen Erkenntnis, dass größte Nähe größte Einsamkeit bedeutet. Sosehr sich diejenigen, die sich nunmehr begegneten, in engster Umarmung hielten und ihre Gesichter, ihre Körper, ihre Phantasien ineinander woben, so sehr vernahmen sie gleichzeitig die Wehmut des Abschieds. Aber — das Unerklärliche — sie ertrugen ihn. Wenigstens für Stunden. Sie ertrugen das du (LG 193).Die hergestellte Nähe zeitigt also die Erkenntnis, dass ein Verschmelzen zwischen dem Selbst und dem Anderen überhaupt nicht möglich ist. Maudis Mission besteht nun darin, (mit Neugier und Interesse) auf den unbekannten, fremden Anderen zuzugehen: „Staunen aber heißt Fremdheit empfinden und ertragen” (LG 122). Die Fremdheit des Anderen zu ertragen, heißt in diesem Sinne auch, den Anderen nicht nach eigenen Maßstäben ändern und damit dem Selbst anzupassen zu wollen, was — wie die Formulierung verdeutlicht — eine schwierige Aufgabe ist. Die Art der Beziehung zwischen Maudi und ihren Mitmenschen erinnert indes an ein von Emmanuel Lévinas u. a. in der Schrift Totalität und Unendlichkeit — Versuch über Exteriorität (dt. 1987) vorgestelltes Konzept, dem gemäß die Beziehung zwischen dem Selbst und dem Anderen vor jeder ontologischen Setzung eine ethische ist. „Das Sein ist Exteriorität” (1987: 418), heißt es bei Lévinas, was bedeutet, dass dem Selbst strukturell die „Vorgängigkeit des Anderen stets schon eingeschrieben ist” (Müller-Funk 2002: 3). Das Selbst wird über den Anruf des Antlitzes des Anderen als Subjekt instituiert, indem es zur Verantwortung für eben diesen Anderen gerufen wird:
Das Antlitz, in dem sich der — absolut andere — Andere präsentiert, verneint den Selben nicht, tut ihm keine Gewalt wie die Meinung oder die Autorität […]. Diese Präsentation ist Gewaltlosigkeit schlechthin; denn statt meine Freiheit zu verletzen, ruft sie sie zur Verantwortung und stiftet sie. Als Gewaltlosigkeit hält sie indes die Pluralität des Selben und Anderen aufrecht (Lévinas 1987: 292).Der Andere bleibt nach Lévinas in seiner Andersheit absolut, er stellt ein Gegenüber dar, das nicht vereinnahmt werden kann:
Das Können des Ich überwindet nicht den Abstand, der mit der Andersheit des Anderen angezeigt ist. Gewiss, meine innerste Innerlichkeit erscheint mir als fremd oder feindlich; die Gebrauchsgegenstände, die Nahrung, selbst die Welt, die wir bewohnen, sind andere im Verhältnis zu uns. Aber die Andersheit des Ich und der bewohnten Welt ist nur formal. […] An den Anderen bindet mich weder der Besitz noch die Einheit der Zahl noch auch die Einheit des Begriffs. Es ist das Fehlen eines gemeinsamen Vaterlandes, das aus dem Anderen den Fremden macht, der das Bei-mir-zu-Hause stört. Aber Fremder, das bedeutet auch der Freie. Über ihn vermag mein Vermögen nichts. Eine wesentliche Seite an ihm entkommt meinem Zugriff, selbst wenn ich über ihn verfüge (Lévinas 1987: 43/44).Auch für Maudi geht es nicht darum, den Anderen besitzen, ergreifen oder erkennen zu wollen. Für sie steht im Vordergrund, den Ruf der Verantwortung dem Anderen gegenüber anzunehmen, sich aus der vermeintlichen Selbstgenügsamkeit des ‚Bei-Sich-Zu-Hause‘ — die es im eigentlichen Sinne nicht gibt, da der Andere dem Selbst immer vorgängig ist — zu verabschieden und den Anderen bei sich willkommen zu heißen. Diesem Ruf des Anderen war Maudi schon als Kind nachgekommen, wie an der oben geschilderten Begegnung der Vierjährigen mit dem Vater deutlich geworden ist. Im Zuge von Maudis Krankenhausaufenthalt nach dem an ihr verübten Mordversuch — im Rahmen dessen die Ärzteschaft auch feststellt, dass Maudi am Syndrom der testikulären Feminisierung leidet — beschließt Maudi schließlich, dieses Hören des Rufs des Anderen zu ihrer Mission zu machen: „Sie wollte sich von nun an verschenken an jeden, der ihrer Nähe bedurfte” (LG 187). In Bezug auf das Verhältnis des Selbst zum Anderen betont Lévinas dessen grundlegende Asymmetrie (vgl. Lévinas 1984: 55). Es gilt nicht, vom Anderen etwas zurück zu erwarten, ansonsten würde der Andere lediglich den Egoismus des Selbst stützen (vgl. Shildrick 2002: 96f.). Auch Maudi erwartet von ihren Mitmenschen keine Gegenleistung, denn „[f]ür Vampire war sie geschaffen. Stillte Herzensdurst, Körperdurst, gab sich hin in dem Wissen, nichts dafür zu bekommen” (LG 236). Im Zentrum der Begegnung steht Maudis „gastfreundliche[r] Empfang” (Lévinas 1987: 222) des Anderen. In Bezug auf Lévinas‘ Text Totalität und Unendlichkeit betont Derrida, „welcome‘ is unarguably one of the most frequent and determinate words in that text” (1999: 25). Derrida, welcher sich über viele Jahre hinweg mit den Texten des befreundeten Lévinas auseinandergesetzt hat18, entwirft unter dem von ihm geprägten Begriff der unconditional hospitality ein Konzept, das große Ähnlichkeiten zu Lévinas‘ Ausführungen aufweist:
We offer hospitality only on the condition that the other follow our rules, our way of life […]. But pure or unconditional hospitality does not consist in such an invitation (‘I invite you, I welcome you into my home, on the condition that you adapt to the laws and norms of my territory […]‘). Pure and unconditional hospitality, hospitality itself, opens or is in advance open to someone who is neither expected nor invited, whomever arrives as an absolutely foreign visitor, as a new arrival, nonidentifiable and unforeseeable, in short, wholly other. […] The visit might actually be very dangerous, and we must not ignore this fact […] (Derrida 2003: 128f.).Das Selbst und der Andere als der ‚Nicht-Identifizierbare‘, der ‚absolut fremde Gast‘ stehen sich gegenüber, wobei diese Trennung nicht bedeutet, dass es keine Beziehung gibt — im Gegenteil, „diese Abwesenheit des anderen [sic!] ist gerade seine Anwesenheit als des anderen [sic!]” (Lévinas 1984: 65). Dadurch, dass es für das Selbst nicht möglich ist, den absolut Anderen zu erfassen, ebenso wie dadurch, dass der Andere nicht aufgefordert wird, sich vermeintlichen Bildern des Selbst vom Anderen anzupassen, können das Selbst und der Andere zueinander in eine Beziehung treten, die sich nicht in einem „Strudel wechselseitiger Dependenzen” (Askani 2002: 106) auflöst. Das Willkommen-Heißen des fremden Gastes stellt allerdings, wie im Zitat von Derrida deutlich wird, ein Risiko dar. Die britische Philosophin und Gender-Studies-Theoretikerin Margrit Shildrick hebt in diesem Zusammenhang hervor:
[E]thics, for Levinas [sic!], as for Derrida, is always a matter of risk. […] [E]xposure, a vulnerable openness in the face of alterity, is the very condition of becoming. In the place of the reactions of violence, intolerance and fear in the face of the strange encounter — all of which seek and necessarily fail to preserve an impossible separation — we might see that greeting and welcome are more appropriate (2002: 101).In der Begegnung zwischen dem Selbst und dem Anderen wird also beider Verletzlichkeit offenbar. Auch wenn das Selbst dem Anderen gegenüber Verantwortung übernimmt — sich um ihn kümmert (vgl. Shildrick 2002: 92) — ist es möglich, dass der Andere nicht in friedvoller Absicht kommt. Im Roman Die Luftgängerin ist Maudis Leben tatsächlich von ständiger Gewaltandrohung (vgl. LG 260f.) geprägt. Seit der Attacke auf die 15-Jährige wird sie von einem Unbekannten verfolgt, der, wie die Erzählinstanz verlautbart, Maudi „auslöschen” (LG 239) möchte. Wie im obigen Zitat von Shildrick deutlich wurde, stellt Gewalt einen Versuch dar, das oder den Andere(n) zu besitzen, die Grenze zwischen dem Selbst und dem Anderen zu überwinden, was sich als unmögliches Unterfangen herausstellt:
Töten ist nicht Beherrschen, sondern Vernichten, der absolute Verzicht auf das Verstehen. Der Mord übt Macht aus über das, was der Macht entkommt. […] Töten wollen kann ich nur ein absolut unabhängig Seiendes, dasjenige, das unendlich mein Vermögen überschreitet und das sich dadurch ihnen nicht entgegensetzt, sondern das eigentliche Können des Vermögens paralysiert. (Lévinas 1987: 284).Maudi ist sich dessen gewiss, dass ihr Verfolger keine Macht über sie gewinnen kann, dass jeder Versuch, sich ihrer zu bemächtigen, notwendig fehlschlagen muss und lässt diesen wissen: „Du kannst mir nichts antun” (LG 188). Gegen Ende des Romans stellt sich heraus, dass der russische Journalist Izjumov hinter den Anschlägen auf Maudi steckt. Er hatte in Maudi seine verstorbene Schwester Sonja wiedererkannt, die Jahre zuvor Suizid begangen und sich dem Bruder auf diese Weise endgültig entzogen hatte (vgl. LG 339ff.). Indem Izjumov Maudi verfolgt, versucht er, Kontrolle über die verlorene Schwester zu gewinnen. Aber nicht nur in der Begegnung mit Izjumov, auch in der Begegnung mit vielen weiteren Figuren, wird Maudi wiederholt mit Gewaltdrohungen konfrontiert. So äußert sich Eduard Flores, ein verhinderter Pianist, zu Maudi:
Sie war für ihn da, und er bat auch nicht, und sie tat, was er von ihr verlangte. Eine Erektion gelang ihm nicht. Aber dafür eine Erniedrigung. — Ich könnte dir jetzt den Hals umdrehen. Wie wäre das? Ich könnte dir den kleinen Hals so lange würgen, bis du tot bist. Das kann lange dauern. Wie wäre das? Wie wäre das? (LG 260f.)Angesichts dieser Drohungen setzt Maudi auf eine „Geste der Gelassenheit”, wie Müller-Funk (2002: 5) dies in Hinblick auf Lévinas‘ Theorie formuliert. Maudi reagiert stets ruhig und freundlich, „unfähig zur körperlichen Gewalt” (LG 236/237), als sei jedwede Art „instinktive[n] Selbstschutz[es] gar nicht in ihr ausgeprägt” (LG 235). Die Menschen in Jacobsroth sind es allerdings nicht gewohnt, dass Beziehungen nicht mit Besitz- und Machtansprüchen des Anderen über das Selbst verknüpft werden. Die Jacobsrother stellen „Gekränkte” (LG 128) dar, denen viel Schmerz in der Begegnung mit ihren Mitmenschen zugefügt worden ist. Die Figuren haben Schwierigkeiten, sich diesem Schmerz zu stellen, denn „[i]n einem Punkt lässt sich der rheintalische Mensch nicht übertreffen: Anstatt auf den eigenen Schmerz hinzugehen, geht er weg. […] In jedem Fall ist er nicht daheim, wenn ihn das Leben besuchen will in all seiner Pracht und Grausamkeit. Er lässt sich verleugnen” (LG 176)19. Aus Angst davor, vom Anderen nicht respektiert oder angenommen zu werden, versuchen die Figuren ihrerseits, Macht über ihr Gegenüber zu gewinnen. Je mehr dies aber zu einem Versuch wird, des Anderen habhaft zu werden, desto mehr entzieht sich dieser jedem Zugriff. Die daraus resultierenden Gefühle der Hilflosigkeit und Angst vor dem eigenen Ausgeliefertsein münden schließlich in Aggression. Gerade im Kontakt mit der so wenig aggressiven Maudi wird den Menschen ihr Zurückgeworfensein auf das eigene Selbst, ihre Verletzlichkeit angesichts des Anderen, deutlich. Sie erkennen ihren Mangel an Fähigkeit, den Anderen besitzen zu können, was Maudi für ihre Mitmenschen furchterregend und unheimlich macht. Demensprechend folgert Maudi, Rilke zitierend: „Ein jeder Engel ist schrecklich” (LG 260, Markierung dem Original entnommen, Anm. A. B.)20. In Bezug auf Lévinas‘ Modus, die Beziehung zwischen dem Selbst und dem absolut Anderen zu fassen, wurde allerdings wiederholt Kritik laut. „Die Kehrseite der Philosophie ist ihr Absehen vom Konkreten” (2002: 5) moniert Müller-Funk und bezeichnet Lévinas‘ Konzept des Anderen als „abstrakt-universalistisch” (2002: 5). Da es Lévinas nicht um den spezifisch Anderen geht — handle es sich beim Anderen im Sinne Irigarays (1984) um die Frau, oder im Sinne Kristevas (1990) um die/den ethnisch Fremde/n, oder im Sinne Shildricks (2002) um die/den körperlich ‚monströs‘ Anderen o. A. -, zeigt sich Shildrick besorgt, dass in der Konzentration auf den absolut Anderen die Möglichkeit verfehlt wird, „to think the radical alterity between all the others” (2002: 99). Ähnlich dem Konzept der unconditional hospitality Derridas, das dieser als „Ideal” (2003: 129) bezeichnet, erscheinen Lévinas‘ Gedanken schwer umsetzbar in einer sozio-politischen Realität. Gerade Die Luftgängerin als literarisches Werk könnte hier allerdings als Versuch gewertet werden, die abstrakt-universalistischen Konzepte eines Lévinas oder Derrida in eine (wenn auch fiktionale) soziale Welt zu überführen. Die Luftgängerin individualisiert Lévinas‘ Konzept; Maudi begegnet einer Vielzahl von Anderen, die einerseits in ihrem Ruf an das Selbst diesen absolut Anderen verkörpern, aber gleichzeitig diesem Anderen eine konkrete, finite Form geben. Die Differenzen zwischen den jeweils Anderen werden deutlich, so kümmert sich Maudi u. a. um den allein lebenden, zu sozialen Bindungen kaum fähigen Boje, dessen Erscheinungsbild geprägt ist von „hervorquellenden Augen” und einem „pflaumengroße[n] Adamsapfel”, die auf eine „Schilddrüsenüberfunktion” (alle Zitate LG 88) hindeuten. Sie nähert sich dem bereits erwähnten verhinderten Pianisten Eduard Flores, der seine ‚Zwillingsseele‘ aufgrund mangelnder Hilfeleistung an einem Epilepsieanfall versterben ließ (LG 248/249), der sterbenden Großmutter (LG 271/272), sowie vielen „Rother[n], Jacober[n], Türken und Jugoslawen” (LG 236). In der Begegnung mit diesen Anderen versucht Maudi, unterschiedliche Antworten auf unterschiedliche Bedürfnisse zu geben. Maudis ‚Engelsmission‘ stellt dabei zunächst eine Vorstufe auf dem Weg dar, ihre Mitmenschen dafür zu öffnen, in der Begegnung mit Anderen zu erkennen, dass ein Willkommen die bessere Antwort auf den Ruf des Anderen ist als Gewalt, wie Shildrick im Zitat oben (2002: 101) nahelegt. Dabei geht Maudi einen scheinbar paradoxen Weg — den der Anpassung. Es stellt sich für sie als notwendig dar, sich einem Bild anzugleichen, das für den jeweiligen Anderen von Bedeutung ist — einem Bild, das der Andere kennt, von dem er glaubt, es verstehen zu können. Aus diesem Grund ändert Maudi beständig ihr Aussehen und ihre Kleidung (vgl. LG 236) und kommt damit den Wünschen ihrer Mitmenschen entgegen, für die Annäherung nur möglich ist, wenn sich ihr Gegenüber in für sie bekannten Rollen vorstellt. Sie suchen das Idente (und Fassbare), der Andere wird zu einem „selfsame” (Shildrick 2002: 93) assimiliert und sei es in Form einer Negation des Selbst, die abgewertet, ausgegrenzt wird. Maudis Verhalten wird dergestalt wiederholt innerhalb gewohnter Schablonen wahrgenommen, indem die BewohnerInnen von Jacobsroth sie als „Hure” (LG 236) oder als „verrückt Gewordene” (LG 236) bezeichnen. Gerade diese Bezeichnungen verdeutlichen, wie das Selbst und der Andere kategorisiert und fixiert werden. Es folgt eine Einordnung in binäre Systeme, das Selbst und der Andere erfahren eine qualitative Wertung und Hierarchisierung. Indem Maudi sich den Vorstellungen der Anderen anpasst, versucht sie, diesen die Angst vor der Begegnung zu nehmen, sodass zu einem späteren Zeitpunkt auch eine Begegnung mit dem Anderen möglich ist, die nicht von Assimilation und Machthierarchien geprägt ist. Auch die Mitmenschen Maudis sollen dem Ruf der Verantwortung für den Anderen folgen können und dabei in der Lage sein, den Anderen in seiner Differenz wahrzunehmen. In diesem Zusammenhang gilt es nicht zu vergessen, dass nach Lévinas die Begegnung mit dem Anderen überhaupt erst ermöglicht, dass das Selbst als ‚autonomes‘ Subjekt zutage treten kann. Innerhalb der poststrukturalistisch orientierten Gender Studies werden die Mechanismen der Subjektkonstitution auf ähnliche Weise wie hier dargestellt gefasst. So setzt sich auch die US-amerikanische Philosophin Judith Butler in dem Kapitel Sehnsucht nach Anerkennung aus dem 2009 erschienenen Band Die Macht der Geschlechternormen und die Grenzen des Menschlichen (orig. Undoing Gender, 2004) mit Lévinas auseinander21. Durchaus kompatibel mit Lévinas‘ Positionen in Totalität und Unendlichkeit beharrt auch Butler darauf, dass das Selbst vom Anderen als Subjekt instituiert wird:
Der Preis des Selbstwissens wird der Selbstverlust sein. Der Andere bietet die Möglichkeit, dieses Selbstwissen sowohl zu sichern als auch zu untergraben. Was jedoch klar wird, ist, dass das Selbst nie frei vom Anderen zu sich selbst zurückkehrt, dass seine ‚Relationalität‘ dafür bestimmend wird, wer das Selbst ist (2009: 240).Auf diese Weise werden ontologische Vorstellungen des Subjekts aufgegeben, das Selbst stellt von vorneherein ein gespaltenes dar:
Wenn wir annehmen, dass das Selbst erst existiert und sich dann spaltet, nehmen wir an, dass der ontologische Status des Selbst selbstgenügsam ist, bevor es der Spaltung unterzogen wird (ein, wenn man so will, aristophanischer Mythos […]). Damit versteht man aber weder den ontologischen Vorrang der Relationalität selbst noch seine Folgen für Überlegungen zum Selbst in seiner notwendigen (und ethisch folgenreichen) Uneinigkeit (Butler 2009: 244).In Bezug auf Butler und Lévinas erfolgt die Abkehr von Platons ‚aristophanischem Mythos‘ auf zweifache Weise: Einerseits kann aufgrund der immanenten Abhängigkeit des Selbst vom Anderen das Selbst nicht als ursprünglich selbstgenügsames Ganzes gefasst werden, das erst zu einem späteren Zeitpunkt über den Kontakt zum Anderen eine Spaltung erfährt. Andererseits wendet sich Lévinas in Bezug auf Liebesbeziehungen vom ‚aristophanischen Mythos‘ ab, welcher impliziert, dass das Selbst und der Andere in der Begegnung Grenzen überschreitend eins werden. Auch innerhalb der von sexuellem Begehren geleiteten Liebesbeziehung bleibt die Trennung zwischen Selbst und Anderem unaufhebbar. Es geht Lévinas dezidiert darum, sich im Gegensatz zu mythischen Konzepten davon abzuwenden, „das Verhältnis zum anderen [sic!] […] als ein Verschmelzen zu bestimmen. Ich habe gerade bestreiten wollen, dass das Verhältnis zum anderen [sic!] ein Verschmelzen ist. Das Verhältnis zum anderen [sic!] ist die Abwesenheit des anderen [sic!]” (1984: 61). In Bezug auf diese Ausführungen wird deutlich, warum die sogenannten ‚seraphischen‘ Liebesbeziehungen in Die Luftgängerin scheitern, denn innerhalb dieser halten die Liebenden an einem Ideal fest, das, wie im Zitat (LG 20) weiter oben deutlich wurde, von ‚totaler Erkenntnis‘ und einem ‚totalen Begreifen‘ des Anderen ausgeht. Damit findet aber in diesen Beziehungen genau besehen „keine Anerkennung in der Verschiedenheit, sondern in Absehung von dieser statt” (Maihofer 2009: 25). Die ‚seraphischen‘ Liebesbeziehungen im Roman scheitern22, da die Liebenden nicht bereit sind, den ‚Zugriff‘ auf den jeweils Anderen zu lockern. Der Andere soll den Vorstellungen des Selbst einverleibt werden. So moniert Maudis Vater Ambros seiner Frau gegenüber: „Du kannst mich nicht sein lassen” (LG 61; Markierung dem Original entnommen, Anm. A. B.).
Die (geschlechtliche) Id/entität Maudis
Der Umstand, dass Maudi sich den Vorstellungen ihrer Mitmenschen anpassen muss, um mit ihnen in Kontakt treten zu können, wirft indes Fragen auf. „Sie tat alles, um dem Elend Gegenwart zu geben. Es war ihr gleichviel, dass diese Gegenwart einer männlich sexualisierten Vorstellung zu gehorchen hatte” (LG 236), heißt es im Roman über Maudi. Verbirgt sich also hinter Maudis ethischer Position des Willkommen-Heißens des Anderen eine überkommene Konzeption von Weiblichkeit, der gemäß sich Frauen stets den Vorstellungen einer patriarchalischen Gesellschaft anzupassen haben? Um diese Frage zu beantworten, gilt es noch einmal zu Lévinas zurückzukehren. Wiewohl im letzten Abschnitt die Anschlussfähigkeit von Lévinas‘ Schriften an Positionen der poststrukturalistisch geprägten Gender Studies aufgezeigt wurde, greift u. a. Shildrick kritische Stimmen aus den Gender Studies zu Lévinas auf:In responding to the need of the stranger-other with a hospitality without limit, by giving shelter and nourishment, I enact a donation without return which positions me not as a beneficent subject, but as a pre-ontological maternal hostage. It is hardly surprising that for feminist critics […] the focus on what seems to amount to a form of self-annulment raises serious misgivings (2002: 92).Tatsächlich operiert Lévinas an zentralen Stellen von Totalität und Unendlichkeit oder Die Zeit und der Andere23 mit den Begriffen ‚Frau‘ und ‚Weiblichkeit‘, wenn es darum, das gastfreundliche Selbst darzustellen, denn „der Andere, dessen Anwesenheit auf diskrete Weise eine Abwesenheit ist, von der aus sich der gastfreundliche Empfang schlechthin, der das Feld der Intimität beschreibt, vollzieht, ist die Frau” (1987: 222). Lévinas betont indes, dass er die Begriffe ‚Frau‘ und ‚Weiblichkeit‘ strikt metaphorisch verwendet (1987: 226). Obwohl sowohl Shildrick (2002: 98ff.) als auch Derrida (1999: 36ff.) ihre Vorbehalte gegenüber einer vermeintlich androzentrischen Basis von Lévinas Schriften nicht gänzlich auszuräumen in der Lage sind, kommen beide zu dem Schluss, dass Lévinas den Begriff der ‚Weiblichkeit‘ umschreibt24. Für Derrida scheint es sogar möglich, Totalität und Unendlichkeit als „feminist manifesto” (1999: 44) zu verstehen:
For this text defines the welcome par excellence, the welcome or welcoming of absolute, absolutely originary, or even pre-originary hospitality, nothing less than the pre-ethical origin of ethics, on the basis of femininity. […] It confers the opening of the welcome upon the ‚feminine being‘ and not upon the fact of empirical women (Derrida 1999: 44).‚Weiblichkeit‘ wird dergestalt verstanden als Metapher für das Menschsein im Allgemeinen, das über die Verantwortung des Selbst für den Anderen definiert wird. Biologische Körperformationen spielen in diesem Zusammenhang keine Rolle. Die Luftgängerin erweist sich als durchaus anschlussfähig an diese Positionen. Maudi verkörpert im Roman das Konzept einer ‚weiblichen‘ Gastfreundschaft. Dem Umstand, dass Maudi biologisch gesehen ein Hermaphrodit ist, kommt in diesem Zusammenhang eine mehrfache Bedeutung zu. Wiewohl Maudi innerhalb des Romangeschehens von den Figuren als (sich wandelnde) Frau wahrgenommen wird, repräsentiert sie aufgrund ihrer hermaphroditischen körperlichen Konstitution kein biologisches Geschlecht: „Maudi ist weder Hermes noch Aphrodite, auch nicht beides gleichzeitig” (LG 157), heißt es im Roman. Maudi ist also weder Mann noch Frau, auch nicht beides gleichzeitig im Sinne einer antiken Vollkommenheitsidee. Denn in diesem Zusammenhang zeigt es sich als bedeutend, dass Hermaphroditismus im Roman als Krankheit thematisiert wird. Maudis Körper erscheint fragmentiert, etwas fehlt, etwas ist zu viel. Der Gender-Theoretikerin Anna Babka zufolge zeigt sich der Hermaphrodit (ähnlich dem Cyborg) als „widersprüchlich und paradox, weil er/sie verstümmelt, d. h. nicht id/entisch menschlich aber zugleich überausgestattet präsentiert wird” (2008: 252). Hermaphroditismus präsentiert sich somit als Metapher für Hybridität und Disruption. Maudi erscheint zwar als „eins […] mit sich” (LG 211), aber das Eine ist fragmentiert, gebrochen. Die Anpassungsleistungen Maudis an die Vorstellungen ihrer Mitmenschen zeigen sich in diesem Licht als vorübergehende Manifestationen einer grundlegend nicht re/präsentierbaren Id/enität. Dem Vorwurf, Maudis Verhalten würde einem „self-annulment” (Shildrick 2002: 92) gleichkommen, kann in diesem Sinne entgegen gehalten werden, dass Maudis Selbst jenseits jeder Erkenn- und Fassbarkeit liegt und auf diese Weise nicht annulliert werden kann. Mit dieser Konzeption einer (geschlechtlich) nicht re/präsentierbaren Id/entität geht Die Luftgängerin darüber hinaus, die heterosexuelle Liebesbeziehung — wie es bei Ovid oder Rilke anklingt — als die grundlegende Beziehungsform der Menschheit festzuschreiben. Maudis Engelsmission umfasst die Menschen im Allgemeinen, deren Differenzen um vieles vielfältiger sind als die geschlechtliche ‚Masterdifferenz‘ zwischen (einer biologisch verstandenen) Männlichkeit und Weiblichkeit. Dementsprechend nähert sich Maudi sowohl Männern als auch Frauen:
Die Rede fällt auf die Liebe. Esther tastet sich vor. Weshalb Maudi, das falle ihr auf, noch nie eine Beziehung zu einem Mann gehabt habe. Eine wirkliche Beziehung […]. Maudi zuckt mit den Schultern. Sie wisse es nicht. Nie habe sie Unterschiede gemacht zwischen Mann und Frau. Ausschließlichkeit habe es nie für sie gegeben. Auf ihre Weise habe sie alle Menschen auf einmal lieben wollen. — Das geht doch nicht, sagt Esther resolut. — Ja, leider, antwortet Maudi (LG 328/329).Wie dargestellt, geht es Maudi darum, die Menschen in ihrem Umfeld ‚willkommen zu heißen‘, d. h. Nähe zu ihnen aufzubauen, indem sie ihnen Anerkennung zuteil werden lässt. Auf diesem Wege sollen diese dahin geführt werden, Verantwortung für den Anderen in ihrem Umfeld zu übernehmen. Der Andere in seiner Fremdheit soll nicht mehr als Bedrohung des Selbst angesehen werden. Im Gegensatz dazu gilt es, sich der Verletzlichkeit des eigenen Selbst wie des Anderen bewusst zu werden. Da sich die Jacobsrother diesem Prozess aber verweigern, deutet das Ende des Romans an, dass Maudi bereit ist, ihre ‚Engelsmission‘ aufzugeben. Sie wird nach den Worten der Mutter zur ‚normalen Frau‘, d. h. sie kategorisiert sich:
Sie ist ruhiger geworden, versöhnlicher. Sie redet, und manchmal tut sie sogar Dinge wider ihren Willen. Sie geht Kompromisse ein, die noch vor einem Jahr undenkbar gewesen wären. […] Es scheint als sei in Maudi etwas erloschen, als sei etwas von ihr weggegangen, eine Art Leuchten der Seele. Als schicke sie sich an, eine ganz normale Frau zu werden (LG 321).Der Roman endet zudem mit einer ‚seraphischen‘ Begegnung zwischen Maudis Halbschwester Esther und Engelbert Quaidt, einem älteren Mann, dem sie nach New York gefolgt ist. Wie bei den früheren seraphischen Liebes-Begegnungen blickt der Mann auf die Frau und erkennt in ihr seine ‚Zwillingsseele‘ (LG 350). Damit bleibt am Ende wiederum nur die heterosexuelle Liebe als einziger (im Roman bisher wenig erfolgreicher) Beziehungs-Modus, im Rahmen dessen Nähe möglich scheint, während das alternative Modell Maudis am Widerstand der Mitmenschen scheitert.
Schlussbemerkungen
Wie die obigen Ausführungen zeigen, nimmt der Roman Die Luftgängerin Elemente unterschiedlicher wissenschaftlicher sowie künstlerischer Diskurse um das Motiv des Hermaphroditismus auf und setzt sie in der Figur der Maudi Lahtur in Verbindung. Maudi Lahtur ist indes nicht als psychologische Figur angelegt. Es gilt im Roman nichts über ihre Gewordenheit sowie über Entwicklungen ihrer Persönlichkeit zu erfahren. Vielmehr verkörpert die Protagonistin innerhalb des Romangefüges ein abstraktes Konzept. Der Text spielt in diesem Zusammenhang mit Vorstellungen des Hermaphroditen (und Engels) als Sinnbild einer Vollkommenheit, die über die komplementäre Verbindung ‚männlicher‘ und ‚weiblicher‘ Körpermerkmale zum Ausdruck gebracht wird. Letztlich setzt sich der Roman aber von diesen Vorstellungen ab. Dabei wird in Maudi die scheinbar inkommensurable Differenz zwischen dem Männlichen und Weiblichen aufgebrochen, Maudi stellt als zwischen- oder zweigeschlechtlicher Hermaphrodit, dessen devianter Körper zugleich verstümmelt und überausgestattet (vgl. Babka 2008: 252), aber nicht vollkommen ist, Symbol des Nicht-Repräsentierbaren dar, das in sich hybrid und fragmentiert ist. Auf diese Weise wird in Die Luftgängerin zum einen jenen Vorstellungen eine Absage erteilt, denen gemäß das Selbst ein selbstgenügsames Ganzes darstellt. Zum anderen zeigt es sich als unmöglich, (u. a. über den Weg der sexuellen Vereinigung) mit dem Anderen zu einem Ganzen zu verschmelzen. Wiewohl das Selbst vom Anderen abhängt, um als Subjekt ins Leben gerufen zu werden, heißt es in der Begegnung mit dem Mitmenschen, diesen als getrennte Entität wahrzunehmen. Das Verhältnis zwischen dem Selbst und dem Anderen stellt indes nach Lévinas ein immanent ethisches dar. So versucht Maudi, dem Ruf des Anderen zu folgen, was bedeutet, in der Begegnung mit dem Anderen Verantwortung für diesen zu übernehmen. Es gilt, den Anderen trotz seiner Fremdheit ‚willkommen zu heißen‘. Dabei setzt Maudi das Konzept einer unconditional hospitality, wie Derrida es nennt, um. Ziel ist es dabei, dem Anderen zu begegnen, ohne diesen an Vorstellungen des Selbst anpassen zu wollen — er bleibt stets der absolut Andere, der nicht erkannt werden kann. Sowohl Lévinas, Derrida als auch Shildrick haben in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass die Begegnung mit dem Anderen ein Risiko darstellt, da die Verletzlichkeit beider offenbar wird. Maudi möchte ihre Mitmenschen dazu hinführen, sich dem Anderen zu stellen — trotz oder gerade wegen dieser Verletzlichkeit. Auch wenn Maudis Mission im Roman am Ende zu scheitern droht, kann der Text als Versuch gelesen werden, diesem Konzept in der Figur der Maudi zu kurzem Leben verholfen zu haben.Bibliographie
AJOOTIAN, Aileen: Monstrum or Daimon. In: Berggreen, Brit und Marinatos, Nanno (Hg.): Greece and Gender. Bergen 1995. S. 93–108. Ajootian. Aileen: The Only Happy Couple. In: Koloski-Ostrow, Olga und Lyons, Claire (Hg.): Naked Truths. Women, sexuality, and gender in classical art and archaeology. London/New York 1997. S. 220–242. ASKANI, Thomas: Die Frage nach dem Anderen. Im Ausgang von Emmanuel Lévinas und Jacques Derrida. Wien 2002. AURNHAMMER, Achim: Androgynie. Studien zu einem Motiv in der deutschsprachigen Literatur. Köln/Weimar/Wien 1986. BABKA, Anna: Reading Kleist Queer. Eine rhetorisch-dekonstruktive Lektüre von Kleists Über das Marionettentheater. In: Babka, Anna und Hochreiter, Susanne (Hg.): Queer Reading in den Philologien. Modelle und Anwendungen. Göttingen 2008. S. 237–264. Breckwoldt, Meinert: Sexuelle Differenzierungen und ihre Störungen. In: Pfleiderer, Albrecht, Breckwoldt, Meinert und Martius, Gerhard (Hg): Gynäkologie und Geburtshilfe. Sicher durch Studium und Praxis. Stuttgart/New York 2002. S. 1–12. BUTLER, Judith: Das Unbehagen der Geschlechter. Frankfurt/Main 1991 [1990]. BUTLER, Judith: Körper von Gewicht. Die diskursiven Grenzen des Geschlechts. Frankfurt/Main 1997 [1993]. BUTLER, Judith: Die Macht der Geschlechternormen und die Grenzen des Menschlichen. Frankfurt/Main 2009 [2004]. DERRIDA, Jacques: Adieu to Emmanuel Levinas. Stanford 1999 [1997]. Derrida, Jacques: Autoimmunity: Real and symbolic suicides. A dialogue with Jacques Derrida. In: Borradori, Giovanna (Hg.): Philosophy in a time of terror. Dialogues with Jürgen Habermas and Jacques Derrida. Chicago/London 2003. S. 85–136. ENGELHARDT, Dietrich von: Vom Dialog der Medizin und Literatur im 20. Jahrhundert. In: Jagow, Bettina von und Steger, Florian (Hg.): Repräsentationen. Medizin und Ethik in Literatur und Kunst der Moderne. Heidelberg 2004. S. 21–40. FAUSTO-STERLING, Anne: Sexing the Body: Gender Politics and the Construction of Sexuality. New York 2000. FOUCAULT, Michel: Über Hermaphrodismus. Der Fall Barbin. Herausgegeben von Wolfgang Schäffner und Joseph Vogl. Frankfurt/Main 1998 [1978]. HAGE, Volker: Robert Schneider: Die Luftgängerin — Schlurf heimwärts, Engel. In: Spiegel online. URL: http://www.spiegel.de/kultur/literatur/0,1518,27289,00.html (Stand: 30.7. 2010). IRIGARAY, Luce: Speculum, Spiegel des anderen Geschlechts. Frankfurt/Main 1984 [1974]. KRAUSS, Heinrich: Die Engel. Überlieferung, Gestalt, Deutung. München 2000. Kristeva, Julia: Fremde sind wir uns selbst. Frankfurt/Main 1990 [1988]. LANG, Claudia: Intersexualität. Menschen zwischen den Geschlechtern. Frankfurt/New York 2006. LÉvinas, Emmanuel: Die Zeit und der Andere. Übersetzt und mit einem Nachwort versehen von Ludwig Wenzler: Hamburg 1984 [1979]. LÉVINAS, Emmanuel: Totalität und Unendlichkeit. Versuch über die Exteriorität. München 1987 [1980]. LINK, Jürgen: Literaturanalyse als Diskursanalyse. Am Beispiel des Ursprungs literarischer Symbolik in der Kollektivsymbolik. In: Fohrmann, Jürgen und Müller, Harro (Hg.): Diskurstheorien und Literaturwissenschaft. Frankfurt/Main 1988. S. 284–257. LÖFFLER, Sigrid: Ein Engel kommt nach Jacobsroth. In: Die Zeit 3 (8.1. 1998). S. 42. LOQUAI, Franz: Auf sein Herz gehört. Nachlese zu Robert Schneiders ‚Die Luftgängerin‘. In: Literaturkritik.de. URL: http://www.literaturkritik.de/public/rezension.php?rez_id=34 (Stand: 30. 7. 2010). MAIHOFER, Andrea: Geschlecht als Existenzweise. Macht, Moral, Recht und Geschlechterdifferenz. Frankfurt/Main 1995. MAIHOFER, Andrea: Dialektik der Aufklärung. Die Entstehung der modernen Gleichheitsidee, des Diskurses der qualitativen Geschlechterdifferenz und der Rassentheorien. In: Zeitschrift für Menschenrechte 1 (2009). S. 20–36. MEHLMANN, Sabine: Unzuverlässige Körper. Zur Diskursgeschichte des Konzeptes geschlechtlicher Identität. Königstein 2006. MÜLLER-FUNK, Wolfgang: Das Eigene und das Andere / Der, die, das Fremde. Zur Begriffserklärung nach Hegel, Levinas, Kristeva, Waldenfels. In: Kakanien Revisited (15.9. 2002). S. 1–7. URL: http://www.kakanien.ac.at/beitr/theorie/WMueller-Funk2.pdf (Stand: 30.7. 2010). MONEY, John: Sex Errors of the Body. Dilemmas, Education, Counseling. Baltimore 1968. OVIDIUS NASO, Publius: Metamorphosen. Übersetzt und herausgegeben von Hermann Breitenbach. Stuttgart 1971. RILKE, Rainer Maria: Duineser Elegien / Die Sonette an Orpheus. Stuttgart 2007. SCHNEIDER, Robert. Die Luftgängerin. München 1998: SHILDRICK, Margrit: Embodying the Monster. Encounters with the Vulnerable Self. London et al. 2002. Wenzler, Ludwig: Nachwort. Zeit als Nähe des Abwesenden. Diachronie der Ethik und Diachronie der Sinnlichkeit nach Emmanuel Levinas. In: Levinas, Emmanuel: Die Zeit und der Andere. Hamburg 1984. S. 67–92.Anmerkungen:
- Vgl. auch Hage, http://www.spiegel.de/kultur/literatur/0,1518,27289,00.html (Stand: 30. 7. 2010). ↩
- Loquai, http://www.literaturkritik.de/public/rezension.php?rez_id=34 (Stand: 30.7. 2010). ↩
- Hage, http://www.spiegel.de/kultur/literatur/0,1518,27289,00.html (Stand: 30. 7. 2010). ↩
- Loquai, http://www.literaturkritik.de/public/rezension.php?rez_id=34 (Stand: 30.7. 2010). ↩
- Hage, http://www.spiegel.de/kultur/literatur/0,1518,27289,00.html (Stand: 30.7. 2010). ↩
- Loquai, http://www.literaturkritik.de/public/rezension.php?rez_id=34 (Stand: 30.7. 2010). ↩
- Loquai, http://www.literaturkritik.de/public/rezension.php?rez_id=34 (Stand: 30.7. 2010). ↩
- Loquai, http://www.literaturkritik.de/public/rezension.php?rez_id=34 (Stand: 30.7. 2010). ↩
- Vgl. Aurnhammer, 1986: 31. Aurnhammer erläutert a.a.O. auch, dass dieser Mythos vor allen Dingen dazu diente, sexuelle Konfigurationen, allen voran die männliche Homosexualität, innerhalb der Sozialordnung Athens zu legitimieren. ↩
- Als Gegenstände der Kunst in der römischen Antike bringen Hermaphroditen — ausgestattet mit weiblichen Brüsten und Penis — als Idole eine „Selbstvergottung” (Aurnhammer 1986: 37) des Menschen zum Ausdruck, Damit werden die anthropomorphen Darstellungen des Hermaphroditen nach Aurnhammer „über die Harmonie zwischen männlich und weiblich hinaus zum schönen Sinnbild einer Synthese von menschlicher und göttlicher Natur” (Aurnhammer 1986: 35). ↩
- Dass diese engelhafte Vollkommenheit androgyne Züge trägt, wird u. a. an dem Umstand deutlich, dass Hermaphroditos zu Beginn der Geschichte sowohl mit den Attributen der Sonne (männlich) als auch des Mondes (weiblich) ausgestattet wird: „[D]es Knaben Gesicht überflutet / Röte, nicht kennt er die Liebe -; doch steht auch die Röte ihm reizend / So ist das Elfenbein koloriert, wenn es rötlich gefärbt ist, / Oder die Äpfel am sonnigen Baum, oder unter des Mondes / Glanz die Röte” (IV, 329–333, übersetzt von Hermann Breitenbach, Stuttgart 1971: 133f.) ↩
- Der Hermaphroditismus spielt innerhalb der Teratologie als Lehre von den ‚Monstrositäten‘ (teras, griech. wildes Tier, Monster) eine besondere Rolle, vgl. Mehlmann 2006: 94ff. ↩
- Besondere Bedeutung für die Thematik des Hermaphroditismus erlangt dieser Umstand in Zusammenhang mit der Tatsache, dass seit den 1950ern den MedizinerInnen die Möglichkeiten gegeben werden, einem Menschen nicht mehr nur ein Geschlecht zuzuordnen, sondern dieses mittels Phallo- und Vaginalplastik chirurgisch zu konstruieren. Indem durch chirurgische Eingriffe sowie hormonelle Behandlungen das Geschlecht einer Person vereindeutigt wird, soll eine Traumatisierung abgewendet werden. Zugleich gilt es von Seiten der Medizin — im Sinne einer heteronormativen Logik — ‚funktionierende‘ Männer und Frauen herzustellen, vgl. Money: „In male hermaphroditism there are some lucky cases in which the individual rejects a masculine assignment […]. These are the cases in which the penis will remain forever unfunctional in coitus […], whereas, after surgical and hormonal feminization, the individual will function adequately as a female” (1968: 86). Gerade diese (Verstümmelungs-)Praktiken geraten im ausgehenden 20. Jahrhundert ins Kreuzfeuer der Kritik. Während sich viele Betroffene mit ihren (Leidens-)Geschichten in die Öffentlichkeit wagen, partizipieren auch ForscherInnen mit ihren Publikationen an den u. a. politisch motivierten Kämpfen gegen Genitaloperationen an Kleinkindern und Babys, vgl. Fausto-Sterling 2000: 78–114. ↩
- Vgl. zum Begriff des Interdiskurses Link 1988. ↩
- Zitate aus dem Text, versehen mit der Sigle LG, sind der folgenden Ausgabe entnommen: Schneider, Robert: Die Luftgängerin. München 1999 [1998]. ↩
- Letztlich deutet sich im Roman an, dass der russische Journalist Izjumov hinter den Attacken auf Maudi steckt. Er hält Maudi für eine Reinkarnation seiner Schwester Sonja, welche vor ihrem Suizid Ähnlichkeiten zu Maudis Wesen und Aussehen aufgewiesen hatte (vgl. LG 311ff. resp. LG 339ff.). ↩
- So heißt es in Rilkes Zweiter Duineser Elegie: „Ich weiß / ihr berührt euch so selig, weil die Liebkosung verhält, / weil die Stelle nicht schwindet, die ihr, Zärtliche, / zudeckt; weil ihr darunter das reine / Dauern verspürt. So versprecht ihr euch Ewigkeit fast von der Umarmung” (2007: 13). ↩
- Derrida setzt sich u. a. in der Grabrede Adieu to Emmanuel Levinas (1999) mit dessen Werk auseinander. ↩
- Aufgrund der mangelnden Auseinandersetzung mit dem eigenen Selbst stellt jede/r in diesem Sinne, wie es Julia Kristeva in ihrem auf Freud zurückgehenden, psychoanalytischen Ansatz formuliert hat, eine/n Fremde/n für sich selbst dar (vgl. Kristeva 1990: 209). ↩
- Rilkes Zweite Duineser Elegie setzt ein mit dem Vers: „Jeder Engel ist schrecklich” (2007: 11). ↩
- Im 6. Kapitel aus Die Macht der Geschlechternormen (Titel: Sehnsucht nach Anerkennung) setzt sich Butler mit Jessica Benjamins Konzeption des Anderen auseinander und greift in ihrer Lektüre von Benjamin auch auf Lévinas zurück, vgl. Butler 2009: 215–246. ↩
- Im eigentlichen Sinne scheitern nur zwei der drei Liebesbeziehungen, denn die dritte — jene zwischen Esther und Engelbert Quaidt — beschließt den Roman (LG 350). ↩
- In Die Zeit und der Andere heißt es: „Ich denke, dass das absolut Gegensätzliche, dessen Gegensätzlichkeit in nichts durch das Verhältnis beeinträchtigt wird, das man zwischen ihm und seinem Korrelat errichten könnte, dass die Gegensätzlichkeit, die dem Bezugspunkt erlaubt, absolut anders zu bleiben, das Weibliche ist” (Lévinas 1984: 56). ↩
- Vgl. Shildrick 2002: 98–99. ↩

Dr. Angelika Baier studierte Germanistik sowie Publizistik- und Kommunikationswissenschaften an den Universitäten Salzburg, Wien und Santiago de Compostela. Ihre Dissertation zur narrativen Konstitution der Figur der/s Erzählerin/s in deutschsprachigen Rap-Texten schloss sie 2008 an der Universität Wien ab. Derzeit ist Dr. Baier Post-Doc-Kollegiatin am Graduiertenkolleg „Repräsentation – Materialität – Geschlecht: historische und gegenwärtige Neuformierungen von Geschlecht“ am Zentrum für Gender Studies an der Universität Basel. Ab 2011 ist Dr. Baier als Projektassistentin an der Universität Wien tätig. In ihrem derzeitigen Forschungsprojekt arbeitet sie am Motiv des Hermaphroditismus in der zeitgenössischen Literatur.