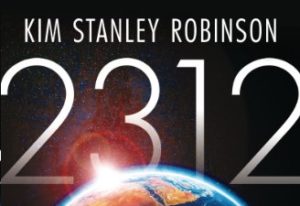© Marvel Studios / Disney+
von Jona Kron
Mit The Falcon and the Winter Soldier spendiert Drehbuchautor Malcom Spellman dem Marvel Cinematic Universe (MCU) eine zweite Miniserie. Die insgesamt sechs Episoden (à ca. 60 Min.) bauen auf der Handlung des Kinoblockbusters Avengers: Endgame (2019) auf, erzählen jedoch eine in sich mehr oder minder geschlossene Geschichte. Gelingt nun der Anschluss an den Erfolg der ersten Miniserie WandaVision (2021) und für welche Zwecke nutzt Spellman die immense Reichweite des Marvel-Universums?
Die Prämisse ist zunächst denkbar simpel: der Anführer der Avengers, Steve Rodgers alias Captain America, hat seinen Rundschild an den Nagel gehängt. In seiner direkten Nachfolge stehen die beiden Protagonisten Bucky Barnes alias Winter Soldier und Sam Wilson alias Falcon. Aber keiner der beiden möchte die Persona ihres gemeinsamen Mentors und Freundes annehmen. Weshalb Sam entscheidet, den an ihn weitergereichten Schild mit den rot-weißen Streifen und dem weißen Stern auf blauem Grund zur Aufbewahrung der US-amerikanischen Regierung zu übergeben.
Allerdings bekommen es die Helden im weiteren Verlauf der Serie gleich mit zwei Antagonist*innen zu tun, die das Vermächtnis des Captains auf zweifelhafte Weise am Leben erhalten. Da ist zum einen die Anführerin der zunehmend radikaler handelnden, anti-nationalen Anarchistengruppe der Flag Smashers, Karli Morgenthau. Und zum anderen John Walker, ein US-Soldat höchsten Ranges — blond und blauäugig. Ihn ernennt die Regierung kurzerhand zum neuen Captain America. Morgenthau und Walker gelangen beide in den Besitz der Mixtur, die bereits Steve Rodgers seine übermenschlichen Kräfte verliehen und ihn zum „Super Soldier“ gemacht hatte.
Karlis Bond-eske Verfolgungsjagd um die halbe Welt bildet die treibende Kraft der Haupthandlung. Hierbei erhält sowohl Karlis aktivistische Motivation als auch das Image des „All-American“ Superhelden eine globale Dimension. Diese erzeugt ein zunehmendes Spannungsfeld mit den Interessen der US-Regierung, was zu einer eindrucksvollen Entladung in der letzten Episode führt.
Trotz ein paar kleiner Schnitzer in der Nachbearbeitung, ist die Serie alles in allem ein visueller Genuss. Besonders gelungen ist die fiktionale Gangstermetropole Madripoor inszeniert, Schauplatz der dritten Episode. Düstere, qualmige Gassen treffen auf grelles Neonlicht und beschwören die Ästhetik früherer Sci-Fi Klassiker wie Blade Runner (1982) oder der zeitgenössischen John Wick Filmreihe (2014–2019). Eine spannende Kampfchoreographie unterstreicht den letzteren Eindruck und ist wohl der Zusammenarbeit mit Derek Kolstad zuzuschreiben — seines Zeichens Drehbuchautor der John Wick Filme.
Der Nebenhandlung gebührt außerdem ein besonderes Augenmerk. Sie besteht aus zwei Handlungssträngen: der des Falcons Sam und der des Winter Soldiers Bucky. Beide überschneiden sich gelegentlich thematisch – beispielsweise im Familienmotiv –, gehen aber ihren eigenen Schwerpunkten nach. Bucky beschäftigt sich mit Schuld und auf verschiedene Weise damit, sie zu begleichen. Dieser Handlungsstrang setzt nicht nur etwas MCU-Hintergrundwissen voraus, er bringt darüber hinaus einige doch recht obskure Nebencharaktere zurück ins Spiel. Es ist schwer, solcher Art von Fanservice ihren Platz in einer Marvel Produktion abzusprechen. Jedoch drängen sich einige dieser Charaktere zu häufig und teils taktlos in den Vordergrund, was sogar die Wirkung der Serienklimax untergräbt.
Selbiges gilt im Übrigen auch für die Kampfeinlagen. So perfekt wie sie in einigen Folgen zum Gesamtbild beitragen, so fehl am Platz wirken sie gegen Ende der Serie. Es scheint als wäre hier eine actionorientierte Marvel-Formel mit den Bedürfnissen des Drehbuchs kollidiert, erneut zum Leidwesen des Serienfinales.
Dagegen stellt sich der Handlungsstrang um Sam Wilson als das Herzstück der gesamten Serie heraus. Sam hat, anders als die meisten seiner Superheldenkollegen, keine Superkräfte. Er muss also erheblich mehr Zeit in die Vorbereitung jedes einzelnen Einsatzes investieren. Zusätzlich ist er der einzige dunkelhäutige Superheld, dessen Gesicht nicht verdeckt ist, weshalb er sich umso mehr unter Druck setzt. Sam möchte der Öffentlichkeit ein möglichst positives Bild des afro-amerikanischen Superhelden vermitteln, ein Bestreben, das ihn lange Zeit von seiner Familie getrennt hat. Jetzt will auch er – ähnlich wie Bucky – Wiedergutmachung leisten. Er möchte seiner Schwester helfen, das Erbe ihres Vaters, ein altes Boot, wieder seetüchtig zu machen. Im Laufe dieser Handlung werden systemische, sowie soziale Ungerechtigkeit und der Umgang mit dem Erbe afro-amerikanischer Geschichte behandelt.
Besonders hervorzuheben sind hierbei Sams Besuche bei Isaiah Bradley, einem alten Mann, der sich als erster „Super Soldier“ (noch vor Steve Rodgers) entpuppt. Die US-Regierung hatte Isaiah und eine Gruppe anderer afro-amerikanischer Soldaten in den 50ern gegen ihren Willen mit Prototypen eines „Super Serums“ injiziert. Die gewonnenen „Erkenntnisse“ sollten zur Entstehung von Captain America dienen. Isaiah überlebte als Einziger und wurde unter weiteren Experimenten und Folter für 30 Jahre heimlich weggesperrt und seiner Identität beraubt. So adaptiert Spellman, selbst afro-amerikanischer Abstammung, auf gelungene Art und Weise den Marvel Comic Truth: Red, White & Black (2003) von Robert Morales und Kyle Baker. Jedoch besteht hier darüber hinaus ein offensichtlicher Bezug zu inzwischen öffentlich gemachten Experimenten im Auftrag der US-Regierung an Schwarzen Soldaten und Zivilisten — etwa Versuche zur Auswirkung von Senfgas im Zweiten Weltkrieg. Spellman eröffnet also auch einen Diskurs darüber, was es heißt, als Schwarzer Mann die Farben der USA zu tragen, ob auf dem Ärmel oder auf dem Schild.

Zieht man Resümee, so leidet das Herz von The Falcon and the Winter Soldier häufig am Korsett einer actionorientierten Genremischung. Die einzelnen Teile greifen zwar oft genug ineinander, stolpern schließlich aber doch etwas unbeholfen übereinander. Das gibt nicht nur Abzüge in der sprichwörtlichen B‑Note, sondern wird einer durchaus sehenswerten Geschichte um den Falcon Sam Wilson nicht gerecht. Trotzdem kommt man nicht umhin, Spellmans Drehbuch besonders dafür zu loben, dass es seine Chance wahrgenommen hat; eine goldene Gelegenheit, einen im öffentlichen Diskurs unterbeleuchteten Teil der US-Geschichte in das schwer übersehbare Flutlicht der MCU-Scheinwerfer und somit in den Mainstream zu rücken.