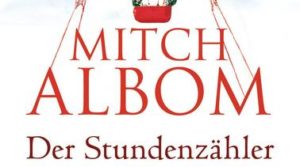von Leo Blumenschein
„Drink Sangria in the park,
And then later
„When it gets dark we go home“
Die Gegenwart ist an ihren Enden seltsam ausgefranst. Es ist so, als ob von hinten – vorausgesetzt der räumliche Begriff „hinten“ ist überhaupt anwendbar, Fäden des Vergangenen sich an manchen Punkten unangemessen weit ins Jetzt erstrecken, während alles Zukünftige ebenso bereits im Jetzt angelegt zu sein scheint. Meine eigene Kindheit erscheint mir genauso wenig ein „versunkenes Reich“ zu sein, wie mir die Zukunft als Rätsel erscheint. Manchmal lichten sich die Hindernisse, die mir sonst den Blick in meine eigene Zukunft verstellen, und ich kann alles klar und deutlich sehen. Was ich dann sehe, macht mir überwiegend Angst. Ich sehe einen grauen Linoleumboden, auf dem ein Stück Tomate verfault und einen vollen Aschenbecher, aus dem es melancholisch nachraucht und weiterraucht und sich unter der Decke kleine Wolken bilden, die nicht wissen wohin sie sollen, keinen Ausweg sehen, und deshalb einfach dort bleiben wo sie sind. Ich sehe mich einfach dort geblieben, wo ich jetzt bin. Ich schließe die Augen und streiche mit meinen Händen über die Grasfläche. Die Spitzen der Grashalme an meinen Handflächen halten mich im Jetzt. Ich schließe meine Hand zu einer Faust, um mich fester in der Gegenwart festzukrallen. Überall können sich Schluchten auftun. Ein unüberlegter Schritt und man fällt kilometertief in die Vergangenheit oder noch tiefer – in die Zukunft. Permanent muss man sich mit kleinen Schritten im Jetzt bewegen, dabei immer bedacht sein, sich nicht von der Stelle zu bewegen. Nur kreisrunde Tanzbewegungen zulassen, und niemals in Bewegung geraten. Vielleicht ist es das, was Hegel eigentlich sagen wollte, wenn er die Zeit als zyklisch beschreibt. Möglicherweise kann ich ihm dann verzeihen, dass er mein Leben ruiniert hat.
Bis dahin muss ich auf der Wiese liegen und nachdenken. Ich denke, dass ich einmal auf einer Wiese lag und mich im Gras festgekrallt habe, weil ich Angst hatte aus der Gegenwart zu fallen. Aber das ist erst so kurz her, dass es möglicherweise noch jetzt ist, noch andauert. Meine Hand liegt noch da, und ich liege noch da, in Grün und Jetzt gebettet; das eine spürend unter mir, das andere ahnend und doch immer ein Stück entrückt. Noch auf dem Rasen, irgendwann dann drunter, dazwischen hineinbeißend.
Ich öffne die Augen und erhebe mich von der Rasenfläche. Es scheint mir als wolle mich irgendetwas zurückziehen, als wären mein Rücken und das Gras magnetisch. Der Eiswagen und die spielenden Kinder, die Bäume am Rand meines Sichtfeldes. Alles wirkt so inszeniert und betont zeitlos. Ich sage einem vorbeirennenden Kind, dass es sterben wird. Es umklammert mein Bein und wir beginnen beide hemmungslos zu weinen. Wir liegen einfach da, und weinen und weinen für Stunden, aber vielleicht liegen wir auch nur eine Sekunde da. Ich weiß es nicht. Wer einmal die Zeit anzweifelt, muss mit den fürchterlichsten Konsequenzen leben.
Martin und Ich sitzen auf einer Bank vor seiner Hütte in Todtnauberg. Er hat den Arm um mich gelegt und es ist die erste Morgenstunde nach einer langen Party. ER erklärt mir was die Zeit sei, und mein Sein ausmacht. Zum ersten mal verstehe ich alles. Irgendwann kommt Hannah Arendt dazu und setzt sich zwischen uns. Wir knutschen zu dritt rum.
In Rilkes Malte gibt es eine Figur, die die verbleibende Lebenszeit wie einen Geldschatz ansieht, der einem nach und nach vor den Augen gestohlen wird. Er fühlt sich hilflos und wird verrückt. Ich kann das sehr gut nachvollziehen.
Als ich die Augen, ist der weinende Junge schon längst weg. Es ist dunkel und ich liege allein auf der Wiese. Der Himmel ist von einem oliv-dunklem Lila und ich höre das leise Flüstern zwischen ihm und der Erde. Sie wissen nicht, dass ich sie belausche und lästern auf einer fremd klingenden Sprache über die Menschen. Ich bin an jenem Punkt des Tages, an dem die Dinge und ihre Schatten nicht mehr zu unterscheiden sind. Die Grashalme und ihre Schatten wechseln die Rollen. Mal ist das Abbild das Ding und mal scheint das Ding nur ein Abbild zu sein. Manchmal denke ich, dass der Schatten die weiche Grenze zwischen Objekt und Nicht-Mehr-Objekt-begründet. Und die Zwischenzone, die entsteht, soll meine Zone sein: so wie ich immer in allen Zwischenzonen wohne (und nur da). Es ist primitiv, aber möglich, das Jetzt als solch eine Zwischenzone zu verstehen. Auch hier wohne ich (und nur da).
Auf dem Nachhauseweg flashen mich die Mücken, die sich im Schein der Straßenlaternen versammeln. Manche von ihnen fliegen direkt in die Lampe, wo sie verglühen. Ich lag doch eben auf einer Wiese und habe mich im Gras festgehalten, weil ich Angst hatte aus der Gegenwart zu fallen – oder war das schon vor Tagen? Vielleicht war es auch morgen. Ich frage mich, was die Suizidalen Mücken wohl für morgen geplant haben. Wahrscheinlich genauso wenig wie alle anderen Mücken.
Schattenreiche berühren mich mit langen Fingern, die mir langsam und wollüstig den Mund aufbiegen, um mir tief in meinem Körper zu fassen und mit festem Druck meine Organe abzutasten. Kann ich den Druck standhalten oder werde ich vom Etwas-Mehr-Als-Nichts zerdrückt, unbemerkt an irgendeiner Laterne stehend, vielleicht genau hier und vielleicht schon vor langer Zeit, während einfach alles weitergeht. („Die Geschichtenerzähler machen weiter, die Autoindustrie macht weiter, die Arbeiter machen weiter, die Regierungen machen weiter, die Rock’n Roll-Sänger machen weiter, die Preise machen weiter, das Papier macht weiter, die Tiere und Bäume machen weiter, Tag und Nacht macht weiter“)
„Just a perfect day
you made me forget myself
I thought I was
Someone else, someone good“