Der Umgang mit Namen in einer kulturell heterogenen Gesellschaft
Ein Essay von Johannes Queck
Störende Sonderzeichen
Als Saša Stanišić 2019 den Deutschen Buchpreis erhielt, machte die Tagesschau in der entsprechenden Meldung kurzerhand ein Sasa Stanisic daraus (vgl. Und raus bist du!, in: taz.de, 15.10.2019). Diese Nonchalance gegenüber dem Namen einer öffentlichen Person ist für die wichtigste deutsche Nachrichtensendung ungewöhnlich, zumal es hier um den Gewinner des wichtigsten deutschen Literaturpreises ging. Indes ist dieser Vorfall nur ein Beispiel für die tägliche Praxis im Umgang mit Namen in der deutschen Gesellschaft, die auf die immer noch tief verwurzelte Ungleichbehandlung von Sprachen, Kulturen und letztlich auch Menschen verweist.
Persönliche Identität
Ein Name ist mit der durch ihn bezeichneten Person eng verwoben. Nübling, Fahlbusch und Heuser schreiben in ihrer Einführung in die Onomastik, dass Namen dem Menschen “[…] wie eine Erkennungsmarke anhängen und ihn für alle anderen identifizier‑, individualisier- und sozial zuordenbar machen.” Zusammengefasst: “Der Name steht für den Menschen.” (Nübling / Fahlbusch / Heuser 2015, 12) Ein Name ist im alltäglichen sozialen Kontext das wichtigste individualisierende Merkmal eines Menschen, das ihm anhaftet und untrennbar zu ihm gehört, wie ein Etikett oder Aushängeschild. Wenn der gleiche Name nicht nur eine, sondern zwei oder sogar mehrere Personen bezeichnet, wie das im deutschen Sprachraum bei Namen wie Josef Müller tausendfach der Fall ist, ist das eine Ausnahme, die die Regel bestätigt: erstens wird die Namensgleichheit nur dann relevant, wenn die gleich benannten Personen überhaupt in den gleichen sozialen Kontexten auftreten, denn nur dann existieren in diesen Kontexten zwei Josef Müller. Zweitens wird in einem solchen Fall schnell eine neue individuelle Benennung gesucht, dann wird aus dem einen Josef beispielsweise ein Sepp oder er wird bei seinem Nachnamen gerufen. Es gibt also das Bestreben, eine Person mit einem Namen zu verknüpfen, was die enge Verbindung von Individuum und Eigenname unterstreicht. Der Name ist, wie Goethe in Dichtung und Wahrheit formuliert, „[…] wie die Haut selbst [dem Menschen] über und über angewachsen, an der man nicht schaben und schinden darf, ohne ihn selbst zu verletzen.” (Trunz 1955, 406).
Ein Mensch besitzt also eine enge Bindung an seinen Namen, und zwar in seiner visuellen und phonetischen Dimension: der eigene (Ruf-)Name ist oft eines der ersten Worte, auf das Säuglinge reagieren, das erste Wort, das Kinder schreiben können. Wird der Name verändert, verboten, verunstaltet, ist davon auch der Mensch betroffen. Dass ein Name wichtig für die persönliche Identität ist, wird auch daran ersichtlich, wie oft Namen geändert werden, Pseudonyme entstehen oder Spitznamen geprägt werden. Dies ist ein Ausdruck des Wunsches, einen Namen zu tragen, der zum eigenen Selbstbild passt — wobei in verschiedenen Lebensbereichen unterschiedliche Selbstbilder zum Tragen kommen und auch verschiedene Namen nach sich ziehen können (z.B. Autorenpseudonyme).
Kulturelle Bedeutung
Ein Name hat allerdings nicht nur diesen identitätsbildenden, sondern natürlich auch sprachliche und kulturelle Aspekte. Denn wenn er auch keine Semantik in dem Sinne besitzt, dass man davon ganz bestimmte Eigenschaften ableiten könnte, so ist ein Name natürlich dennoch hochgradig mit Bedeutung aufgeladen. Zum Beispiel kann die Etymologie des Namens sehr wohl einen semantischen Aspekt aufgreifen, der dann in Wechselwirkung mit der jeweiligen Person steht (was freilich nur bei einer entsprechenden Sprachkenntnis möglich ist). Vor allem aber stehen Namen immer in einer kulturellen und sprachlichen Tradition und verorten das Individuum für die anderen dementsprechend.
Soziale Dimension und Macht
Desweiteren haben Namen wichtige soziale Ordnungsfunktionen, die sie auch mit Macht und Herrschaft verbinden. Fixierte Personennamen und damit identifizierbare Untertanen waren eine der Voraussetzungen des modernen Verwaltungsstaats. Neben der Identifikationsmöglichkeit bietet der Name auch die Möglichkeit zur Markierung von kultureller und sozialer Zugehörigkeit, die sich am deutlichsten in den Nach- bzw. Familiennamen ausdrückt. Dass Namen auch explizit dem Zweck der Ausgrenzung dienen können, zeigen die Zwangsnamen, die Juden im Nationalsozialismus annehmen mussten, um eindeutig als Juden erkennbar zu sein. Auch der Kolonialismus führte zu einer Benennung der Kolonisierten nach fremden Schemata, wobei diese ihrer eigenen kulturellen Tradition zwar entrissen wurden, in den Gesellschaften der Kolonisator:innen durch „exotische“ Namen aber immer noch als fremd markiert blieben.
Von diesen Beobachtungen, der existentiellen Bedeutung des Namens für den Menschen und seinem hohen Symbolgehalt sowie der Verbindung von Namen, Benennung und Macht ausgehend, möchte ich nun zum Ausgangspunkt zurückkehren und den Umgang mit Namen in einer kulturell heterogenen Gesellschaft wie der deutschen genauer betrachten. Dass sich diese Heterogenität auch in den Namen widerspiegelt, denen wir tagtäglich begegnen, erachte ich als unstrittig. Dass wir auf ganz bestimmte Weisen mit diesen Namen umgehen, die viel über die Gesellschaft, ihre Vorurteile und Hierarchien aussagen, erscheint mir jedoch weniger selbstverständlich.
Name und Diskriminierung
Da ein Name in kulturelle Zusammenhänge eingebettet ist, sagt er in der Wahrnehmung der Mitmenschen vermeintlich eben doch viel über einen Menschen aus, auch wenn er im Grunde genommen nur ein Platzhalter ist. Mit den Nachnamen Kowalczyk oder Hawsawi hat man es bekanntermaßen deutlich schwerer, eine Mietwohnung zu finden als mit dem Namen Schmidt. Vermieter:innen verbinden mit ersteren Namen Personen mit Migrationsgeschichte und leiten daraus ein niedrigeres Einkommen und damit geringere Sicherheit, vielleicht auch Kommunikationsprobleme durch eine unterstellte ungenügende Beherrschung der deutschen Sprache ab und sortieren in der Folge diese Personen oft bereits in der ersten Vorauswahl nur aufgrund ihres Namens aus.
Ungleichwertigkeit der Namen
Was allerdings für die gewählten Namen – einen osteuropäischen und einen arabischen – gilt, trifft nicht auf alle Namen zu, die nicht als deutsch interpretiert werden. Eine Frau mit dem Namen Delacroix, und damit vermeintlich westeuropäischen Ursprungs, würde beispielsweise nicht den gleichen Vorurteilen begegnen müssen. Ein solcher Name kann in dieser Hinsicht sogar einen positiven Effekt haben, da er sich zwar ebenfalls von den anderen Namen abhebt, aber tendenziell eher positive Assoziationen weckt. Diese Hierarchie von Namen gründet auf einer Hierarchie von Kulturen und Sprachen, die schon vielfach thematisiert wurde und ihre Wurzel ihrerseits in einem Gemisch aus soziokulturellen Faktoren und tradierten Stereotypen hat. Während es zum Beispiel als erstrebenswert gilt, neben Deutsch mit Französisch, Englisch, Spanisch oder einer anderen “sexy Expat-Sprache” (Stokowski 2018) aufzuwachsen, wird es von vielen immer noch als Makel gesehen, wenn zuhause beispielsweise Russisch oder Farsi gesprochen wird. Es gilt hier, was Kübra Gümüşay zugespitzt für die türkische Sprache festgestellt hat: “Türkisch lernt man nicht, Türkisch verlernt man.” (Gümüşay 2010)
Dieses Prestige von Kulturen und Sprachen spiegelt sich in der Art und Weise, in der man ihren Namen begegnet. Die Bemühung, einen Namen richtig, das heißt so wie der:die Namensträger:in es tut bzw. möchte, auszusprechen oder zu schreiben, ist bei Sprachen, die “man lernt”, die also als wertvoll und bereichernd angesehen werden, weitaus häufiger anzutreffen als bei solchen, die eher als Anhängsel oder gar Ballast empfunden werden. Dabei muss betont werden: Dass jemand die Aussprachekonventionen von zig Sprachen parat hat, kann niemand erwarten. Indes ist die richtige Aussprache eines Namens in Zeiten des Internets zumindest bei Personen des öffentlichen Lebens nur eine Google-Suche weit entfernt. Der Missstand besteht darin, dass die Motivation, diese Recherche auf sich zu nehmen, offenbar davon abhängt, auf welche Sprache und Kultur der Name verweist. Einen französischen Namen sollte man richtig aussprechen, um nicht als ungebildet zu gelten; bei einem arabischen oder türkischen Namen herrscht die Einstellung vor, dass ja niemand von einem erwarten könne, einen solchen Namen richtig auszusprechen. Oft geht diese Einstellung mit einer geradezu vorwurfsvollen Attitüde gegenüber dem:der Namensträger:in ob dieser unerhörten phonetischen Herausforderung einher.
Fehlende Kultursensibilität
Auf eine etwas andere Art und Weise wird die Problematik in folgendem Beispiel (entnommen aus Handschuck / Schröer 2011) sichtbar: Der kurdische Name Alixan wird von einer Lehrerin kurzerhand als Ali abgekürzt, um die Diskrepanz zwischen der üblichen Buchstaben-Laut-Zuordnung des Deutschen und der des fremden Namens (“Alichan” statt “Aliksan”) aufzulösen und es den anderen Kindern (und sich selbst) damit leichter zu machen. Eine absichtliche Kränkung des kurdischen Jungen durch die Benennung mit einem türkischen Namen wird man der Lehrerin wahrscheinlich nicht vorwerfen können, zumal der Junge diese Umbenennung auch gar nicht als problematisch ansieht. Der Konflikt entsteht erst durch das Eingreifen seiner Mutter, was auch ein Schlaglicht auf den Umstand wirft, dass Namen zwar in erster Linie, aber nicht nur für den:die Namensträger:in Bedeutung besitzen, sondern auch für nahestehende Menschen, insbesondere natürlich für Eltern, die den Namen ihres Kindes gewählt haben. Die vermutlich unbeabsichtigten Folgen gehen aber sehr wohl auf ein Fehlverhalten vonseiten der Lehrerin zurück, insofern sie die Änderung des Namens einer Person nach den eigenen Bedürfnissen als legitime Praxis voraussetzt. Diese stillschweigende Übernahme der Deutungsmacht geht eben auf die implizite Geringschätzung der fremden Kultur zurück, was besonders deutlich wird, wenn man sich einen ähnlichen Umgang mit als deutsch empfundenen Namen vorstellt; zum Beispiel eine Marianne konsequent Maria zu nennen. Das würde schon ohne kulturelle Problemstellungen als Affront empfunden.
Neue Maßstäbe
Entscheidend ist, dass Namen auf der einen Seite nicht als Grundlage des Urteils über eine Person taugen und auf der anderen Seite ein hochsensibler und bedeutsamer Bestandteil von Personen sind und auch so behandelt werden müssen. Kulturelle und sprachliche Unterschiede sind eine Tatsache, mit der man umgehen muss, aus Sicht des Individuums und aus Sicht der Gesellschaft. Übersetzungsleistungen (im kulturellen, nicht im semantischen Sinn) sind daher notwendig, zum Beispiel in Bezug auf das schon erwähnte Namensschema aus Vor- und Nachname(n) und schon allein im Hinblick auf unterschiedliche Schriftsysteme; natürlich müssen hier Transkriptionen helfen, es kann schließlich nicht erwartet werden, dass jede:r in Deutschland mit der arabischen, hebräischen, kyrillischen, äthiopischen und allen anderen Schriften hantieren kann, die durch Einwanderung Teil der deutschen Gesellschaft werden. Es darf jedoch nicht darum gehen, es der Mehrheitsgesellschaft möglichst einfach zu machen; die Übersetzung muss sich stattdessen maßgeblich an den Bedürfnissen der jeweiligen Individuen ausrichten, für das ihr Produkt eine existenzielle Bedeutung besitzt. Und natürlich gilt es, jeder Form der Diskriminierung des Namens und aufgrund des Namens entgegenzuwirken.
Nötig wäre ein kultursensibler Umgang mit heterogenen Namen, der sich an den Bedürfnissen und Wünschen der betroffenen Personen ausrichtet, nicht an den normativen Vorstellungen der Mehrheitsgesellschaft; auch und gerade vor dem Hintergrund der Tatsache, dass sich Machtstrukturen, wie oben gezeigt, durch den Umgang mit Namen manifestieren und verfestigen. Unter dem Paradigma der Übersetzung muss das richtige Maß zwischen Integration und Identität gefunden werden, das sich von Person zu Person unterscheiden kann. Vor allen Dingen muss der Stellenwert des eigenen Namens für die jeweilige Person anerkannt und ein entsprechend respektvoller Umgang damit als berechtigtes Interesse anerkannt werden. Für das übergeordnete Ziel einer diskriminierungsfreien Gesellschaft mögen die Sonderzeichen im Namen nur ein kleiner Baustein sein; egal sind sie aber nicht.
Quellen
Gümüşay, Kübra: Übersetzen nur im Hinterzimmer, in: taz.de, 31.08.2010, online unter: https://taz.de/!5136430/ (letzter Zugriff: 13.01.2022).
Handschuck, Sabine / Schröer, Hubertus: Eigennamen in der interkulturellen Verständigung. Handbuch für die Praxis, Augsburg 22011.
Nübling, Damaris / Fahlbusch, Fabian / Heuser, Rita: Namen. Eine Einführung in die Onomastik, Tübingen 22015.
Stokowski, Margarete: Gute Sprachen, schlechte Sprachen?, in: Spiegel Online, 27.11.2018, online unter: https://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/deutsch-tuerkisch-polnisch-gute-sprachen-schlechte-sprachen-kolumne-a-1240626.html (letzter Zugriff: 13.01.2022).
Trunz, Erich (Hrsg.): Goethes Werke. Hamburger Ausgabe in 14 Bänden. Band 9, Hamburg 1955.
Und raus bist du!, in: taz.de, 15.10.2019, online unter: https://taz.de/Saa-Staniic-und-die-Tagesschau/!5633947/ (letzter Zugriff: 13.01.2022).
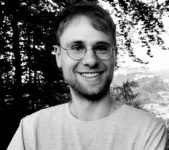
Johannes Queck, 1995 in Kronach geboren, studierte in Augsburg Europäische Kulturgeschichte, Geschichte und Anglistik. Nach dem Bachelor absolvierte er die Ausbildung für die 3. Qualifikationsebene im bayerischen wissenschaftlichen Bibliothekswesen und arbeitet seit seinem Abschluss in der Osteuropaabteilung der Bayerischen Staatsbibliothek. Parallel dazu studiert er Ethik der Textkulturen in Augsburg.








