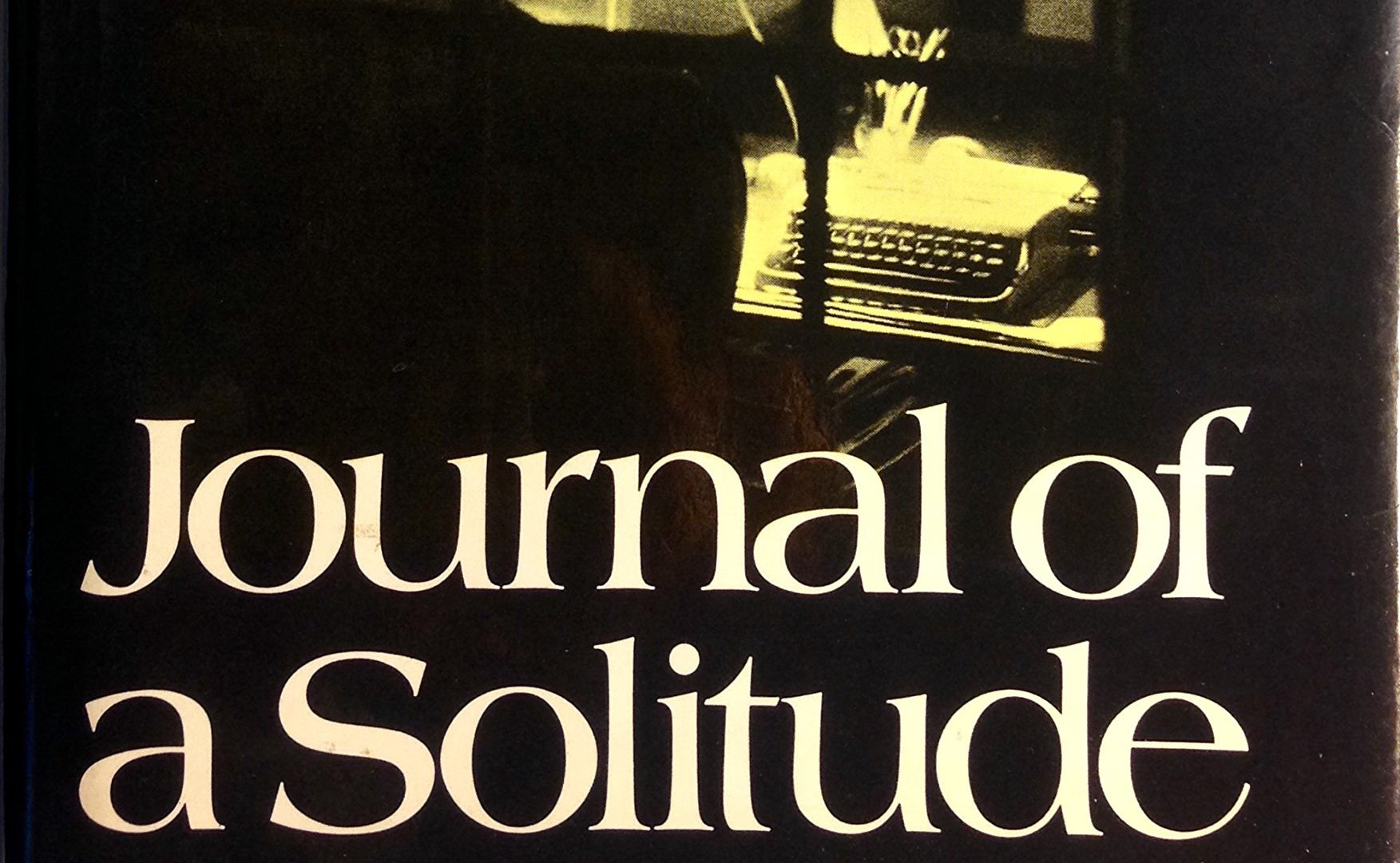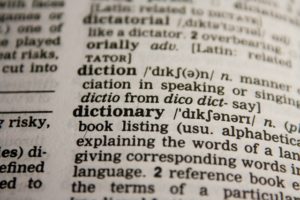Eine Literaturempfehlung von Katja Sarkowsy
Eigentlich wollte ich ja seit Beginn der Pandemie Thomas Manns Der Zauberberg endlich einmal wieder lesen; aber dazu kam bisher es nicht. Ich las in diesen Zeiten der Bewegungs- und Kontakteinschränkungen viele Neuerscheinungen, und einige davon haben mich nachhaltig beeindruckt – Anne Webers Annette, ein Heldinnenepos etwa, oder auch Alaa al-Aswanis Republik der Träumer.
Aber ich kehrte auch zu einem Buch zurück, das mich über die Jahre begleitet hat, das mir mal mehr, mal weniger wichtig, aber das immer da war und das ich jetzt noch einmal mit einem neuen Blick las: Journal of a Solitude der amerikanischen Autorin May Sarton. Auch wenn ich nicht allein lebe, bekam der Titel während des Lockdowns natürlich nochmal eine ganz eigene Bedeutung; er und das Genre schienen geradezu unheimlich passend zu einer Situation, in der wir zeitweise zu einem radikalen Innehalten gezwungen waren. Sarton verwebt in diesem 1973 erstmals erschienenen Klassiker der Tagebuchliteratur die Dokumentation ihres täglichen, oft quälenden und verzweifelten Ringens um das geschriebene Wort mit Erinnerungen an ihre langjährige Lebenspartnerin, politischen Kommentaren und feministischen Überlegungen, aber vor allem mit präzisen, oft zutiefst lyrischen Beschreibungen ihrer unmittelbaren Umgebung – des Wachsens und Vergehen der Pflanzen in ihrem Garten, dem Spiel des Lichts auf dem Schnee, des Blumenarrangements auf ihrem Schreibtisch. Es sind ihr abgeschiedenes Haus in Nelson, New Hampshire, und dessen Umgebung, die ihr die Metaphern für die Selbstbeobachtung bieten; so wird die hungernde Katze, die täglich um ihr Haus streift und die Sarton füttert, zum Anlass über solitude nachzudenken, jenseits des Austarierens von Alleinsein und Einsamkeit: „When I am talking about solitude I am really talking also about making space for that intense, hungry face at the window, starved cat, starved person. It is making space to be there.“ Die Abgeschiedenheit – oder die zeitweilige Möglichkeit dazu – wird zu einer Voraussetzung für wirkliche Begegnung. Und entgegen seinem Titel prägen Begegnungen das Journal, neue und erinnerte, in Person und in Briefen, in Lektüren und Gesprächen. Sarton macht den abgeschiedenen Ort zu einem Ort nicht nur des Auf-Sich-Geworfen-Seins, sondern auch der Begegnung und des Austauschs, oft entgegen ihrer selbsterklärten Anstrengung, die der Umgang mit anderen Menschen für sie zumeist darstellte. Es ist diese Evokation des Begegnungsraumes, mit sich selbst und mit anderen, eines Raumes, der immer wieder neu umrissen werden muss, der mich in dieser Neulektüre beschäftigte.
Hinzu kam die Geschichte meiner abgegriffenen Taschenbuchausgabe selbst, mit ihren Kaffeeflecken und eingerissenen Umschlagecken. Ich hatte das Buch vor Jahren in einem New Yorker Antiquariat gekauft. Meine Wieder-Lektüre verband sich mit dieser Erinnerung an eine Stadt, die zu Beginn der Pandemie deren Zentrum in den USA gewesen war. Auch wenn dies vielleicht paradox scheint, schuf diese Verbindung von Lektüre und Erinnerung in einer Zeit furchtbarer Nachrichten und fundamentaler Ungewissheit auch ein Gefühl von vorsichtiger Zuversicht.