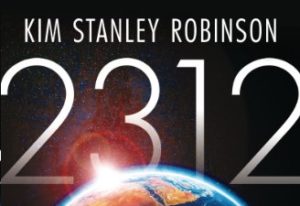Brotjob, Kraftbrot und Beharrlichkeit
von Lisa Krusche
Vor einem Jahr ist mein erster Roman erschienen und ich kapierte so langsam, dass mein Vater gerade dabei war sich zu Tode zu trinken. Ein Jahr wie ein Text in einer Fremdsprache. Ein Jahr wie: „Die Seele verwandelt sich in ein Gespenst und läuft ins Leere.“[i] Ein Jahr, durch das ein eisiger Wind wehte, der mir die Gänsehaut aufrieb und die Gedanken zerfranste. Ich wünschte, dieser Text wäre ein Fest. Eine Rückschau als Loblied, eine fulminante Erfolgsgeschichte. Ich bin durchwoben von einer nicht enden wollenden Sehnsucht nach Auflösung in Wohlgefallen und nichts lieber würde ich mir erfüllen als diese Sehnsucht, aber das hier ist nun mal einfach das Leben.
Am zehnten Mai fand die Buchpremiere statt, an einem Montag in Frankfurt. Es war eine dieser schmucklosen und weitestgehend deprimierenden Streamingpremieren, bei denen man sich bloß in sehr kleiner Runde zur Aufzeichnung des Streams trifft und niemand der Menschen anwesend ist, mit denen man die Entstehung und Veröffentlichung des Romans feiern möchte. Ich war aufgeregt, hatte Angst vor der Bühne. Meine Haare standen mir zu Berge, wirklich und metaphorisch gesprochen. Ich war außerdem sehr müde und sehr traurig. Die Traurigkeit lauerte dicht unter der Oberfläche und es war ziemlich mühsam, sie zurückzuhalten. Es gab Phở, aber ich habe nur zwei Löffel hinunterbekommen und mich stattdessen mit Cola aufgepäppelt. Was meine Standfestigkeit im letzten Jahr anbelangt, verdanke ich Cola sehr viel. Cola, Eiskaffee, dem Song Infinity von Olamide, der phasenweise die einzige Musik war, die ich überhaupt noch ertragen konnte und Proteinriegel der Geschmacksrichtung Cookie Dough.
Den Tag zuvor hatte ich gemeinsam mit meinen Freund*innen den Umzug meines Vaters gemacht, etwas, zu dem er selbst zu diesem Zeitpunkt nicht in der Lage gewesen war. Wir hatten seine Sachen in Kisten und Säcke gepackt, seine wenigen Möbel abgebaut und alles in die neue Wohnung gebracht, die wir ihm organisiert hatten. Wir holten in da raus. Aus diesem Ort, den er aus eigener Kraft nicht zu verlassen in der Lage war, der ihm nicht mehr gut tat und vice versa und der es ihm unmöglich machte, sich selbst gut zu tun. Wenn ich jetzt darüber schreibe, merke ich, wie vieles, was an diesem Tag passiert ist, von mir immer noch nicht aufgeschrieben werden kann. Weil es in einen Schmerz eingewoben ist, der es mir unmöglich macht, es sprachlich zu fassen zu kriegen, weil ich es vielleicht sprachlich zu fassen kriegen würde, aber noch nicht so weit bin, es zu veräußern, weil es meinen Vater betrifft und ich noch keine gute Balance gefunden habe, zwischen meinem darüber schreiben wollen und seinem Recht auf Privatsphäre. Wie Emmanuel Carrère ausführt: „Aber wenn man über andere schreibt, wechselt man unter Umständen auf die Seite der echten Folter, weil der, der schreibt, die absolute Macht hat, während der, über den geschrieben wird, dessen Willkür ausgeliefert ist.“[ii]
Was geschrieben werden kann: Ich wollte einfach nur in die Knie gehen, mir die Augen aus dem Kopf heulen, vierzehn Stunden schlafen und eine Notfallsitzung bei meiner Therapeutin abhalten. Die Verletzlichkeit und Verwundung eines Elternteils in dieser rohen Form mitzubekommen, hat ein Gefühlspotpourri übler Sorte in mir ausgelöst, und mich rückgekoppelt an das Kind, das ich einmal gewesen bin und in mir forttrage, und das den elterlichen Schmerz als allumfassend und unerträglich empfindet. Ich hatte nicht das engste, aufgeräumteste Verhältnis zu meinem Vater, das machte die Sache noch schwieriger. Andererseits erforderte die Situation ohnehin, unsere Beziehung on the go neu zu denken und zu entwerfen. Und das mit meiner ganzen Zurückhaltung, meiner Zaghaftigkeit, meinen ängstlichen Komplexen.
Ich bin eine große Herausforderung für mich selbst. Und wenn mir die Haare zu Berge stehen, bevor ich eine Bühne betrete, dann auch wegen dieser Eigenschaften. Ich war im letzten Jahr wirklich viel damit beschäftigt, mich sehr klein zu fühlen und mich gleichzeitig so groß zu machen, wie ich konnte. Ein Dauerspagat zwischen hartem Kerl und heulendem Hund. Sich zusammenreißen ist ein seltsames Wort; die Risse, die sich in einem aufgetan haben, mit den Fetzen ihrer Ränder mühsam überdecken. Auf den Bühnen und um sie herum, überspielte ich, was das Zeug hielt. Ein wohltuendes Ablenkungsmanöver, wenn es mir gelang, mich so in das Überspielen hineinfallen zu lassen, dass ich mir selbst glaubte; eine zehrende Kraftanstrengung, die mich zusehends zerschoss.
Wie viel Schmerz können und dürfen wir einander zumuten? Wo und wann und wie müssen wir einander Raum für unsere heulenden Hunde halten? Und wann ist es angemessen den Schmerz von anderen als Zumutung zu bewerten? Oder als aufmerksamkeitsheischend? Ist das überhaupt jemals angemessen? Was wissen wir schon über den Schmerz der anderen und steht es uns zu über dessen Inszenierung zu urteilen? Oder ist es im Gegenteil eben manchmal besonders angebracht, hier ganz präzise hinzuschauen? Ist es sinnvoll, Schmerz gegeneinander abzuwägen? Wie kann uns das helfen und wie sollen wir dabei vorgehen? Und zerschellen diese Skalen nicht spätestens im eigenen schmerzverzehrten Inneren, das sich durch die Erinnerung an den Schmerz der anderen auch nicht besser fühlt (und kann einen diese Perspektivierung wirklich trösten?)? Sind wir immer noch viel zu hart zueinander? Werten wir Härte insgeheim oder ganz offensichtlich immer noch als wahre Stärke?
Schreiben ist das eigene Leben betreffend immer auch ein seismographisches Verfahren und mich interessieren diese Interferenzen aus produktionsästhetischer Sicht sehr. Der kosmische Witz meines Jahres: dass ich ein Buch geschrieben hatte, in der eine der Protagonistinnen andauernd damit beschäftigt war, die elterlichen Probleme auszugleichen und für deren Humor, Trotz und offenherzige Power ich in meiner Situation einiges gegeben hätte. Gesprochen habe ich darüber nicht. Ich sprach über meine Literatur als könne man sie steril aus dem Leben schneiden. Ich fasste meine eigenen Texte nur mit spitzen Fingern an. Vielleicht fehlte mir noch die Distanz zu den Vorkommnissen. Vielleicht hielt mich die Befürchtung zurück, Rezipient*innen könnten beginnen, den Text ausschließlich autobiographisch zu lesen und ich selbst, indem ich diese Sehnsucht nach einer autobiographischen Auflösung bediene, zu dieser unterkomplexen Lesart beitragen. Vielleicht ist es ein Merkmal dieser Art von Veranstaltungen, dass man nicht für sich, sondern für das Publikum spricht. Vielleicht performte ich auch einfach wie der Feigling, der ich bin.
Es gibt diese Sätze von Senthuran Varatharajah: […] „fragte ich mich, ob die Dinge vielleicht anders liegen, anders, als wir anzunehmen, und vielleicht auch zu glauben bereit sind: dass nicht unser Unbewusstes, wie Lacan mit Verweis auf Lévi-Strauss sagt, wie eine Sprache strukturiert sei, sondern, ob nicht vielleicht unsere Sprache unser Unbewusstes ist. Was ist, wenn unsere Sprache das trägt, was wir nicht ertragen können? Was ist, wenn sie das sagt, was wir nicht sagen dürfen?“[iii] Ich hatte geschrieben, um den Verstrickungen des Sprechens zu entkommen, nur um dann wieder, so scheint es mir, mit der gleichen Zurückhaltung, der gleichen Angst, den gleichen Täuschungsmanövern über das Geschriebene zu sprechen, die ich darin zumindest teilweise überwunden glaubte. Ich weiß nicht, ob es mir je möglich sein wird, einen Modus des Sprechens zu finden, der sich traut, Unsicherheiten, offene Fragestellungen, Brüche, innere Anliegen, Zweifel usw. offenzulegen und zur Diskussion zu stellen. Vielleicht eines Tages, wenn ich mich von all diesen Bildern lösen kann, die ich davon habe, wie über Literatur zu sprechen sei, und ich endlich nicht mehr klug oder cool wirken will.
Ich bin alles andere als cool[iv]. Ich bin ein emotionales Nervenbündel, ein anfälliges Sensibelchen mit einem Körper, der was Gefühle angeht, ein Verräterschwein ist. Mein gesamtes Nervensystem überakzentuiert meine Emotionen. Ich bekomme Magenbeschwerden, mir klappern die Zähne, ich beginne zu zittern und zu schwitzen, meine Haut ist von roten Flecken übersät und meine Atmung wird flach und kurz. Es fühlt sich dann schnell so an, als gäbe es keinen Winkel mehr in meinem Körper, der mir Halt und Ruhe bietet, und gleichzeitig bin ich doch zu mehr in der Lage, als mich diese psychosomatische Symptomatik glauben lassen will. Ich kann ein harter Kerl sein und damit meine ich, dass ich den Mut aufbringen kann, trotzdem zu agieren.
Es kann produktiv sein, die Grenzen der eigenen Ängste zu überschreiten, genauso wie es destruktiv sein kann. An diesem Montag meiner Buchpremiere hätte es mir sicher auch gutgetan, alles abzusagen und im Bett liegen zu bleiben, oder aber es wäre mir dann noch schlechter gegangen, weil ich etwas verpasst hätte, was mir trotz aller digitaler Tristesse wichtig war. Abgesehen davon, war es auch schlicht mein Job, mit dem ich mein Geld verdienen musste. Nach der Premiere war ich noch zu einem Videointerview verabredet, wir fuhren durch Frankfurt, aßen Pommes, ich saß in einer holzvertäfelten Zimmerecke, schaute auf einen Pfennigbaum und sprach über das Schreiben. Wenn ich mir das Video heute angucke, finde ich, dass ich müde aussehe, aber auch konzentriert und fröhlich und irritiert und verschmitzt. Im Hotel schlief ich ausgesprochen schlecht. Nach dem Aufwachen erhielt ich einen Anruf, weil mein Vater nicht zu einem vereinbarten Arzttermin erschienen war, trotz starker körperlicher Beschwerden. Heute, ein Jahr später, habe ich mehr Erfahrung und ein anderes Wissen, ich könnte solchen Situationen mit mehr Ruhe begegnen, aber damals hatte ich das ganze Ausmaß des Zustandes meines Vaters noch gar nicht begriffen, geschweige denn, wie damit umzugehen war, ich begann gerade erst zu verstehen. Ich telefonierte herum, ohne etwas zu erreichen. Mein Nervensystem schlug wilde Purzelbäume. Ich verließ das Hotel ohne Frühstück und ging zum Hauptbahnhof. Bei Starbucks bestellte ich mir einen Iced Coffee und in dem Moment, in dem mir die Frau hinter dem Tresen den durchsichtigen Becher in die Hand drückte, konnten meine Augen nicht mehr dichthalten.
Was ich den Tag zuvor mühsam unter einer dünnhäutigen Schicht zurückgehalten hatte, haute mich um. Leere Flaschen in Kommoden, tote Zähne im Regal. Mein Blick durch den Türspalt, der wacklige Mann, der mal mein Vater war, auf der Bettkante sitzend, der Kopf in den Händen. Der Lebensabgrund, in den ich durch diesen Türspalt hinabblickte.
Der Kaffeecup in der shaky Hand, die Tränen ein Eiswürfelklirren des Körpers, neun Uhr sechs, Gleis neun, schoss ich ein Selfie. Man sieht mein Gesicht mit schwarzer Maske, die Haare zu einem hohen Zopf gebunden, der auf der rechten Seite des Gesichts hinunterfällt, die Stirn in zarte Falten gelegt, die linke Augenbraue ein bisschen tiefer als die rechte, die Pupillen klein in dunklen Augen, Tränen am unteren Wimpernkranz. Anders als in dem Video vom Tag zuvor sehe ich nur noch traurig und besorgt aus.
Im Zug heulte ich weiter. Ein Mann schaute über die FAZ in seinen Händen zu mir. A. rief an: die Schatten in seiner Lunge seien Metastasen. Man will das alles nicht und es gehört zum Menschsein dazu. Unsere allumfassende Verletzlichkeit, das große Sterben, die ewige Frechheit. Ich jaulte quer durch das Abteil. Draußen Deutschland. Zuhause legte ich eine kurze Pause ein, duschte, schminkte mich, bewunderte, was Concealer bewirken kann und nahm an einer Onlinelesung teil, las, sprach mit den anderen teilnehmenden Schriftstellerinnen und dem Moderator über unsere Bücher, und verfolgte den nicht endenden wollenden Fluss der Kommentare im Livechat.
So wie diese drei Tage, Sonntag, Montag, Dienstag, war mein ganzes Jahr: ein Herumspringen zwischen Kontexten und Milieus und Gefühlszuständen, ich war ausgelaugt und aufgewirbelt, schockiert und staunend, auf hundertachtzig und unter null und Literatur war bei all dem mein anstrengender Brotjob und mein wundersames Kraftbrot gleichzeitig.
Wieso schoss ich, während ich heulend am Gleis stand, ein Selfie? Genau kann ich das heute nicht mehr sagen. Ich weiß nicht mehr, was ich dachte, als ich das Selfie aufgenommen habe. Ich habe einige Thesen, sie lauten: Alles ist eine Contentmaschine, auch die Trauer. Ablenkungsmanöver und Distanzierungsversuch. Selbstvergewisserung. Ein Versprechen, das bessere Tage kommen würden, und ich auf den Schmerz zurückschauen könnte, den ich überwunden hatte. Vielleicht hatte ich mir vorgestellt, wie ich in der Zukunft diesen alten Mythos der großen Erleichterung erzählen würde. Man kann sagen, dass das ein wenig peinlich und ziemlich naiv ist. Dass ich da wohl reingefallen bin auf diese neoliberale Heldengeschichte, die überall lauert, von klassischen Erzählungen, über Reality-TV-Formate bis hin zu esoterisch durchwirkten Influencer*innenmindsets a la „alles was einem widerfährt hat einen Grund“. Man könnte auch wohlwollender und milder sein und in dieser Selbsterzählung, die sich dem Glauben an ein Happy End verpflichtet fühlt, an den linearen Fortschritt, der nicht müde wird, ein glorioses Morgen zu behaupten, die nachvollziehbare Sehnsucht erkennen, mit dem, was aus einem geworden ist, ausradieren zu können, was einem widerfahren war. Das kann etwas Tröstliches haben, kann Hoffnung schaffen und in manchem Moment ist eben jede Form der Hoffnung hilfreich, sei sie noch so sehr von Wachstumsmindsets durchwoben und letztendlich nichts anderes als eine Illusion.
Denn das ist diese Erzählung, ein untaugliches Märchen, dass durch behauptete Kausalitäten verdecken soll, dass Schmerz Schmerz bleibt, egal, was folgt, und dass das Leben ein großes, dreckiges Chaos ist. Es ist so: Es gibt kleine Erleichterungen, es gibt Liebe und Freude, und es gibt Rückfälle und neue Abgründe und ehe man sich versieht, steht man am nächsten Gleis und heult sich wieder die Augen aus dem Kopf.
Das Selfie hat sich bis in die Gegenwart hineinverlängert, statt als ihr Gegenbild zu dienen. Meine Gedanken sind eine ongoing construction site und es gibt Schmerzspuren, die nicht zu verwischen sind. Die zerfurchteste und deutlichste unter ihnen ist die Angst vor der Verwundbarkeit der anderen. Ich fing sie mir im Sommer ein. Im Freibad, Kyra mit Pommes auf der Decke, ich das Telefon am Ohr in der Warteschleife der Krankenkasse, des Arbeitsamtes, des Krankenhauses. Ich fiel zusehendes in mich zusammen. Kyra hatte eine Pommes neben mich gehalten, sie war größer als ich, am anderen Ende der Leitung hatten sie mir trotzdem gesagt: Der Mann, der mal dein Vater war, hat vielleicht schlimme Auflösungserscheinungen, aber damit er von uns die Hilfe bekommt, um die du bittest, musst du dich kleiner machen.
Wohnt denn kein heulender Hund in euch drin?
An die Leine gelegt
Abgeknallt
Ganz einfach
Boom boom
tot
Aber seid ihr noch nie in einen Abgrund gefallen?
So etwas kann uns nicht passieren, vor uns tun sich keine Abgründe auf.
Und wenn doch?
Wer in einen Abgrund fällt, das können wir mit Gewissheit sagen, hat ihn selbst gegraben
In jeder Notlage begreift man, welchen Illusionen man bisher aufgesessen ist, welche Wahrheiten man sich zu ignorieren glücklich schätzen durfte und sollte man sich doch schon mit ihnen befasst haben, wechselt man vom Abstrakten ins Konkrete des Betroffenseins und das ist ein himmelweiter Unterschied. Mich verstörte die Überheblichkeit mancher, die ich um Auskunft und Hilfe bat. Die Kälte, Ignoranz und Ablehnung. Sie gaben mir sehr deutlich zu spüren, was sie von mir und meinem Vater hielten. Das ist nicht die Schuld dieser Menschen allein. Ihr Verhalten ist verankert in einem System, das Profit über das Menschenwohl stellt, dass manchen Menschen mehr Würde zugesteht als anderen, manche Leben als schützenswerter betrachtet und das Armut immer bestraft. Das manchen erfolgreich vorgaukelt, sie selbst seien davor gefeit, in irgendeine Art menschliche Notlage zu geraten, und sie so zu ausführenden Lakaien seiner Menschenverachtung macht. Aber niemand ist sicher vor dem Schicksal und das System wird nicht zurückschrecken, die eigenen Vertreter*innen zu fressen. Die Auflösungserscheinungen können uns alle treffen; nicht nur als Individuen, auch als Gesellschaften. „Wenn die Möglichkeit besteht, dass die Ereignisse zusammenbrechen, dann ist es eine Möglichkeit, mit der wir alle leben. Wir sind vertraut mit dem Gedanken, dass wir als menschliche Wesen von Natur aus verletzlich sind: durch Verwundungen, Krankheiten, das Altern, den Tod – und allerlei Kränkungen aus unserer Umgebung. Aber die Verletzlichkeit, mit der wir es hier zu tun haben, ist von einer anderen Art. Wir scheinen sie dadurch zu erwerben, dass wir an einer bestimmten Lebensweise teilhaben. […] Doch unsere Lebensweise – worin auch immer sie bestehen mag – ist auf viele Arten verletzlich. Und uns, als Teilnehmenden an jener Lebensweise, wird dadurch ebenfalls Verletzlichkeit zuteil.“[v]
Die matschigen Pommes im Mund und den Ohrwurm irgendeines entstellten Klassikers im Ohr, presste sich ein Ohnmachtsgefühl kalt zwischen mich und den Sommertag. Es hat sich ein Grauen in mir eingenistet, das nicht müde wird, mir in plastischen Horrorszenarien auszumalen, wie sich vor allen, die ich gerne habe, der Boden auftun wird. Dieser broken gaze auf die Welt zeigt mir nur noch die Verletzungen auf, die Sollbruchstellen, die Traurigkeit, die unlösbar scheinenden Verstrickungen.
Der heulende Hund sagt zu mir: wenn man Arsch ist, ist man noch mehr am Arsch, das sind die Regeln der Strukturen und Verhältnisse. Und natürlich hat er recht. Ich gehe in den Wald und zähle die Bäume. Ich weiß, ich werde nicht genug Holz haben, um alle Abgründe abzudecken. Der heulende Hund zählt mir meine Unzulänglichkeiten auf: Zu wenig Wissen, zu wenig Kontakte, zu unbedeutend, zu wenig Einfluss, zu arm, viel zu arm. Das alles auf diesem verwundeten Planeten, in dieser gewaltvollen Welt, vor dem Panorama unserer Unmenschlichkeit.
Katherina May schreibt in Überwintern: „Jeder durchlebt irgendwann mal einen Winter. Und bei manchen kehrt er immer wieder. Winter ist nicht einfach nur eine karge Jahreszeit. Auch im Leben kann es Phasen geben, die sich wie Winter anfühlen. Karge Phasen, in denen man sich ausgesondert, ausgeschlossen und ausgebremst fühlt, in eine Außenseiterrolle gedrängt. Das kann die Folge einer Erkrankung sein oder eines Lebensereignisses wie zum Beispiel des Verlustes eines geliebten Menschen oder der Geburt eines Kindes; aber auch das einer Demütigung oder eines Scheiterns. Man kann sich in einem Umbruch befinden und vorübergehend zwischen zwei Welten schweben. […] Doch ganz gleich, wie sanft oder unsanft der Winter sich auf uns legt: in der Regel haben wir nicht darum gebeten, und er ist mit dem Gefühl von Einsamkeit und großem Schmerz verbunden.“[vi]
Im Herbst begann der Winter seinen Tribut zu fordern. Die Erschöpfungsanzeichen mehrten sich. Der harte Kerl hatte sich mit eingeklemmtem Schwanz in die Untiefen verzogen. Der heulende Hund hatte die Worte gefressen. In der Veräußerung war mir der Zugang zur Innerlichkeit entglitten. Mein Körper war taub geworden, mein Atem endete knapp zwischen meinen Brüsten und die Worte hatten mich aufgegeben. Ich fühlte mich bis zur Unkenntlichkeit müde und fragte mich gleichzeitig, womit ich mir diese Müdigkeit erlauben durfte. Dieses Gefühl wurzelt in einer in mich hineinindoktrinierten leistungsorientierten Anspruchshaltung genauso wie in dem Gedanken, es gehe mir doch trotz allem in Relation zu anderen immer noch sehr gut, was wahr ist, aber die Erschöpfung auch nicht verschwinden lässt. Heike Geißler schreibt: „Meine Empfindlichkeit ist keine Schwachstelle. Man kann sich mit einer Anspielung darauf nicht über mich erheben.“[vii] Immer wieder stelle ich fest wie nötig ich diese Worte habe, dass ich sie mir am besten selbst aufsagen sollte, als Erinnerung, als Bitte an mich selbst
Ich fühle mich immer noch, als sei ich grundlegend durcheinandergeraten, eine verwachsene Version des Bildes. Trotzdem bin ich das Gefühl nicht losgeworden, über dieses Selfie schreiben zu müssen, geschrieben haben zu müssen. Wie eine Wahnvorstellung: du musst dich offenlegen, du musst die Bilder geraderücken, du musst von diesem Bild sprechen so wie man ein magisches Ritual ausführt. Es gibt eine Stelle bei Marcus Steinweg, in der er Beckett zitiert, der über das Schreiben sagt: „[…] weil es die einzige Möglichkeit ist, es auf diesem Scheißplaneten aushalten.“[viii] Dieser Scheißplanet kann wirklich am wenigstens etwas dafür, aber alles andere ist wahr. Und Steinweg schreibt in Weiterführung zu Beckett: „Schreiben ist ein Existenzakt, dessen Unabschließbarkeit des Lebens im Modus des Weiterlebens bezeugt. Immer wieder dieses Weiter. Nichts legitimiert das Schreiben als das Schreiben selbst. […] So lange leben heißt, weiterzuleben, sein Leben zu überleben, bedeutet Schreiben, auf der Fortsetzung der Schreibbewegung zu beharren.“[ix] Vielleicht war ich an diesem Morgen in Frankfurt, durchgeschüttelt von meiner verzweifelten Traurigkeit, auch viel weiser, als ich es mir im Nachhinein zugestehen will. Vielleicht hatte ich intuitiv begriffen, dass es mir die Sprache verschlagen und dass dieser Zustand lange andauern würde, und hatte gleichzeitig Vertrauen in meine eigene Beharrlichkeit. Und so habe ich mir dieses Selfie hingeworfen wie einen Köder. Das Leben übersteigt, das Leben überschlägt mich und ich stelle immer noch an meinen zehn Fingern meine Milchmädchenrechnungen auf. Ich übe mich in Beharrlichkeit und halte mich an Wunder – und hier, mittendrin in diesem großen, dreckigen Chaos, unter diesem pfirsichfarbenen Himmel, ist das alles, was mir möglich ist und doch wirklich eine ganze Menge.
[i] Adnan, Etel: Nacht. Hamburg 2016, S.65
[ii] Carrère, Emmanuel: Yoga. Berlin 2022, S.180
[iii] https://www.praeposition.com/text/vorzeichen/14-senthuran-varatharajah
[iv] Im Wortsinn von „[stets] die Ruhe bewahrend, keine Angst habend, nicht nervös [werdend], sich nicht aus der Fassung bringen lassend; kühl und lässig, gelassen“
[v] Lear, Jonathan: Radikale Hoffnung. Ethik im Angesicht kultureller Zerstörung. Berlin 2020, S. 26
[vi] May, Katherina: Überwintern. Wenn das Leben innehält. Berlin 2021, S.21
[vii] Geißler, Heike: Die Woche. Berlin 2022, S.126
[viii] Steinweg, Marcus: Metaphysik der Leere. Berlin 2020, S.38
[ix] Ebd.

Lisa Krusche, *1990, lebt als freie Schriftstellerin in Braunschweig. Sie studierte Kunstwissenschaften und Literarisches Schreiben. 2021 erschienen ihr Debütroman “Unsere anarchistischen Herzen” bei S.Fischer und das Kinderbuch “Das Universum ist verdammt groß und super mystisch” bei Beltz. Für ihre Arbeiten erhielt sie verschiedene Preise und Stipendien, darunter der Edit Radio Essaypreis 2019, der Deutschlandfunk-Preis bei den 44.Tagen der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt und das Kranichsteiner Kinderbuchstipendium 2022.