© Robert Sakowski
von Roman Matzke
„Das habe ich selten, dass ich da noch so jemanden vor mir habe,“ freut sich Wolfgang M. Schmitt, als wir feststellen, dass beide unserer Zoom-Kacheln von Büchern dominiert sind. Augen scannen rasch die Wand des anderen und schon ist das Eis gebrochen. Im Laufe des Interviews stoßen wir immer wieder auf diese gemeinsame Leidenschaft, die heutzutage keine Selbstverständlichkeit mehr ist; eine im Journalismus tätige Freundin von Herrn Schmitt sei so beispielsweise in ihrer Redaktion als „die, die noch liest“ bekannt.
Wer regelmäßig bei der Filmanalyse vorbeischaut, weiß, dass Herr Schmitt mit Büchern nicht erst seit gestern hantiert. Immer wieder werden auf ein Neues überraschende Werke integriert, die auf den ersten Blick nicht viel mit dem besprochenen Film zu tun zu haben scheinen.
Das folgende Interview versucht, dem Ursprung dieses breiten Nachschlagewerkes nachzugehen und beleuchtet so gleichzeitig die damit einhergehende Studienzeit Wolfgang M. Schmitts. Warum entschied sich der Filmkritiker gegen ein Filmstudium? Welche Bücher beeinflussten ihn am meisten? Ging er regelmäßig ins Unikino? Und konnte man den Herrn im Anzug auch mal auf einer Studentenparty erspähen?
Antworten darauf – und noch viel, viel mehr – gibt es hier im XXL-Format. Auf einen steifen Fragenkatalog wurde, so weit möglich, verzichtet. Ein Rückblick auf den gelungenen Kulturabend vom 26. Oktober bringt den Dialog ins Rollen. Viel Vergnügen!
RM: Für viele Besucher Ihres Kulturabends an der Uni Augsburg war Sherlock Jr. der erste Schwarz-Weiß Film. Auch in Düsseldorf diente der Film bereits dazu, um Ihr gerade veröffentlichtes Buch, Die Filmanalyse: Kino anders gedacht, vorzustellen. Wieso fiel die Entscheidung gerade auf diesen Buster Keaton Klassiker?
WMS: Ich bin, wie jeder Cineast, auch ein Buster Keaton Fan. Dass ich diesen Film ausgewählt habe, lag daran, dass ich überlegte: ‚welcher Film liefert Unterhaltung — liefert das, was man von Hollywood gewohnt ist — und präsentiert zugleich eine Filmphilosophie, an die ich dann mit meinen Worten anknüpfen kann?‘ Wenn man diese Bedingungen haben möchte, dann fallen einem doch nicht allzu viele Werke ein, die dem gerecht werden.
Zudem geht es mir schon darum, einmal zu zeigen, was es bedeutet, sich mit der Filmgeschichte zu konfrontieren. Nämlich haben wir zwar eine Zeit, die von Retromanie geprägt ist, in dem Sinne, dass die 80er Jahre in der Popkultur permanent reproduziert und recylced werden, zugleich aber erleben wir eine extreme Geschichtslosigkeit. Die großen Werke der Filmgeschichte sind nicht bekannt. Das heißt, der heutige Kinogänger erlebt bei jedem Filmerlebnis immer Tag 1, weil er das Gestern und Vorgestern nicht kennt, und kann deshalb auch das Aktuelle nicht in die Filmgeschichte einordnen, beziehungsweise lässt sich von Produkten affizieren, die von minderer Qualität sind.
Diese mindere Qualität wird einem aber erst ersichtlich, wenn man die großen Werke der Vergangenheit kennt. Und deswegen ist es mir hin und wieder auch ein Anliegen, zu zeigen, wie reichhaltig die Filmgeschichte ist und dass ältere Filme wegen ihres Alters nicht automatisch weniger fortschrittlich sind als aktuelle. Denn wir haben durch den sehr technizistischen Blick auf Film — mit den Special Effects, 3D Technik und CGI — eine Tendenz, dass wir das, was ein bisschen älter ist, abwerten, weil es noch nicht die technische Qualität von heute hat.
Das stimmt auch, wenn man sich CGI Produktionen von vor zehn oder zwanzig Jahren ansieht — denken wir auch an diese neuere Star Wars Trilogie von George Lucas: Das ist ja nicht auszuhalten, sich das anzusehen; es war damals schon schlimm, aber heute völlig unerträglich -, aber dennoch gibt es in der Kunst keine Fortschritte, in dem Sinne, dass man sagen kann, ‚Schiller ist fortschrittlicher als Corneille‘. Genau so ist auch Christopher Nolan nicht fortschrittlicher als Buster Keaton. Sondern die Kunst drückt sich nur immer wieder auf neue Weise aus; und um das Neue aber zu erkennen, muss man um das Alte wissen.
RM: Der Irrglaube, nur das Neuestes sei sehenswert, versperrt in der Tat zahlreiche Türen zu qualitativ hochwertigstem Kino. Wenn wir gerade beim goldenen Zeitalter der Stummfilm Komödie sind, muss man sagen, dass Namen wie Harold Lloyd heutzutage außerhalb des Cineasten-Kreises keiner mehr kennt. Sehen Sie in Ihrem Kanal eine Chance, dem Publikum diese Seite des Kinos schmackhaft zu machen?
WMS: An einem Abend wie in Augsburg fungiere ich gewissermaßen als entrébillet zur Filmgeschichte. Dadurch, dass ich dort bin, sind dann Leute auch bereit, sich einem Stummfilm auszusetzen. Das würden sie vielleicht ohne diese Rahmung, dass ich dort einen Vortrag halte, nicht machen. Diese Funktion erfülle ich gerne auch hin und wieder auf meinem Kanal, jedoch ist bei der Filmanalyse schon das Anliegen in erster Linie, aktuelle Filme — und damit auch aktuelle gesellschaftliche Diskurse — ideologiekritisch zu analysieren.
Es ist kein Kanal, der primär darauf aus ist, die Cinephilie zu fördern. Wenn das zugleich auch stattfindet, umso besser. Aber ich versuche hier nicht, Filmgeschichte vorzuschreiben oder Filmgeschichte wach zu halten. Hin und wieder muss das aber sein; und dann ist mir das ein Anliegen.
Ich kann auch sagen, es hat seine Grenzen mit der Wirkung meiner Person. Ich weiß schon, dass wenn ich ältere Filme auf meinem Kanal vorstelle, die jetzt nicht zu den Kultfilmen zählen, sondern filmgeschichtlich relevant sind, dass diese Analysen deutlich weniger Klicks haben als aktuelle Videos zu Marvel und DC-Filmen. Nun bin ich nicht klickgetrieben, da das für mich nicht das primäre Einkommen ist, aber ich muss schon auch sehen, dass ich nicht irgendwann einen Kanal gänzlich mit dem Rücken zum Publikum mache, oder nur für wenige Filmliebhaber. Ich glaube, es ist so eine Mischung, die man anbieten kann.
Für mich ist es vor allem in der Live-Situation gut, über alte Filme zu sprechen, wenn sie dann auch gezeigt werden. Denn das Problem ist auch, wenn ich dann beispielsweise eine Filmanalyse zu Bergmans Wilde Erdbeeren veröffentliche, dass ein Publikum da ist, das – weil Filmgeschichte so wenig präsent ist — den Film zum größten Teil noch nie gesehen hat, also erst einmal zum Film gehen muss und dann zurück zu meiner Filmanalyse. Das ist mitunter viel verlangt. Auch gerade in sehr schnelllebigen Zeiten, in denen man rasch weiterwischt. Von daher ist das bei solchen Live-Veranstaltungen, von denen ich auch Lust habe, mehr zu machen, wesentlich einfacher, weil wir uns dort gemeinschaftlich einen Film ansehen – etwas, das leider so selten erlebt wird.
Man hat ja in Deutschland kaum Kinematheken. Das heißt, die Filmgeschichte ist, bis auf wenige Orte, wie Museen, nicht gemeinschaftlich erfahrbar. Streaming oder DVDs sind sehr einsame Beschäftigungen. Dass das so wenig institutionalisiert ist, sorgt auch dafür, dass die Filmgeschichte so wenig präsent ist in den Köpfen. Mein Wunsch wäre ja, dass man eine Art Stadttheater-Struktur hat, wo der Kanon aufgeführt wird — von Opern, Balletten und Schauspiel; dass man eine ähnliche Struktur auch hat mit Kinematheken, wo jede Woche täglich Filmklassiker oder aktuelle, relevante künstlich anspruchsvolle Filme zu sehen sind. Das könnte man zu einem geringen Preis anbieten, würde damit den privaten Kinos nichts wegnehmen, sondern würde eigentlich sagen, ‚hier gibt’s die Filmgeschichte/Filmkunst und in den anderen Kinos gibt es das Aktuelle und Populäre‘ und hätte damit eine ganz andere Ausgangslage. Denn wenn Menschen sehen, wie reichhaltig die Filmgeschichte ist und man nicht im Doomscrolling versacken muss und sich auch nicht die nächste generische Netflix-Serie reinziehen muss, dann bekommt man einen anderen Blick auf die Dinge. Das wäre ein großes Anliegen von mir, aber alleine werde ich das Ruder nicht rumreißen können.
RM: Auch wenn so ein Vorhaben zunächst schwierig erscheinen mag, halten Sie eine Umsetzung für möglich? Wo befinden sich die größten Hürden?
WMS: Es ist relativ leicht zu realisieren. Wir haben gerade in den größeren Städten mit über 100.000 Einwohnern den Fall, dass zwischen 20–30% Gewerbefläche leer stehen. Und das wird sich auch aufgrund einer neuen Homeoffice-Struktur nicht maßgeblich ändern. Orte sind also zu finden, in denen man sehr einfach eine Bestuhlung installieren könnte und eine entsprechende Technik — eine Blackbox könnte man herstellen, in der beispielsweise 150 Menschen Platz finden. Man müsste dann jemanden haben, der es leitet und müsste nur dies finanzieren, während man bei Stadttheatern ganze Ensembles (sehr aufwändige Strukturen) finanzieren muss.
Was ich sehr gut fände wäre also, staatliche Kinos und Kinematheken zu betreiben. Finanziell wäre das gar kein Problem. Wir haben ja — viele haben es vielleicht vergessen — eine Kulturministerin. Claudia Roth heißt sie. Das wäre ja ein Anliegen, aber es scheint, dass deren Anliegen es ist, merkwürdige Roben auf dem roten Teppich in Berlin bei der Berlinale zu präsentieren. Aber von Film, Filmgeschichte und Ästhetik ist diese Person ja nicht gerade durchdrungen — um es höflich auszudrücken.
Insofern wäre es eher eine Sache der einzelnen Städte. Auf den Bund zu hoffen, ist völlig unsinnig. Die Ampelregierung ist so kunstfern, dass man es kaum in Worte fassen kann. Aber möglicherweise gibt es doch in einzelnen Städten kluge Bürgermeister und Stadträte, die erkennen, was man eigentlich mit wenig Geld schaffen könnte.
Da könnte man dann ja auch über Vernetzungen nachdenken, dass dort auch Regisseure Filme präsentieren. Ich würde es dennoch nicht als Event aufziehen, sondern wie ein klassisches Schwimmbad, das nur zum Schwimmen da ist — dass man sagt, hier gibt es zwei Mal am Tag relevante Filme für wenig Geld. Dort würde sich dann schon auch ein Publikum bilden, vor allem, wenn man beispielsweise eine Bar hätte, ein Glas trinken und ins Gespräch kommen könnte. Communities könnten sich so bilden.
Das alles halte ich für absolut möglich und es würde sehr wenig Geld kosten. Orte wären da und es wäre keine Konkurrenz für existierende Kinos, da man ja ein völlig anderes Programm zeigen würde. Man würde ein Publikum heranziehen, das auch zu viel mehr Experimenten bereit ist und — und das ist gerade wichtig — den Kinogang ritualisiert. Wie also Menschen drei Mal die Woche ins Fitnesscenter gehen, so muss auch wieder ritualisiert werden, dass man einmal die Woche ins Kino geht. Mal wird man ins moderne Kino, mal in die Kinemathek gehen. Wenn man sich ansieht, wie selten die Deutschen im Durchschnitt ins Kino gehen — das ist ja etwa 1,5‑mal pro Jahr. Das ist dann Barbie und dann noch der halbe Oppenheimer Film.
RM: Der Erfolg dieser beiden Filme war wirklich gigantisch. Nur konnte aus diesem Ein-Mal-Event leider keine Routine entstehen. Ob das in Zukunft wohl mit neuen Blockbustern funktionieren könnte?
WMS: Ich hatte so gehofft, dass daraus wieder eine neue Lust am Kino entsteht, aber wie das oft bei solchen Hypes ist: man konzentriert sich nur auf das eine und schaut nicht nach links oder rechts.
Vielleicht kann man das vergleichen mit dem, was wir in der klassischen Musik immer wieder festgestellt haben. Dort gibt es alle paar Jahre irgendwelche Stars, die plötzlich über das normale Klassik-Publikum hinaus Popularität erlangen und dann große Arenen füllen — denken wir beispielsweise auch an die drei Tenöre José Carreras, Plácido Domingo und Luciano Pavarotti. Die machen dann bunte Klassikabende mit der Argumentation ‚gut, ist doch schön, dann kommen sehr viele Leute zum ersten Mal in Berührung mit klassischer Musik, die sonst nicht in die Oper gehen würden; daraus wird dann folgen, dass sie sich auch mal in ihrem Stadttheater die nächste Opernproduktion ansehen‘. Genau das passiert jedoch nicht. Sie nehmen dieses einmalige Event als einmaliges Event wahr. Ich glaube im Übrigen auch, dass ähnliches bei den Museumsnächten passiert. Ich bin nicht gegen solche Events, ich glaube nur nicht an die Wirksamkeit.
Ähnlich werden wir beim Kino sehen, wenn wieder so ein großer Hype produziert wird. Den halte ich durchaus für möglich, und es ist zu hoffen, dass so etwas wieder passieren wird. Aber es bleibt bei dieser Einmaligkeit. Das ist für die Kinos auch extrem wichtig, da diese sich so über das Jahr retten können, aber was eigentlich sinnvoller wäre, wäre, dass man mehr Menschen herausbildet, die alle zwei Wochen irgendeinen Film im Kino ansehen. Das würde nicht nur die Kinos retten, sondern auch die Filmkultur in Deutschland radikal verändern.

RM: Selbst bemühten Filmfans macht es Deutschland schwer, jede Woche einen Film im Kino zu sehen. Man denke da nur an die zahlreichen ländlichen Kinos, in denen das Programm voll und ganz auf Kinder ausgelegt ist.
WMS: Nun gibt’s ja andere Möglichkeiten, Filme zu sehen. Ich würde sagen, für Leute, die sich für die Filmgeschichte interessieren, war es noch nie so leicht, diese zu rezipieren. Früher musste man ja schauen, ob ein Film vielleicht mal im Fernsehen kommt, den man dann aufnehmen könnte. Heute ist fast alles zugänglich, aber es wird trotzdem nicht gesehen.
Streamingdienste wie Netflix sind nicht an der Filmgeschichte interessiert und haben diese auch kaum im Portfolio. Man kann die Filme zwar über andere Anbieter sehen, aber das wird nicht gemacht. Das lässt uns vielleicht auch diese Legende vom Long Tail Business in Frage stellen — ein Buch, das vor einigen Jahren von Chris Anderson geschrieben wurde. In diesem sagt er, dass im Zeitalter der Null-Grenzkosten, wo also die Distribution von Musik, Filmen, etc., ganz einfach und billig ist, ein sehr langer Schwanz entstehen wird; das heißt, dort werden die Produkte, die früher in einem Gatekeeper-System, was sehr viel stärker auf Konsens ausgelegt sein musste, keine Chance hatten, jetzt ihre jeweiligen Abnehmer finden. Nischen werden so extrem florieren. Was wir aber erleben ist, dass es zwar kulturell diese Ausdifferenzierung mit wahnsinnig tollen Nischenfilmen gibt, aber denen geht es ökonomisch nicht gut. Bei der Musik kann man das sehr gut sehen: da gilt das Matthäus-Prinzip: Wer hat, dem wird gegeben. Dort konzentriert sich die Aufmerksamkeit auf wenige Stars, ganz oben dann Taylor Swift. Ähnliches können wir beim Film beobachten. Es wird viel Interessantes produziert, aber es gibt kaum ein Publikum dafür.
RM: Das stimmt. All diese wunderbaren Filme warten darauf, Aufmerksamkeit zu bekommen – das heißt, richtig ‚gelesen‘ zu werden. Die Universität ist eigentlich der Ort, um das zu lernen. Es ist erstaunlich, wie häufig Chantal Ackermanns Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles seit dem Aufstieg zu Platz 1 der Sight & Sound Liste als Lehrmaterial verwendet wird. Da kommt mir die Sorge, dass Studenten danach mit ‚Arthouse‘ Kino nichts mehr zu tun haben möchten.
WMS: Ich bin gar nicht gegen das Populäre, das auch seinen Platz im Seminar haben sollte; ich bin auch dagegen, dass man das sogenannte Arthouse Kino grundsätzlich als großartig empfindet und je langsamer der Film erzählt ist, desto besser soll er sein. Ichverachte diese Art der Filmrezeption.
Gerade habe ich wieder eine leidvolle Erfahrung gemacht und sehnte mich eigentlich danach, jetzt einen Marvel Film zu sehen, weil es da wenigstens ein wenig frischer zugeht. Ich habe mir Anatomie eines Falls — der Film, der in Cannes gewonnen hat — angesehen, mit Sandra Hüller, die wie immer großartig war. Es ist ein unsagbar zähes Stück Kino. Mal wieder ist nicht klar, warum Cannes solch einen Film bepreist. Ich habe entsetzlich gelitten.
Das ist glaube ich schon so, dass man seelisch und physisch viel stärker leidet, wenn diese künstlich anspruchsvoll sein wollenden Filme nicht gut sind, als in einem nicht gelungenen Unterhaltungsfilm. Und dieser Schmerz, der einem da angetan wird, der hält einen mitunter dann auch ab, den nächsten Film zu sehen, der aber möglicherweise gut sein könnte.
RM: Haben Sie Jeanne Dielman denn in voller Länge (3h 22min) gesehen?
WMS: Nein. Nicht alles, was unkonventionell ist, ist gleichzeitig auch gut. Im Gegenteil, ich würde sagen, das Unkonventionelle muss sich hier ganz besonders unter Beweis stellen. Warum verlässt man die Konvention? Nur dann, wenn man glaubt, mit anderen Mitteln etwas Relevantes erzählen zu können. Aber nur eine Konfusion beim Betrachter zu hinterlassen oder ihn aus der Komfortzone gelockt zu haben, das reicht nicht aus. Das ist so ein Schlagwort: ‚wir müssen die Leute aus der Komfortzone holen‘. Ich bin sehr dafür; aber dann muss man außerhalb dieser Komfortzone auch irgendetwas Interessantes und Relevantes anbieten. Nur Peitschenschläge abzubekommen, genügt mir nicht. So masochistisch bin ich nicht veranlagt.
RM: Neben diesen ‚Peitschenschlägen-Filmen‘ sehe ich unter dem sogenannten ‚anspruchsvollen‘ Kino eine zweite Kategorie, die dem Publikum den Weg zu einem breiten Filmgeschmack erschwert: der Film mit der ‚wichtigen‘, aber offensichtlichen Lehre. 12 Years a Slave beispielsweise, der immer und immer wieder in Schulen gezeigt wird. Ich meine, Sie teilen meine negative Wertung dieses Films?
WMS: Der Schulunterricht kennt vorwiegend das Zeigefingerkino; und 12 Years a Slave ist solch eines. Die Botschaft des Films ist keine, die als Prozess entsteht, sondern die Botschaft ist von vorneherein klar und schon ohne Ansehen des Films absolut akzeptiert bei denen, die den Film gleich sehen werden. Damit hat man sich einmal im Kreis gedreht, aber sich großem Leid ausgesetzt.
Ich glaube, dieser Film hat eine doppelte Funktion. Einmal bestätigt er, was man ohnehin schon weiß oder begriffen haben sollte: Rassismus und Sklaverei sind schlecht. Das ermöglicht einem, jegliches Denken zu unterlassen, weil man da ja nicht dialektisch rangehen kann — das ist so unhinterfragbar und glasklar, dass man nur nickend dies rezipieren kann.
Aber dadurch, dass es so anstrengend ist, sich diese im Film dargestellte rassistische Gewalt anzusehen, hat man selbst als Zuschauer ein bisschen nachgespürt, wie es ist, wenn man rassistisch benachteiligt und misshandelt wird. So hat man seine Abreibung bekommen und geht dann (scheinbar) geläutert aus dem Saal heraus. In Wahrheit aber hat man sich die ganze Zeit etwas vorgemacht.
Deswegen sind solche Filme in besonderer Weise zu verachten. Wenn ein Film einen nicht mehr zum Denken bringt, sondern nur das bestätigt, was ohnehin schon da ist und dann noch die Erleichterung erschafft, dass man auf der guten Seite steht, dann läuft da sehr viel schief.
RM: Nach all diesen Schulfilmen empfand ich die Literatur als eine wahre Erlösung, denn hier ist eine ganz andere, weniger gelenkte Form des Denkens viel leichter zu erreichen.
WMS: Die Literatur hat generell etwas abstrakteres. Das ist jetzt eine Banalität, aber: durch die Buchstaben. Das heißt, wir müssen die Bilder erst entstehen lassen. Es ist viel unmittelbarer, Film zu sehen. Deswegen muss man eigentlich Filme sehen lernen — man muss begreifen, wie Bilder aufgebaut sind, welche Wirkung sie haben, welche Manipulationskraft -, aber de facto können wir Bilder sofort rezipieren.
Neil Postman hat völlig recht, wenn er mit dem Fernsehen das Verschwinden der Kindheit assoziiert, weil er sagt, einen pornografischen (oder gewalttätigen) Roman wird man erst ab einem gewissen Alter auch als solchen rezipieren können. Bei Bildern ist das völlig anders — die wirken sofort.
Das ist ein Grund, warum es diesen Unterschied gibt; und zugleich ist 12 Years a Slave und diese Art von Filmproduktion typisch für die Ideologie unserer Zeit, wo wir unglaublich darin baden, das Leid zu zeigen und nicht in einen Reflexions- oder Analysemodus übergehen. Die ganze Zeit wird nur gesagt, wie schlimm diese Bilder sind, wie schockierend. Wir sind inzwischen so weit, dass in Nachrichtensendungen Reporter aus Krisengebieten zunächst nach ihren Gefühlen gefragt werden. Sie sollen artikulieren, was ihre persönlichen Gefühle sind, um nicht ins Denken zu gelangen. Für mich ist 12 Years a Slave der Film zu den populären Nachrichtenformaten.
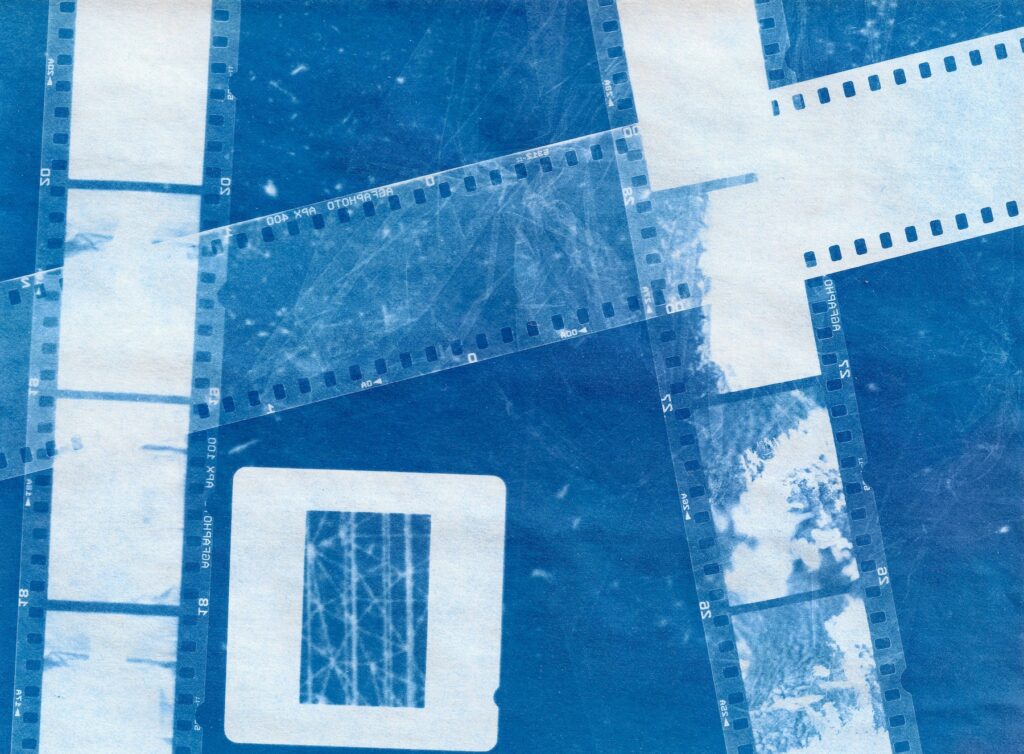
RM: Mit Neil Postman sind wir nun zum zweiten Mal bei der Feststellung, dass man dem heutigen Filmkonsumenten kein Vorwissen abverlangt: Nachrichten sollen ohne jegliches Vorwissen verstanden und Kinofilme ohne Filmgeschichtskenntnis und Fachkompetenz konsumiert werden. Hat sich Ihr Gemüt eigentlich schon in jungen Jahren gegen diese Rezeption gewehrt? Wollten Sie schon mit zwölf bei Hitchcock mehr sehen, oder kam das erst im Studienalter?
WMS: Es war von Anfang an da, dass ich fasziniert war und mir diese Filme wieder und wieder angesehen habe. Und das nicht aus einem reinen Unterhaltungswert heraus, sondern ich wollte verstehen, was mich dort eigentlich fasziniert. Zugleich habe ich mich dann intensiv mit Literatur beschäftigt, vor allem mit deutschsprachiger Literatur. Es lief aber noch sehr stark getrennt voneinander — also die Beschäftigung mit Film und die Beschäftigung mit Literatur.
Nach dem Abitur hatte ich ein halbes Jahr Zeit, bis mein Studium begonnen hat, und im Gegensatz zu den meisten meiner Mitschüler bin ich nicht verreist, sondern ging ins Theater und ins Kino. Und zwar täglich! Dadurch ist schon viel mehr im Kopf zusammengewachsen, was diese Künste betrifft. Im Studium habe ich mich dann für ein Studium der Germanistik, Philosophie und der Kunstgeschichte entschieden — bewusst nicht Film -, weil ich mir sagte, wenn ich doch nur gründlich Germanistik und Kunstgeschichte studiere, werden mir alle Instrumente mitgegeben, um auch bewegte Bilder, in denen Sprache vorkommt, zu analysieren.
Dann war der Film während des Studiums weiterhin präsent, aber vor allem war er auch eine Sache, die ich nicht machen musste für mein Studium. Man macht ja immer die Dinge am allerliebsten, die man nicht machen muss, und so war dann meine Obsession ins Kino zu gehen besonders groß. Das heißt, ich ging bestimmt drei oder vier Mal die Woche in Trier ins Kino und habe mir alles angesehen, was mir nur einigermaßen als guckbar erschien.
Da habe ich mir aber auch gleich immer gesagt, dass ich das nicht überführen muss ins wissenschaftliche Schreiben. Das heißt, ich habe nicht daran gedacht, meine Abschlussarbeit über Film zu schreiben. Man muss sich das auch so vorstellen, dass ich zwar in einer WG gelebt habe und auch gut sozialisiert (also nicht völlig alleine) war, dass ich aber doch in der Regel die Abende allein verbracht habe, indem ich entweder gelesen habe oder ins Kino gegangen bin. Das war schon sehr solitär. Ich glaube die Studentenpartys, die ich besucht habe, während meines doch recht langen Studiums, kann ich an einer Hand abzählen.
RM: Hat man eine Studentenparty gesehen, kennt man sie im Prinzip alle.
WMS: Mir scheint das so. Ich weiß auch nicht, was ich auf solchen Partys machen soll. Ich kann mich gut mit Menschen unterhalten, aber wenn es dort laut ist, dann ist das für mich nicht möglich. Mir ist das Partyleben an sich ein großes Rätsel. Ich habe — und das ist jetzt sehr böse — den Eindruck, dass alle Menschen dort unglücklich sind, aber in einem stillen Abkommen miteinander beschlossen haben, sich einzureden, dass sie glücklich sind. Ich bin aber vorher nicht informiert worden, über diese Verabredung, weswegen ich unglücklich dabeistehe.
RM: Sich zwischen einem gut geschriebenen Buch und Smalltalk mit angetrunkenen Kommilitonen zu entscheiden, ist nach ein wenig Party-Erfahrung ein Leichtes.
WMS: Das ist ja auch das große Leid, das die Kunst bei einem produziert. Man kommt irgendwann an den Punkt, an dem man immer vor der Wahl steht, ob man sich einer Konversation geschrieben von Flaubert (bzw. Ingmar Bergman) oder dem Geplänkel einer Party aussetzt. Und dann gewinnt meistens Flaubert.
RM: Mal abgesehen von solchen oberflächlichen Gruppenveranstaltungen ist das Studium doch ein prima Zeitraum, um bedeutsame Gespräche mit Gleichgesinnten zu führen.
WMS: Das ist gerade das Tolle an der Uni, dass man dort immer auf Menschen trifft — und man braucht ja auch nicht fünfzig, sondern vielleicht zwei, drei, oder vier -, mit denen man sich über die Dinge, die einen interessieren, unterhalten kann. Freundschaften sind ja gerade dann besonders schön und langlebig, wenn sie auf etwas Drittes ausgerichtet sind. Und das kann niemals nur der eine verrückte, besoffene Abend sein, sondern das muss die Beschäftigung mit etwas Drittem sein, wie die Literatur oder der Film. Denn so bleibt man immer in einem Gespräch, kann auch immer von sich selbst, von den eigenen Befindlichkeiten, weggehen, richtet seinen Blick auf etwas Drittes und regt sich dann wieder an, um das Gespräch fortzusetzen.
Deswegen ist die Universität immer noch ein extrem wichtiger Ort, weil dort so viele Vereinzelte hinkommen — mit ihren speziellen Interessen -, die sich vorher vielleicht auch sehr allein gefühlt haben, die dann aber an der Universität Gleichgesinnte finden. Deswegen war das auch so eine Katastrophe, dass die Unis während der Pandemie so lange geschlossen waren, weil sich genau diese Freundschaften über Zoom-Calls im großen Seminar nicht herstellen lassen. Wo das aber noch passiert, und das ist das Wunderbare an unserer vernetzten Zeit, das ist in den sozialen Medien, dass man darüber Leute kennenlernt. Fast alle Menschen, die heute für mich relevant sind, habe ich über das Internet kennengelernt. Und ich meine nicht Dating-Apps.
RM: Die digitale Vernetzung bietet hier in der Tat große Vorteile. Bleiben wir aber noch einen Moment beim Studium. Was sind, neben dieser sozialen Komponente, Faktoren, weswegen Sie jungen Leuten das Studieren empfehlen würden?
WMS: Idealerweise müssten alle, die studieren wollen, auch nur studieren können und müssten nicht auch noch nebenher arbeiten müssen, um sich das Studium zu finanzieren. Das ist ein großes Problem, denn alle Zeit, die man für einen Nebenjob verwendet, die fehlt, um sich beispielsweise mit Literatur tiefer auseinanderzusetzen.
Gehen wir jetzt aber mal von dem Idealbild aus, man hat also die Zeit, sich ganz auf das Studium zu konzentrieren, dann bedeutet das für mich nicht, dass man nur pflichtschuldig alle Seminare belegt, die man machen muss, und darüber hinaus aber relativ wenig; sondern für mich war es so, dass ich das Studium genutzt habe, um mich mit Dingen, die mich interessieren, zu beschäftigen. Manchmal ging das überein mit den Seminaren, die angeboten wurden, aber vor allem war Studium für mich auch Selbststudium. Das heißt, in der Vorlesung bekomme ich eine Inspiration für etwas, das mich interessieren könnte und dann beginnt erst meine eigentliche Auseinandersetzung. Da ist der Dozent schon längst nicht mehr gefragt; da stellt sich auch nicht die Frage, ‚ist das relevant für die nächste Hausarbeit?‘ Da stellt sich nur die Frage, ‚ist das relevant für mein intellektuelles Fortkommen?‘
Und das würde ich jedem empfehlen, soweit die Zeit dies ermöglicht. Für mich war völlig klar, als ich die Schule verließ und nicht mehr so viel verpflichtend machen musste, was mich gar nicht interessierte (beispielsweise der Biologieleistungskurs), dass ich generell die Zeit jetzt nutze, um möglichst viel zu lesen, zu studieren, um ein Fundament zu haben, das einem nicht nur beruflich hilfreich sein kann, sondern wirklich im Sinne einer gesamten Bildung der Persönlichkeit wichtig ist.
Das bedeutet auch, dass man eine gewisse Disziplin an den Tag legt. Ich hatte nicht jeden Abend Lust, ins Kino zu gehen. Aber ich hatte immer Lust, mich weiterzubilden. Deswegen habe ich dann Disziplin an den Tag gelegt und bin ins Kino. Genauso hat man nicht immer Lust zu lesen, aber man muss sich dazu überreden. Das braucht man schon, um das Studium wirklich zu nutzen — immer mit dem Wissen auch, möglicherweise nie mehr so viel Zeit zu haben, um sich mit den geistigen, wichtigen Inhalten auseinanderzusetzen.
RM: Man ist es sich fast schon schuldig.
WMS: Ja. Also man kann nicht sagen, ‚das lese ich mal, wenn ich in Rente bin‘. Wir wissen gar nicht mehr, wann wir irgendwann in Rente geschickt werden. Wir sind dann eh schon im greisen Alter und man wird sich nicht plötzlich nach vierzig Jahren Beruf — das macht ja was mit einem – der Philosophie öffnen. Das mag sein, dass es das in Einzelfällen gibt, aber ich würde sagen, gerade in jungen Jahren ist man enorm aufnahmebereit.
RM: Gesellschaft und Uni reagieren schnell besorgt, wenn das geisteswissenschaftliche Studium nicht in Regelstudienzeit beendet wird. Als Wissenshungriger hat man in höheren Semestern so schnell einen schlechten Beigeschmack.
WMS: Ich habe vierzehn Semester studiert und das hat mir nicht geschadet. Aber man muss die Zeit nutzen. Es gibt auch Leute, die studieren zwanzig Semester und haben aber auch in zehn Semestern kein Buch angerührt. Das muss man der Ehrlichkeit halber auch sagen. Aber grundsätzlich ist diese starke Verschulung und dieser Glaube, dass man ganz schnell fertig sein muss, ja nicht an ein Bildungsideal angelehnt, sondern nur an kapitalistische Verwertbarkeit.
RM: Ich habe es schon öfters gehört, dass ein Germanistikstudium problemlos abgeschlossen wurde, ohne auch nur ein einziges Buch vollständig gelesen zu haben. Wie schätzen Sie die hohen Immaktrikulationszahlen ein? Studieren aktuell viele, die eigentlich besser wo anders aufgehoben wären?
WMS: Das ist ein ganz großes Problem in den Geisteswissenschaften, vor allem in der Germanistik. Jeder, der nicht so genau weiß, was er machen will, denkt sich ‚Deutsch kann ich sprechen, also kann ich auch Germanistik studieren‘. Diese Probleme haben sie in der Mathematik nicht. Dort werden nur die Leute studieren, die auch ein mathematisches Verständnis haben. Diesen Leuten kann ich ganz klar abraten, die Geisteswissenschaften nur aus Verlegenheit zu studieren, denn es ist auch ökonomisch idiotisch, da sollte man lieber etwas studieren, mit dem man auch garantiert gutes Geld machen kann.
Einfach nur aus Verlegenheit zu studieren, halte ich für falsch. Ich bin auch gar nicht dafür, dass grundsätzlich möglichst viele Leute studieren sollen. Es ist gut, dass wir solch eine Expansion haben und viele Leute die Möglichkeit bekommen, ein Studium zu absolvieren, aber wir haben auch eine Kultur geschaffen, wo der universitäre Abschluss als das Nonplusultra gilt und das ist völliger Unsinn. Man kann sehr interessante Ausbildungen machen, kann dort in einer anderen Weise hoch qualifiziert sein und verschließt sich auch damit nicht zugleich der philosophischen und künstlerischen Welt. Ich merke das immer wieder, wenn ich Vorträge halte: Viele Leute in meinem Publikum machen handwerkliche Tätigkeiten oder arbeiten in der Pflege. Trotzdem können die sich natürlich im selben Maße für Film und Literatur begeistern. Das heißt, nur weil man sehr gerne liest, muss man nicht unbedingt Germanistik studieren. Wir sollten von einer Hierarchie absehen, in der grundsätzlich die universitäre Laufbahn die beste aller Welten bedeutet.
RM: Abschließend möchte ich noch geschwind das Unikino ansprechen. Hat die Vermittlung von Nischenfilmen damals in Trier gut geklappt?
WMS: Ja, das hat in Trier sehr gut funktioniert und ich verdanke dem Unikino die Begegnung mit Slavoj Žižek, den ich vorher nicht kannte. Ich sah dort seinen ersten Film, den er gemeinsam mit Sophie Fiennes gemacht hat — zu Hollywood und Ideologiekritik. Ich weiß noch, ich war alleine an diesem Abend dort, meine WG-Mitbewohnerinnen wollten nicht mitkommen, und als ich dann heimkam, bedeckte ich sie mit einem Redeschwall, wie großartig und augenöffnend dieser Film gewesen ist. Das habe ich dem Unikino zu verdanken.
RM: Toll, dass Sie so zu Žižek gefunden haben – das wusste ich gar nicht. Bei Büchern gab es doch sicher auch solche augenöffnenden Begegnungen. Können Sie spontan drei solcher Werke nennen?
WMS: Malina von Ingeborg Bachmann, Holzfällen von Thomas Bernhard und In Stahlgewittern von Ernst Jünger.
RM: Welche drei Bücher, die zunächst nicht direkt etwas mit Filmen zu tun haben, waren entscheidend für Ihr Filmverständnis?
WMS: Gender Trouble von Judith Butler, Die Dialektik der Aufklärung von Horkheimer und Adorno und Madame Bovary von Flaubert.
RM: Wie sieht es bei Büchern aus, die primär vom Film sprechen?
WMS: Also sicherlich von Tarkowski Die versiegelte Zeit, von Ingmar Bergman Laterna Magica und wenn es um Theorie geht, dann: Ich höre dich mit meinen Augen von Slavoj Žižek. Die Filmgenre- und Filmstil-Reihe vom Reclam-Verlag finde ich auch sehr gut, die ist sehr hilfreich. Robert Bressons Buch Notes on the Cinematographer ist für mich sehr wichtig gewesen. Ich bin aber kein Filmwissenschaftler, das heißt, die Filmtheorie rezipiere ich zwar auch, aber die ist nicht so prägend für mich. Ich habe die Faszination für Deleuze seitens der Filmwissenschaftler beispielsweise nie nachvollziehen können.
RM: Da Sie in der Vergangenheit bereits Lehrerfahrungen in der NDL machen konnten, würde mich zu guter Letzt noch interessieren: Könnten Sie sich vorstellen, jemals an einer Uni Filmkurse zu geben?
WMS: Ich könnte mir nicht vorstellen, dauerhaft zur Universität zurückzukehren, aber für einzelne Gastspiele definitiv. Denn was mich an der Uni abgeschreckt hat, war das Administrative, das auf einen dann zurollt — die ganzen bürokratischen Hürden. Was ich immer liebte, war die Lehre — die Auseinandersetzung mit den Studenten und die Diskussionen. Das war eigentlich das, was mich auch selbst inhaltlich weitergebracht hat.
RM: Ich drücke Ihnen fest die Daumen, dass sich dafür Wege finden lassen. Und wer weiß, vielleicht verschlägt es Sie in diesem Zusammenhang ja nochmal in naher Zukunft nach Augsburg.
Wolfgang M. Schmitt ist Webvideoproduzent, Autor und Podcast-Moderator. Zu seinen erfolgreichsten Projekten zählt der Youtube-Kanal Die Filmanalyse, auf dem Kino ideologiekritisch betrachtet wird. Gemeinsam mit Ole Nymoen moderiert er den Podcast Wohlstand für Alle; Die Neuen Zwanziger entstehen in Zusammenarbeit mit Stefan Schulz.
2021 veröffentlichen Wolfgang M. Schmitt und Ole Nymoen das Buch Influencer: Die Ideologie der Werbekörper. Eine Sammlung transkribierter Filmanalyse-Texte (Die Filmanalyse: Kino anders gedacht) erschien 2023.
Roman Matzke studiert Komparatistik an der Universität Augsburg.




