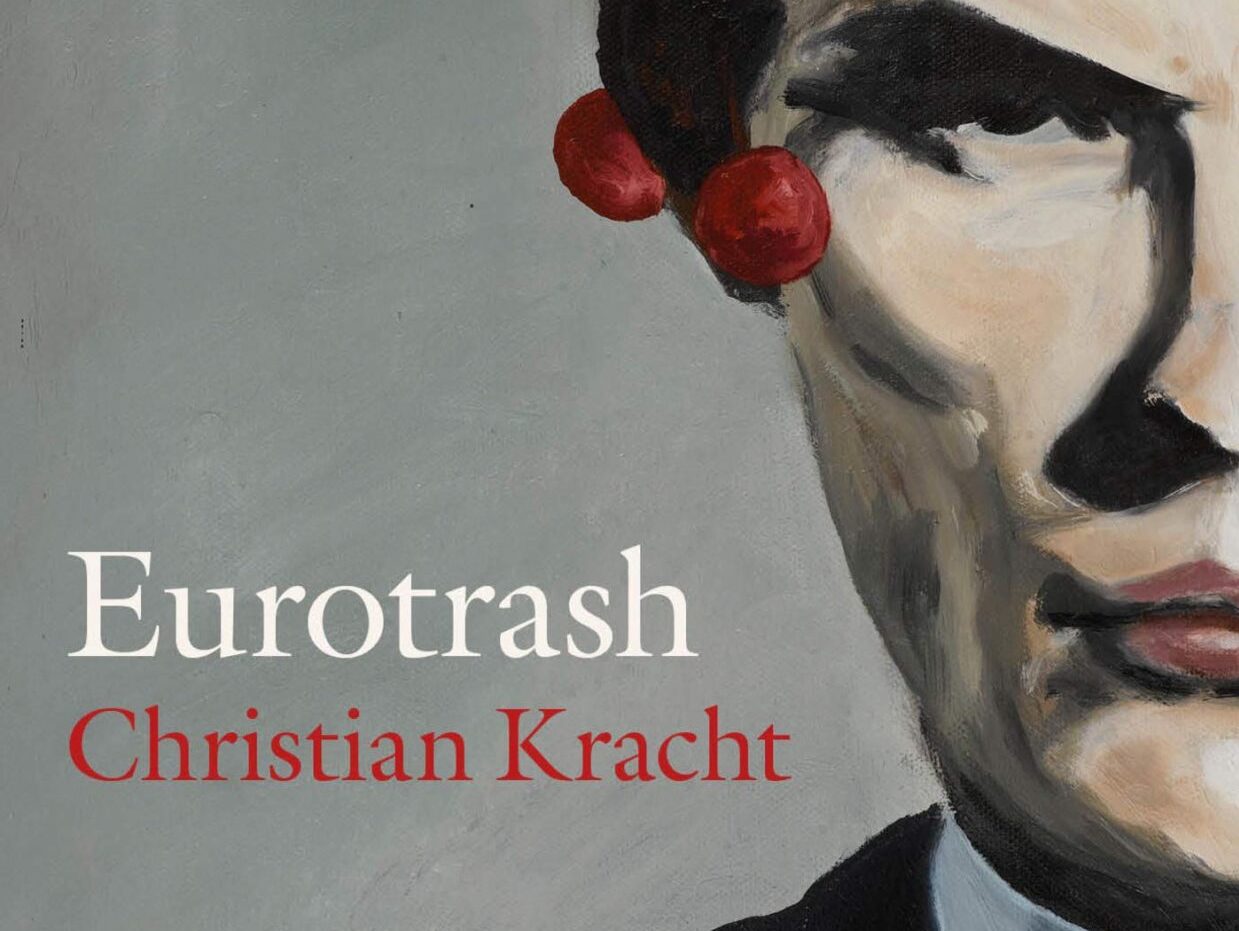Zu Christian Krachts Eurotrash
von Leo Blumenschein
Christian Kracht und Marcel Proust – beide sind sie das, was Sören Kierkegaard wohl als ästhetischen Menschen beschreiben würde. Und, beide sind sie auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Ob man sie literarisch einholen kann? Bis heute nicht endgültig geklärt. Kracht jedenfalls scheint die verlorene Zeit nicht mehr einholen zu können. Oder doch? „Aeternitas a parte ante“ – nicht umsonst lässt Kracht die Mutter des Erzählers gleich mehrfach diesen Satz zitieren.
Tatsächlich spielt der Autor wie in keinem anderen Werk mit Zeit und Erzählperspektiven. Irgendwie geht es ja in jedem Christian-Kracht-Buch um Christian Kracht; neu ist nur die Offenheit mit der es geschieht. Der Kracht‘sche Narzissmus in all seiner Raffinesse offenbart sich schon im ersten Satz von Eurotrash:
„Also, ich musste wieder auf ein paar Tage nach Zürich. Es war ganz schrecklich. Aus Nervosität darüber hatte ich mich das gesamte verlängerte Wochenende über so unwohl gefühlt, dass ich unter starker Verstopfung litt. Dazu muss ich sagen, dass ich vor einem Vierteljahrhundert eine Geschichte geschrieben hatte, die ich aus irgendeinem Grund, der mir nun nicht mehr einfällt, ›Faserland‹ genannt hatte.“
Die Geschichte seiner „vollkommen gestörten Familie“ will Christian Kracht erzählen.
Da sind der sadomasochistische SS-Großvater, der Nolde-hortende Vater und allen voran die alkoholkranke und psychotische Mutter. Mit genau dieser begibt er sich auf einen Roadtrip durch die Schweiz. Im Gepäck 600 000 Franken, die es zu verschenken gilt. (Natürlich eher aus Snobismus als aus politischen Gründen) Von dem vollkommen geschmacklosen Bungalow der Mutter am Züricher See über eine ökologische Nazikommune bis hin zu der Psychiatrie „Elfenstein“ in Winterthur führt die Reise. Kracht wirkt dabei fürchterlich müde: müde über Faserland, müde über die immer gleichen Gespräche (mit der Mutter), müde über den ganz unaufgearbeiteten Nazimoloch (seiner Familie) und vor allem müde über sein eigenes Dandytum. So müde, dass er sich zeitweise als kapitalismuskritischer Globalisierungsgegner versucht, was dem ästhetischen Menschen Kracht natürlich ganz schrecklich zu Gesicht steht. Dort hingegen, wo Kracht seine Müdigkeit in Ironie ummünzen kann, beginnt sein Dandytum neue Schärfe zu gewinnen: Wenn er sich als Daniel Kehlmann ausgibt oder seine eigene Bildung als Scheinbildung bezeichnet, entsteht der sympathische Elitarismus eines Menschen, der es sich erlauben kann, über sich selbst zu lachen. Genau jener Fähigkeit, an der es Krachts Vater, Christian Kracht senior, der rechten Hand Axel Springers, immer gefehlt haben muss. Ja, ganz am Ende, wenn Kracht seine Mutter mit dem Versprechen, sie bald wieder zu sehen, in die Psychiatrie entlässt, kann man es fast als Geschichte einer Befreiung lesen. Dass die Mutter, die gerne mal Sätze loslässt wie „Nur wer vor 1789 gelebt hat, weiß, wie angenehm das Leben sein kann“, dem Leser trotzdem sympathisch erscheint, liegt vor allem an ihrer psychischen und physischen Labilität.
Irgendwie schüttelt Kracht all das, was ihn da so fürchterlich müde macht, doch noch ab. Die Auseinandersetzung mit seiner ‚Möchte-gern-feudalen Herrschaft‘ ist auch immer die Auseinandersetzung mit seinem ‚Alter-Faserland-Ego‘. Dass er die Barbourjacke gegen einen Wollpulli tauscht, könnte dabei kaum plakativer sein.
Ach ja, irgendwo zwischen David Bowie und Franz-Josef Strauss fällt tatsächlich noch der Name Proust: Laut Kracht verkaufte Peter Suhrkamp sein Haus auf Sylt an Axel Springer, um mit dem Erlös die deutschsprachigen Lizenzen für Prousts „Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“ erwerben zu können.