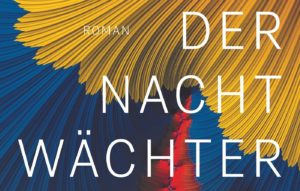von Michelle Mück
Gläserklirren, Klaviergeklimper, Piepen, Freudenschreie und Enttäuschungsrufe erfüllten meine Ohren, doch ich nahm sie kaum wahr, so vertraut waren mir die Laute. Genauso vertraut wie der rote Teppichboden, die extravaganten, aber dennoch billig wirkenden Lampen und goldenen Säulen. All das erinnerte mich an ein altmodisches Kreuzfahrtschiff, zumindest wie ich es mir vorstellte – vielleicht die Titanic. Wahrscheinlich kam ich deswegen so gern her: weil es prunkvoll war. Ich fühlte mich als wäre ich ein anderer, ein Reicher. Dass die goldenen Rahmen der Spiegel, die hohen Vasen, der Marmortresen, das alles, nur Imitate waren, das störte mich nicht, ich blendete es einfach aus und gab mich der Vorstellung hin, einer zu sein, der es geschafft hatte. Und ja, vielleicht stimmte das sogar schon bald.
Ich bin nicht dumm, ich wusste, dass das hier keine gute Idee war, dass ich aller Wahrscheinlichkeit nach verlieren würde. Aber heute hatte ich ein gutes Gefühl. Immer wenn ich bisher verloren hatte, hatte ich davor ein schlechtes Gefühl gehabt, hatte versucht es zu verdrängen, und dann trotzdem gespielt. Das war dumm gewesen. Aber heute: gutes Gefühl. Fortuna schien wohlwollend auf mich herabzublicken, ja, mich sogar zu anzufeuern. Fast glaubte ich, ihre Hand statt der des Croupiers am Rad zu sehen.
Und außerdem war Roulette ein Spiel, bei dem man gute Chancen hatte: Schwarz oder Rot. So einfach konnte man seinen Einsatz verdoppeln. So einfach konnte man sein Leben ändern. So einfach konnte man den Vorsprung, diesen Riesenvorsprung, den alle anderen hatten und der immer und immer größer zu werden schien, wett machen. Innerhalb von Sekunden.
Mein Freund, Frank Woytasch, der hatte ausgesorgt. Der hatte nicht nur die richtige Farbe, sondern auch noch die richtige Zahl genannt. Und jetzt hieß es, nie wieder arbeiten. Natürlich guckte der mich nicht mal mehr mit dem Arsch an. Leute mit Geld eben.
Das Rad drehte und drehte sich unter meinem angespannten Blick: und hielt bei schwarz, verdammt. Kurz überkam mich Panik, ein Blitzschlag, der meine Schädeldecke traf und sich durch meinen ganzen Körper fraß. Egal, ich hatte noch was. Und das musste ich jetzt auch setzen, denn Elena durfte nicht merken, dass das Geld weg war. Sie hatte das Geld genau im Blick, keinerlei Vertrauen in den eigenen Mann. Ich musste zumindest wieder das reinholen, was ich eben verloren hatte. Aber am besten mehr.
Ich bekräftigte meinen Entschluss mit einem Nicken. Diesmal würde es bestimmt klappen. Das war ja auch logisch: Irgendwann musste rot kommen. Ich legte also den nächsten Chip wieder auf das rote Feld, das mich magisch anzuleuchten schien. So ein kleiner billiger silberner Chip hatte einen Wert von 10.000€. Insgesamt hatte ich drei von ihnen gehabt, jetzt war neben dem, der schon im Feld lag, nur noch einer übrig.
Ich hörte Elenas mahnende Stimme in meinem Ohr, doch ein Gedanke vertrieb sie sogleich: Was wird sie sagen, wenn ich gewonnen habe? Vor meinem inneren Auge sah ich ihren ungläubigen Blick, wenn ich es ihr erzählen würde, ihre Augen, die sonst meist sorgenvoll verengt waren, wären dann voller Glanz und Freude, die sie nur mir verdankte.
Mit überzogener Stimme und starkem deutschen Akzent rief der Croupier »rien ne va plus!« und warf die Kugel in das sich schon drehende Rad. Klappernd sprang sie über die Felder, hüpfte von Rot zu Schwarz zu Schwarz zu Rot zu Grün. Drehte und drehte sich.
Als ich das Casino verließ, waren meine Hände pures Eis, und kaltes Wasser schien mir vom Haaransatz den Nacken hinabzulaufen. Meine Ohren rauschten. Meine Hände tasteten nach einer Wand, denn ich hatte das Gefühl, jeden Moment in Ohnmacht zu fallen. So wie sich eben noch das Rad gedreht hatte, ein Geschmier aus Rot und Schwarz, drehte sich nun auch alles andere vor meinen Augen. Oben war unten und unten oben, der Mond am Boden, die dreckigen Pfützen auf Beton in der Luft. Die Wand floss zwischen meinen Fingern und eine unkontrollierbare Übelkeit überkam mich, die noch gefördert wurde durch den Gestank aus Auspuff, Zigarettenrauch und Urin, der mich umgab.
Wieso hatte diese verdammte Kugel nicht noch ein Feld weiter rollen können. Warum hatte sie sich dieses scheiß Feld ausgesucht, um einzurasten. Ich fühlte mich betrogen. Von der Kugel. Von Fortuna. Und vom Leben.
Einmal im Leben hätte ich ein bisschen Glück gebraucht. Nein nicht Glück: Logik. Aber nein, weit und breit kein Glück und keine Logik. Nicht in meinem Leben. Nur bei den anderen.
Fickt euch.
Ich schlug den Kopf gegen die haltbringende Wand. Das Rauschen in meinen Ohren verstärkte sich und mein Kopf dröhnte, doch nun zog immerhin der Schmerz, der mir die Brust zuschnürte, weiter in meinen Kopf. Als ich diese helfende Maßnahme also sogleich noch einmal wiederholen wollte, hörte ich eine amüsierte Stimme hinter mir: „Entschuldigen Sie?“.
Ich fuhr herum und blickte einem jungen Mann in die dunklen Augen, die aus einiger Höhe auf mich gerichtet waren. Es irritierte mich, wie weit er von mir entfernt stand: die Worte hatten so geklungen, als hätte er sie direkt in meine rauschenden Ohren gesprochen.
Der Mann trug einen schicken dunkelblauen Anzug, der sich so perfekt an seinen mageren Körper schmiegte, als wäre er mit ihm auf die Welt gekommen. Eine etwas zu lange Nase, die eine dunkle Hornbrille trug, und ein schmaler, zu einem Lächeln verzogener Mund saßen in einem hageren, von dunklen Locken gerahmten Gesicht. Seine Erscheinung hatte etwas Feminines. »Kann man Ihnen vielleicht…helfen?« Ich hatte den starken Impuls, auf den Mann loszugehen, ihn anzuschreien: Dieser Ton … Es lag so ein Spott darin, und selbst wenn der Mann ehrlich besorgt wäre: Wie sollte er mir helfen können? Wie sollte er mich verstehen, dieser Mann, der alles hatte, einen teuren Anzug, wahrscheinlich ein Wahnsinnsauto, ein Wahnsinnshaus, ein Wahnsinnsleben. Und all das war ihm wahrscheinlich in die Wiege gelegt worden, denn er war viel zu jung, um sich selbst ein Vermögen aufgebaut haben zu können. Und trotzdem stand er hier und spottete.
Ich schluckte die aufkeimende Wut herunter und stieß ein Nein hervor, bevor ich mich wieder der Wand zudrehte, auf der ein kleiner glitzernder dunkler Fleck erklärte, was mir gerade in die Augen rann.
»Ich denke schon.« Der Mann fasste mir an die Schulter und ich fuhr erneut herum und sah ihm jetzt, leicht taumelnd von der schnellen Bewegung, direkt in die Augen. „Ach ja, und wie, bitte, wie wollen Sie mir helfen?“ Sein amüsiertes Lächeln schwand nicht, sondern wurde eher noch größer. Es schien ihm riesige Freude zu bereiten, wie ich litt und immer mehr außer mich geriet. Die Wut darüber bildete einen Pfropfen in meinem Hals, der kaum Luft, geschweige denn Worte, hindurchließ.
»Ich verspreche, ich kann Ihnen helfen«, sagte der Mann ganz langsam, als wäre ich schwer von Begriff.
Immer wieder schluckte ich, dann schließlich, eher voller Verzweiflung als mit dem Hass, den ich eigentlich in meine Stimme hatte legen wollen, stieß ich hervor: »Und wie?«
Der Mann kicherte kindlich und leckte sich über seine Lippen, was mir einen Schauer des Ekels über den Nacken jagte. »Sie brauchen Geld.«
Ein mulmiges Gefühl überkam mich. Man musste kein Hellseher sein, um zu wissen, dass ein verzweifelter Mann vor einem Casino in Geldnot steckte. Aber was wollte der Mann dafür? Er sah ganz sicher nicht aus wie ein Samariter.
Aber ich nickte stumm.
»Wie viel?«, fragten die schmalen Lippen.
»Fünfzigtausend«, log ich, denn eigentlich hatte ich ja nur dreißig verloren, konnte aber auch fünfzig gut brauchen und schließlich war ich ja heute hier gewesen, um das Geld mehr werden zu lassen.
»Nur? Die kriegen Sie.« Dünne Finger zogen einen Scheck und einen Stift aus der Anzugtasche und füllten ihn an der Wand aus, direkt auf meinem glitzernden Fleck. Ich starrte den Mann an. Noch immer fühlte ich eine dumpfe Wut, eine lähmende Verzweiflung, aber keinen Anflug von Dankbarkeit, ich empfand nur Verwunderung. Zum einen, weil dieser Mann mir einfach so dieses ganze Geld geben wollte. Zum anderen wegen des Schecks: Wer zahlte denn so? Das kannte ich höchstens aus amerikanischen Filmen und vielleicht aus tief vergrabenen Kindheitserinnerungen.
Der Mann hielt mir lächelnd den wertvollen Papierfetzen hin. Ich zögerte, streckte die Hand aus und zog sie dann doch wieder zurück: Wahrscheinlich war das alles ein Scherz und der Scheck funktionierte überhaupt nicht. Oder es war nichts darauf außer einer ordinären Zeichnung oder etwas Ähnlichem.
»Los, nehmen Sie ihn schon!« Die dunklen Augen leuchteten begierig. Wieder zuckte die Zungenspitze über seine Lippen.
Zögerlich nahm ich den Scheck. „Was … was muss ich dafür tun?“, fragte ich langsam, als ich den Scheck vorsichtig und mit spitzen Fingern entgegennahm. Ich inspizierte ihn ausgiebig. Hellrote Flecken sprenkelten das dünne Papier. Ich wusste nicht genau, wie so etwas auszusehen hatte, aber alle Felder waren ausgefüllt, er war unterschrieben und da stand sie, die Zahl 50 000. Da durchfuhr mich wieder ein kleiner Stromschlag. Das Feld ganz unten forderte die Nennung eines Empfängers. Hier stand Jan Kowinski. Mein Name, ja, das war mein Name. Ich starrte in das hagere Gesicht des Mannes, der mich weiterhin amüsiert musterte. Mir wurde flau im Magen. Was ging hier vor sich?
»Nichts.« Die dünnen amüsierten Lippen zogen sich zurück und der Mann zeigte viele kleine Zähne. Doch ich war einfach nur froh, dass er die Zunge für ein paar Augenblicke in seinem Mund behielt.
Niemand schenkte einem Fremden diese Menge an Geld. Ich fuhr mir nervös über den Haaransatz. Schon wieder sammelte sich dort der Schweiß.
»Bis wann habe ich Zeit? Ich brauche ein wenig, um das zusammen zu bekommen.« Mein Blick huschte über meine Schulter zum Casino, das hinter mir thronte.
»Denk nicht mal dran. Außerdem will ich das Geld nicht zurück – das gehört dir.« Er kniff die Augen zusammen, das sollte wohl sympathisch wirken, doch in Kombination mit diesem Lächeln war rein gar nichts sympathisch. »Also.« Er streckte mir eine Hand entgegen, an der die Fingernägel deutlich zu lang waren, was in scharfem Kontrast zu seinem sonst so gepflegten Äußeren stand. »Haben wir einen Deal?«
Bevor ich weiter darüber nachdenken konnte, schlug ich mit dem Mann ein. Der Händedruck war fest und eisig, doch das konnte auch an meinen noch immer kalten Händen liegen. Während der Mann meine Hand festhielt, begannen seine Augen zu schimmern und seine Zunge zuckte erneut über die Lippen. Ich wollte nichts mehr, als mich loszureißen, wegzukommen von diesem Mann, von diesem Ort und dieser Situation. Ruckartig entwand ich meine Hand seinem Griff und schnappte vor Schmerz nach Luft. Es fühlte sich an, als hätte ich meine Hand über ein Rasiermesser gezogen und als ich auf sie herabblickte, sah ich einige Bluttropfen in sattem Rot aus der Handinnenfläche quellen.
»Ach, das tut mir leid«, der Mann zog die Mundwinkel herab, doch sie schnellten gleich wieder zurück, »ich bräuchte dringend mal wieder eine Maniküre.« Er sah auf seine eigene dürre Hand, an der ebenfalls Blut klebte, und inspizierte es so ausgiebig, dass ich für einen Moment dachte, er würde es ablecken wollen. Doch dann wandte sich sein Blick wieder mir zu. »Guten Abend, Herr Kowinski«, sagte er und ging.
Was hatte ich getan
Der Gedanke kreiste auf dem Weg vom Casino nach Hause in meinem Kopf, schrie in meinem Kopf, kämpfte darum, mich umdrehen und alles rückgängig machen zu lassen. Doch was sollte das bringen? So oder so war dieser Mann wahrscheinlich längst verschwunden und ich hatte keine Ahnung, wo ich ihn finden könnte.
Doch, was mich vor allem daran hinderte, war, dass das alles, der Verlust unserer gesamten Ersparnisse, der Mann, der Scheck, die Ängste um Elena, so wirkte, als wäre es nicht erst eben passiert, sondern als läge es sehr weit zurück oder als wären die Dinge nicht mir passiert, sondern einem Fremden, einem armen Sack, der mir das alles nur am Tresen einer Bar über einem Bier gebeugt erzählt hatte oder doch mir, aber dann nur in einem Traum, den ich schon fast wieder vergessen hatte und bei dem es mir nur noch bruchstückhaft gelang, ihn wieder zusammenzusetzen. Das führte dazu, dass ich es nicht schaffte, die Situation ernst zu nehmen und die einen klaren Gedanken zu fassen, was jetzt zu tun sei.
Ich fuhr nicht direkt heim, sondern einen unnötig langen Weg, denn normalerweise gelang es mir so, mich zu beruhigen. Doch in meinem Kopf wurde es immer wirrer und düsterer. Es half nichts: Ich musste nach Hause.
Als ich dann endlich dort ankam und zu Elena ins Bett stieg, überkam mich unerwartet die lang ersehnte Ruhe und all die konfusen, schreienden Gedanken stoppten mit einem Mal; alles würde gut werden. Wir hatten ein Happy End verdient und wir würden ein Happy End bekommen. Dafür würde ich ab jetzt sorgen.
Ich streichelte Elena sanft über die Wange, eine blonde Strähne hatte sich aus dem knubbeligen Dutt auf ihrem Kopf gestohlen und lag ihr im Gesicht. Wäre sie wach würde sie das stören, doch wenn sie schlief, schlief sie wie ein Stein. Darum hatte ich sie schon immer beneidet. Während ich sie ansah, fiel ich in einen Schlaf, der dominiert wurde von einer langen Gestalt, einer zuckenden Zunge und langen Klauen statt Händen.
Ich wachte auf und merkte, dass meine Hand klebte. Als ich dann auch noch ein Brennen an der Handinnenfläche bemerkte, setzte mein noch vom Schlaf wirres Gehirn das Puzzle zusammen: Der Schnitt, der Mann, Blut an meiner Hand, das klebte. Doch es klebte nicht nur die Handinnenfläche, wo der Schnitt war, sondern auch die einzelnen Finger, die ich jetzt aneinander rieb; ja, selbst mein Unterarm klebte. Ich öffnete die Augen, die ich bisher noch vor dem morgendlichen Sonnenlicht, das hell durch das offene Fenster fiel, mit geschlossenen Lidern hatte schützen wollen. Doch jetzt öffnete ich sie erst einen Spalt, dann riss ich sie auf, und gleich darauf auch meinen Mund und schrie.
Elenas gesamte untere Seite des Bettes bedeckte eine Blutlache, ein roter Teich auf dem weißen Lacken.
„Elena! Elena!“ Schrie ich immer wieder panisch, und da kam sie aus dem Bad gerannt und sah mich entgeistert an.
Doch ihr Anblick beruhigte mich nicht, ganz im Gegenteil. Denn ihr Nachthemd war ebenso blutig wie das Laken, ab ihrem Schritt war es hellrot statt babyblau.
Jetzt heulte ich auf, denn ich begriff: Das Baby, das Baby war fort. Ich vergrub mein Gesicht in meinen Händen und schluchzte haltlos. Elena kam auf mich zu und riss mir die Hände vom Gesicht,
„Jan, was ist bitte los? Du machst mir total Angst.“
Ich sah nach oben, erst in ihr Gesicht und dann an ihr hinab: babyblau und nicht rot war der Stoff ihres Nachthemds.
„Was? Ich… ich habe keine Ahnung“ Stammelte ich und versuchte mich zu beruhigen, doch mein Atem ging stoßweise und mein Herz schlug so schnell und laut, dass ich jeden einzelnen Schlag in meinem Kopf hörte. Ich strich über das weiße Laken. „Ich verliere wohl meinen Verstand.“
Die Gedanken an den Morgen dominierten meinen Tag. Dazu kam meine Hand, die dumpf vor sich hin pochte; nicht so schmerzhaft, dass es mir ernstliche Sorgen gemacht hätte, aber doch beunruhigend und nervend. Das penetrante Pochen erinnerte mich auch permanent an den Scheck, der sich noch in meiner Jackentasche befand. Einerseits wollte ich nichts mehr, als zur Bank und ihn endlich einlösen, andererseits würde dann die letzte Hoffnung platzen und ich wäre damit konfrontiert, dass wir mit nichts, rein gar nichts da standen. Elena übernahm die Entscheidung für mich: besorgt wegen meines morgendlichen Auftritts streifte sie den ganzen Tag um mich herum und erst am Nachmittag nutzte ich ihren Frauenarzttermin, um ihrer Wacht zu entkommen.
Sobald sie durch die Tür war, lief ich zur Kommode im Schlafzimmer, auf der ich meine Jacke gestern abgelegt hatte, und tatsächlich, da in der Tasche war der Scheck. Es war also tatsächlich passiert. Wieder betrachtete ich ihn eine Weile, dann packte ich ihn sorgsam zurück in die Tasche der Jacke und zog sie an. Dann fuhr ich zur Bank mit einem unguten Gefühl, das von meiner linken Jackentasche auszugehen schien. In meinem Kopf spielten sich unangenehme Szenen ab: Wie die Bankmitarbeiterin mir mitteilte, dass der Scheck ungültig sei, wie Elena anhand der Bankabrechnung erkannte, was ich getan hatte, wie wir uns furchtbar deswegen stritten, sie mir alles vorwarf, was ich jemals falsch gemacht hatte (viele Dinge) und was sie alles für mich getan hatte (hier würde sie maßlos übertreiben), und wie sie mich verließ, für immer. Von vorn: Wieder Bankarbeiterin, Bankabrechnung, Elena bemerkt es, Streit, Auszug.
Die Schleife in meinem Kopf hielt abrupt an, als ich am Banktresen angekommen war und vor der hübschen, jungen Bankkauffrau stand, die der aus meinem Kopfkino überraschend ähnlich sah. Sie nahm den Scheck offenherzig lächelnd entgegen – dabei versuchte sie eindeutig die Blutflecken auf dem Papier zu ignorieren, doch ihr Gesicht entgleiste kurz zu einem leicht angeekelten Blick – tippte ein paar Daten in ihren PC ein und fragte mich, ob ich das Geld ausgezahlt haben wolle oder auf mein Konto überwiesen. Verdattert sah ich sie an, ich spürte sogar, dass mein Mund dabei dümmlich und klischeehaft offenstand, wie bei einem Fisch. Dann fasste ich mich und antwortete ihr, dass das Geld bitte aufs Konto gehen sollte, da wo Elena es ja auch weiterhin vermutete. Wenn sie dann bemerken würde, dass es aus- und wieder eingezahlt worden war, sogar 10.000 € mehr – und ja, wie sollte sie das auch nicht bemerken – würde ich ihr wohl oder übel sagen müssen, dass ich wiedergespielt hatte. Sie würde darüber nicht sonderlich glücklich sein, aber auch nicht sonderlich verärgert, weil es ja mehr und nicht weniger geworden war, und sich relativ leicht besänftigen lassen. Aber das Theater konnte warten.
Der Abend, an dem ich zuerst meine Familie verloren und dann auf wundersame Weise wiederbekommen hatte, schien mir jetzt, da alle Konsequenzen ausgebügelt waren und der Scheck endlich verschwunden war, noch entfernter. Auch wenn ich es versuchen würde – was ich nicht wollte, denn es überkam mich dabei ein Unwohlsein, das ich nicht erklären konnte – ich konnte mich nicht mehr an den Mann als Ganzes erinnern. Wohl hatte ich noch Einzelheiten im Kopf (lange Nägel, Locken, Anzug, Brille, dünne Lippen und grüne, nein braune? Augen) aber sie wollten sich nicht mehr zu einem Mann verbinden und eine nach der anderen wichen auch sie mir aus dem Gedächtnis, bis nichts mehr von ihm übrig war.
Eines nachts weckte mich Elena dann: Sie habe Wehen, wir müssten ins Krankenhaus. Hastig schnappte ich mir ihre wichtigsten Sachen – es waren eigentlich noch zwei Wochen bis zum angesetzten Termin und so hatten wir bisher noch keine Tasche gepackt. Elena wechselte auf der Fahrt immer wieder zwischen freudigem Lachen und Schmerzenslauten und auch ich schwankte ebenfalls zwischen ängstlicher Aufregung und euphorischer Erwartung.
Ich konnte es nicht fassen: Gleich würde ich sie kennenlernen, meine Tochter, eine Mischung aus Elena und mir, der Mensch, der mir für immer am meisten bedeuten würde, für den ich alles geben werde. Die ich trösten werde, der ich Badminton zeigen würde, deren Freunde ich vergraulen würde, wenn sie mir nicht passten, und die ich zum Altar bringen würde, wenn sie dann doch einen fand, der ihrer würdig war, die mich lieben würde, egal was war, denn ich war ihr Vater.
Zwei Stunden später schon hatte ich sie dann im Arm – Maria – und Elena beobachtete uns mild lächelnd, während ich dem winzigen strampelnden Ding unter Tränen verkündete, was es mir bedeutete und es genau das sei, was ich gebraucht hätte, um mich zu ändern. Während Elena kurz darauf einschlief, hielt ich meine Tochter die ganze restliche Nacht im Arm und wachte über ihr.
Plötzlich waren in meinem Leben alle Ampeln auf grün gesprungen. Die Strähne, die ich mir im Casino immer gewünscht, aber nie gehabt hatte, bekam ich dafür jetzt im echten Leben. Alles, was wir angingen, klappte: wir bekamen den Kredit fürs Haus, in meinem Job lief es und ich wurde zum Bauaufseher befördert.
Und Maria: Maria war ein Sonnenschein, jeder sagte uns, dass sie das süßeste und klügste Kind sei, dass sie je getroffen hätten und ja, das war das, was man allen frischgebackenen Eltern immer sagte, doch ich war mir sicher, dass das in diesem Fall auch stimmte. Sie war außergewöhnlich, in allen Bereichen. Doch am stolzesten war ich darauf, dass ich ihr Liebling war. Klar, Elena hatte die Milch, aber trotzdem: mich hatte sie lieber.
Wir verstanden uns auf einer Ebene, mit der ich mich mit keinem erwachsenen Menschen verstand. Noch keine drei Jahre war sie und trotzdem hatte sie einen besseren Humor als die allermeisten. Jeden Nachmittag sah ich mit ihr ihre Lieblingsserie, in der Feen auf eine Akademie gingen, auf der sie verschiedene Feenkünste lernten, jeden Abend las ich ihr vor, während sie in meinem Arm lag, und wenn sie einen Albtraum hatte, hielt ich sie, bis sich ihr Weinen in sanfte schnaubende Schlafgeräusche verwandelte.
Und da war er schon, ihr dritter Geburtstag, ich konnte es nicht fassen. Ich und Elena wollten erstmalig eine richtige Feier für sie machen, zum einen, weil das Haus und der Garten nun auch vorzeigbar waren – mehr als vorzeigbar tatsächlich, wir hatten uns ein kleines Paradies geschaffen – und zum anderen, weil wir in einem Elternratgeber gelesen hatten, dass Kinder in diesem Alter anfingen, Erinnerungen zu sammeln, die dann auch ein Leben lang blieben: die Feier würde sich also jetzt auch lohnen.
Also besorgte ich Luftballons und sogar eine kleine Hüpfburg, Elena buk eine Schoko-Bananen-Torte, wir luden befreundete Eltern mit ihren Sprösslingen ein und besorgten sogar einen Clown. Ich konnte es gar nicht glauben, aber die Vorbereitungen machten mir einen riesigen Spaß und ich konnte den 15. Mai gar nicht erwarten: die Augen, die Maria machen würde, wenn sie all das sah, was ich als Kind nie gehabt hatte. Jeden Abend, wenn ich sie ins Bett brachte, fragte sie aufgeregt, wie viele Tage es noch bis dahin waren, wie viele Stunden, wie viele Minuten
Dann war der Maitag gekommen. Kinder mit schokoumrandeten Mund wuselten um meine Beine, freudenvolle Schreie hallten aus der Hüpfburg und der Clown verteilte Pudel aus Ballons, die den Boden zu füllen begannen. Alles war perfekt, wobei Elena noch Angst gehabt hatte, es könnte zu kalt für eine Gartenparty sein. Aber jetzt schien die Sonne und ließ alles bunt erstrahlen. Der Spaß der Kinder erfüllte die Luft. Ich hatte ein dümmliches Lächeln auf den Lippen, das ich gar nicht mehr weg bekam. Mein Herz war zum Bersten gefüllt mit Liebe und Freude, während ich meine kleine Tochter beobachtete, die schöne Erinnerungen sammelte und immer wieder in haltloses Gelächter ausbrach. Sie trug ein gelbes Prinzessinenkleid und ein Diadem, denn heute war ihr Tag und das sollten ruhig alle wissen.
Der Clown führte nun eine kleine Zaubershow auf und bat um eine Assistentin. Wild fuchtelte Maria mit den Armen und schrie lauter als alle anderen Kinder, die auch wollten. Ich stand mit den anderen Eltern in der hintersten Reihe, ein zweites Stück Torte auf dem Teller, und lachte laut über den Elan, den meine Tochter zeigte.
„Na schön Prinzessin, dann darfst du mir heute behilflich sein!“ rief der Clown und nahm ihre kleine Hand in seine. „Was für ein schönes Diadem du hast. Ist das teuer gewesen?“
Maria nickte nur schüchtern und fasste sich in die geschmückten Haare; jetzt schien sie doch ein wenig aufgeregt zu sein.
„Keine Angst deine Aufgabe ist gar nicht schwer, Liebes.“
Er deutete auf eine große Box aus rotem Sand mit einem schwarzen Stern darauf.
„Mit Hilfe dieser Box kann ich Dinge verschwinden lassen! Glaubst du mir das?“
Noch immer etwas scheu schüttelte Maria den Kopf und lachte dem Clown freundlich entgegen. Auch aus den Reihen der Kinder kamen laute „Nein!“ Schreie und lautes Lachen.
„Nicht? Na, dann werde ich es euch zeigen!“
Der Clown führte Maria zur Box, die ihren Gästen noch einmal freudig winkte, bevor sie durch die vom Clown aufgehaltene Tür in die Box stieg und artig wartete, bis dieser sie wieder schloss.
Wild gestikulierte der Clown vor der Box mit den behandschuhten Händen und sagte einen Satz in einer unverständlichen und lustig klingenden Sprache auf. Die Kinder kreischten vor Freude.
Dann trat er wieder auf die Box zu und während er langsam seine dünne Hand ausstreckte, um sie zu öffnen, sah er mir direkt in die Augen. Und leckte sich flink über die Lippen.

Michelle Mück, geboren 1997 in Bamberg, hat 2022 ihr Masterstudium der neueren deutschen Literatur an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg abgeschlossen. Zurzeit arbeitet sie als Fachredakteurin in einem Fachbuchverlag in Kulmbach, wohnt jedoch noch immer in ihrer Geburtsstadt. Am liebsten schreibt sie Kurzgeschichten aus dem Genre Horror. Ihr Lieblingsautor ist – surprise, surprise – Stephen King. Weitere literarische Vorbilder sind Daniel Kehlmann und Franz Kafka. Neben dem Schreiben und der Arbeit liest sie gerne deren Bücher, verbringt Zeit mit ihrem Hund, wandert oder schaut Horrorfilme. An diesen liebt sie vor allem das Unerwartete, Spannende und Verstörende – Elemente, die sie auch in ihren Geschichten umzusetzen versucht.