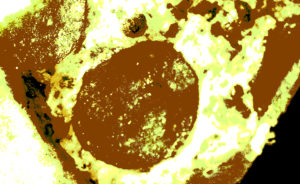© Henschel Schauspiel
von Paula Fünfeck
Wenn Du wissen willst, mit wem du es zu tun hast, schau dir die Verwandten an… Schau’n wir also mal.
Das Ritual, unsere Hauptfigur, hat eine kleine Schwester, die mich interessiert: Das Fräulein Routine.
Die beiden werden manchmal verwechselt.
Dabei haben sie nichts Wesentliches gemeinsam. Im Gegenteil.
Sie könnten gegensätzlicher nicht sein.
Fräulein Routine ist ein Straßenkind mit Migrationshintergrund — nicht, weil sie sich in den Straßen herumtreibt.
Sondern, weil sie so heißt: ’Route’ — französisch für: Weg oder Straße, und das in der Verniedlichungsform.
Hier ist also ein Weg vorgegeben. Aber offenbar kein großer, kein bedeutsamer Weg zu einem erhobenen Ziel. Sondern ein Weglein, ein Alltags-Tröttchen mit allzu bekanntem Ausgang.
Fräulein Routine geht immer denselben Weg.
Sie verlässt das Haus, schaut in den Himmel, ob sie den Kragen hochschlagen soll und dann stapft sie die Straße entlang bis zur nächsten Ecke.
Dort wechselt sie die Seite, weil sie von dort sicherer über die Straße kommt.
Sie taucht ein in das Dunkel der U‑Bahnstation. Beharrlich nimmt sie die Rolltreppe und postiert sich dann am Gleis so, dass sie den allerhintersten Wagen erwischt — so kommt sie am Zielbahnhof am schnellsten raus.
Da Fräulein Routine wie automatisch immer denselben Weg geht, ohne groß nachzudenken, kann sie sich auf wesentlichere Dinge konzentrieren, ohne sich gleich zu verirren.
Geh nicht vom Wege ab… pflücke keine Blumen im Wald, so echot es in meiner Assoziationskammer.
Moment — Wesentlichere Dinge? Also, welche Wege ich gehe, ist demnach nicht wesentlich? Hm.
Immerhin: Die Gewissheit anzukommen macht den Alltag handhabbar. Das Fräulein Routine ist noch nie dem bösen Wolf begegnet.
Zwischenanmerkung:
Kurz nach der Geburt eines Kindes sprießen in seinem Gehirn Zellen wie Blütenknospen. Milliarden Zellen entstehen — so viele, dass sie nicht alle verwaltet werden können.
Sie würden unendliche Kalorienmengen verbrauchen — mir würde so ein Megaverbrauch ganz gut in den Kram passen nur, bei Neugeborenen geht das gar nicht.
Nähre nicht mehr Geist, als der Körper ertragen kann!
Da muss selektiert werden.
Es bilden sich Bahnen im Gehirn, gangbare Wege: Das Beanspruchte etabliert sich, unangesprochenes Potential zerfällt so schnell, wie es entstanden ist.
Es automatisieren sich Prozesse, damit sie beherrsch- und handhabbar werden.
Hier hat Fräulein Routine ihre Wiege stehen.
Diese Wiederholung, dieses Gefallen an fest gefügten Abläufen — das ist die trügerische Familienähnlichkeit zwischen der Routine und dem Ritual.
Übrigens widerspreche ich der weit verbreiteten Meinung, nach der Kinder von Geburt an unheimlich offen sind für alles und jedes; ich teile nicht die Ansicht, dass sie unvoreingenommen neugierig sind auf die ganze Welt, durch Erziehung nur verdorben werden und überhaupt wir Ollen gut daran täten von ihnen zu lernen, wie das geht mit der Fremdheits-Freundlichkeit.
Es ist etwas dran und etwas daran stimmt überhaupt nicht. Denn Kinder verwerfen sofort Optionen, bei denen sie schlechte Erfahrungen machen. Und nachhaltige Offenheit verlangt Toleranz und Geduld mit Misserfolgen, mit negativen Begegnungen.
Ich möchte behaupten:
Frustrations-resistente Offenheit für das Unbekannte wird erworben und ist eine unserer großen Kulturleistungen. Mich interessiert, ob das Ritual dabei eine Rolle spielen kann.
Zum Ritual
Zuerst interessiert mich immer die ursprüngliche Bedeutung der Begriffe, das ’Handlungsmoment’ in etwas Immateriellem wie einem Wort.
Das Ritual — da komme ich natürlich auf Ritus, auf eine heilige oder zumindest bedeutsame Handlung. Die Nachsilbe ’al’ fügt dem Wort noch etwas hinzu… das lässt mich das Wort Ritual übersetzen als: Gefäß der Heiligkeit.
Genau so sehe ich das: Unter Ritual verstehe ich eine formalisierte Handlung, die ein Gefäß für Bedeutsamkeit, sogar Heiligkeit darstellt und je weniger Abwandlungen von der formalisierten Handlung, je stabiler das Gefäß.
Das Ritual schaut wie die Routine nicht rechts, wo die Wölfe in den Büschen lauern und nicht links, wo die schönen Blumen stehen; tatsächlich besteht die Magie des Rituals darin, neben oder in der rituell vollzogenen Handlung keine Nebengeschehnisse oder ‑Gedanken zu dulden; aber Ursprung und Bedeutung der Formalisierung sind ganz verschieden.
Welche Handlung das Zeug zu einem Gefäß für Heiligkeit hat, da sind keine Grenzen gesetzt. Alles kann Ritual sein.
Muss die Handlung an sich etwas Bedeutsames symbolisieren?
Ich meine, nein.
Es ist sogar interessanter, wenn ihr Ursprung so banal wie möglich ist, wenn sie erst durch den Aufwertungsvorgang, durch die Fokussierung auf den rauschfreien Vollzug derselben zu etwas Interessantem und Bedeutungsvollen wird.
Zur Veranschaulichung möchte ich Ihnen eine kleine Übung mitgeben. Denken Sie sich eine Handlung. So banal wie nur möglich. Und führen Sie sie mit der größtmöglichen Feierlichkeit aus. Geben Sie keinem anderen Gedanken Raum, leisten Sie keinem anderen Impuls Folge. Ich habe meine Übung schon gemacht, ich habe, wenn Sie den kleinen Film angeschaut haben, ein Ei verschluckt. Ich musste lange überlegen, was ich wählen würde für mein persönliches Ritual, das mir beliebig genug erschien. Je länger ich nachsann, je klarer kam heraus, dass es vor allem die Art ist, in der wir die Dinge tun und die darüber entscheidet, ob sie bedeutungsvoll sind oder belanglos.
Hier kommt wieder ein ’Übrigens’: Ich finde, dies kann uns ein Trost sein in Corona-Zeiten.
Wir dürfen feststellen, dass ein recht Weniges genügen kann, um dem Leben Sinn und Intensität abzugewinnen. Ein Ritual kann ein Kloster sein.
Das Ritual ist ein Aufwertungsvorgang
Ein Ritual ist eine Handlung, mit der durch gesteigerte Achtsamkeit alltägliche Handlungen zu überalltäglichen Handlungen aufgewertet werden.
Es geht nicht darum, dass die Handlung an sich etwas Besonderes sein muss.
Füße waschen, essen, sprechen, winken — all diese Handlungen können sowohl Routine als auch Ritual sein; aber während man eine Routine in ein Ritual verwandeln kann, so ist es nicht möglich, ein Ritual als Routine zu behandeln, denn in dem Moment, wo dies geschieht, fehlt genau das, was das eine zu dem anderen werden lässt, nämlich die volle, mich ganz ausfüllende Achtsamkeit. Und dann ist es kein Ritual mehr.
Ritualisierung kann verschiedene Levels erreichen.
Sie kann eine Aufwertung des Alltags sein, ein Akt um unserem gesamten Leben eine höhere Qualität zu geben.
Sie kann ein sinnliches Fest bedeuten unter Einbeziehung von theatralischen Aspekten vor Publikum oder in einer ebenfalls feierlich gestimmten Gemeinschaft.
Die dritte Stufe ist: Tadamm! These: Magie. Die maximale Intensivierung der Achtsamkeit vermag den sprichwörtlichen Berg zu versetzen.
Anekdote mit Präambel.
Unser Gedächtnis ist ein Betrüger. Hirnforscher wie Eric Kandel sind ihm auf die Schliche gekommen, es gibt umfassende und höchstspannende Literatur dazu.
Man kann auch einfach die divergierenden Ansichten geschiedener Eheleute zum Scheitern ihrer Beziehung (oder den aktuellen US-Wahlkampf) anschauen, um sich darüber klar zu werden, wie unterschiedlich ein und dasselbe Ereignis erinnert werden kann und wie erbarmungslos überzeugt Kontrahenten von ihren auseinander klaffenden Erinnerungen sein können.
Wenn das Gedächtnis aber ein Betrüger ist — wie kann ich dann sicherstellen, dass die Dinge — so, wie ich sie erlebe und so, wie die Welt sie sieht, dass die — wenn sie schon nicht identisch sind — doch wenigstens eine gewisse lebensnotwendige und Frieden erhaltende Schnittmenge aufweisen?
Woher weiß ich, dass ich nicht in voller Überzeugung eine Sicht auf die Dinge vertrete, die keine andere objektive Wahrheit enthält als mein eigenes Davon‑Überzeugtsein?
Und — wenn ich mir unsicher bin, aber nicht lügen will — erzähle ich dann lieber Geschichten, vertrete ich dann lieber Überzeugungen, die möglichst viel Konsens-Potential haben und unsere Konstitutionen nicht infrage stellen, anstatt mich aufs Glatteis zu wagen und eine Geschichte zu erzählen, die irritiert, die anstößt, die verwirrt oder Ansichten zu vertreten, die zum Widerspruch reizen und meine Mitmenschen aufbringen?
Wie unendlich wichtig ist für uns als handelnde Wesen, denen Urteilskraft von Belang ist, die Gewissheit, im eigenen Gedächtnis einen verlässlichen Partner zu haben, wenn wir nicht nur das Dasein über uns ergehen lassen und dem lautesten Brüllaffen hinterherlaufen wollen! — oder anders herum selber den Sieg über schwächere Individuen zur Bewahrheitung unserer rein subjektiven Gewissheiten missbrauchen wollen.
Vielleicht hat es zu meinen Lebzeiten keine Epoche gegeben, in der mir das nicht nur für mich persönlich, sondern gesamtgesellschaftlich so essentiell erschien wie heute.
Vielleicht führt das jetzt zu weit.
Ich wollte jedenfalls meiner Überzeugung Ausdruck verleihen, dass sich eine Gesellschaft aus Individuen bildet und dass unsere grundlegende individuelle Lebens- und Gedankenführung auch in gesamtgesellschaftlichen Zusammenhängen ’matters’ — um es knapp zu sagen — und ich deshalb den Blick gerne zwischen dem Einzelnen und dem Kollektiven hin und her wandern lasse, manchmal lieber eigene Alltagserlebnisse zu Rate ziehe, um mir auf kollektive Phänomene einen Reim zu machen.
Von elementarer Bedeutung scheint mir die Gewissheit, dass die Dinge sich so zugetragen haben wie ich sie erinnere, beziehungsweise, die Fähigkeit, Dinge so zu erinnern, wie sie sich tatsächlich zugetragen haben.
Und wenn diese Gewissheit oder diese Fähigkeit nicht da ist?
Es gibt eine Hilfe. Sie ist nicht perfekt, aber besser als nichts. Das ist, meine ich, die Dreiteilung unseres Gedanken-Zeitraumes in bewusstes Antizipieren, achtsames Erleben und kritische Reflexion.
Wir können uns unserer eigenen Erlebnisse auch im Nachhinein halbwegs sicher sein, wenn wir sie vorhersehen, bewusst erleben und hernach reflektieren, anstatt uns ihnen wie zufallsgelenkt zu überlassen.
Ohne Erinnerung ist alles nichts.
Eine der größten Fortschritte in der Evolution des Gehirns war das Gedächtnis.
Futterplätze und: die Unterscheidung zwischen Freund und Feind.
Das waren die Grundbedingungen für unsere Vorfahren sich zu sozialen Wesen zu entwickeln.
Was hat das aber mit Ritualen zu tun?
In meinem persönlichen Leben gibt es ein kleines, magisch aufgeladenes Moment, das ich hier erzählen möchte:
Ich hatte eine Bekanntschaft in Italien, Mauro L., der in Bologna bei Umberto Eco Vorlesungen hörte und sich gerade das Heroinschnupfen abgewöhnte — seine Familie lebte in Bergamo, die Schwester: Studentin in Padua.
Er hatte mich beim Trampen aufgelesen, wir verbrachten zwei Wochen mit seinen Freunden in Kroatien, dann haben sich unsere Wege in bester Freundschaft getrennt und wir hörten nichts mehr voneinander.
Als ich mich zwei Jahre später anschickte, einen Kurztrip nach Venedig zu machen, überkam mich der Wunsch, ihn zu sehen. Ich war allerdings inzwischen mit einem sehr eifersüchtigen Knaben liiert und der Gedanke an die unvermeidlichen Auseinandersetzungen über so ein Wiedersehen hielten mich davon ab ihn zu kontaktieren.
Ich besaß ein Foto von besagtem Mauro, ein prä-digitales Selfie, wenn man so will, denn er jobbte in einem Fotostudio und hatte sich selbst fotografiert, um die Lichtverhältnisse zu prüfen.
Auf dem Bild steht er auf einem weißen, Wand und Fußboden bedeckenden Bogen Papier, hat eine Hand auf die Hüfte gestützt und schaut mit dem allerleersten Gesichtsausdruck in die Kamera.
Ich begann, dieses Bild zu betrachten, mehr als das, ich fixierte es und zwar nicht gefühlvoll, sondern, als wenn es Arbeit wäre. Es war Arbeit. Ich strengte mich an. Ich richtete jeden Tag meine Gedanken auf das Bild und spielte eine Szene in Gedanken wieder und wieder durch.
Die Szene ging sehr einfach: Mein aktueller Freund und ich gehen durch eine Gasse in Venedig. Mauro L. kommt mir entgegen. Er ist in Begleitung. Er erkennt mich nicht und geht an mir vorbei. Ich drehe mich nach ihm um und rufe seinen Namen. Auf meinen Ruf hin dreht er sich um.
Jeden Tag wiederholte ich diese Übung. Sie können raten: Wie geht diese Anekdote zu Ende?
Die Geschichte wäre des Erzählers nicht wert, wenn sie sich rein zufällig einfach so zugetragen hätte.
Dadurch, dass ich sie absichtlich und bewusst antizipiert habe, dass es einen materiellen Gegenstand gibt, der einbezogen war und der sogar immer noch existiert und dass die antizipierte Szene sich dann ganz genauso in der Wirklichkeit abgespielt hat, ist sie ein Mirakel, eine besondere Erfahrung in meinem Leben.
Ich konnte dieses Erlebnis nicht anders als für den Beweis ansehen, dass die Übertragung von Gedanken- und Willensschwingungen absolut möglich ist, es sich nur die Frage stellt, wie sich diese Übertragung steuern lässt. Denn, keine Angst — ich beherrsche diese Kunst nicht, Sie müssen nicht in ihre Handtaschen greifen und nachschauen, ob die Portemonnaies noch da sind. Es ist das eine Mal gelungen — nicht geschehen — aber dann nicht wieder oder jedenfalls… selten.
Die Geschichte stammt aus ja vor-digitaler Zeit. Heute finde ich es oft belustigend, wie manche Menschen diese Art von Energietransfer für esoterischen Quark erachten, sich zugleich aber kein bisschen wundern, dass sie mit einem Mausklick einen 90-minütigen Film von Australien nach Flensburg schicken können — oder was auch immer.
Ich habe die Geschichte schon öfter im privaten Umfeld erzählt, aber noch nie öffentlich. Vielleicht war die Aufforderung, sich mit der potentiellen Wirkmächtigkeit von Ritualen zu befassen, genau der richtige Anlass dafür.
Rituale können magisch sein durch die potentiell unbegrenzte Aufwertung unserer Handlungen.
Sie können uns helfen, durch das, was ich den Dreizeiten-Raum nennen möchte, uns unserer Narrative zu vergewissern.
Sie befreien uns von unseren Gewohnheiten und bewahren uns vor Zufällen.
Sie helfen uns, unbefangen mit dem Unbekannten in Kontakt zu treten, weil wir durch sie lernen, uns antizipierend, achtsam und reflektierend zugleich in Zeit und Raum sowohl zu bewegen als auch innezuhalten — je nachdem wie die Situation es erfordert.
Zum Abschluss möchte ich ein Lied in Erinnerung bringen, in dem dieser Dreizeitenraum, so wie ich das verstehe, sehr poetisch beschrieben ist und das Elend, das der Verlust desselben mit sich bringt. Das ist das Lied ’Die Nebensonnen’ aus der Winterreise von Wilhelm Müller und Franz Schubert.
Die Nebensonnen
Drei Sonnen sah ich am Himmel stehn
Hab lang und fest sie angesehen
Und sie auch standen da so stier
Als wollten sie nicht weg von mir
Ja, neulich hatt’ ich auch wohl drei
Nun sind hinab die besten zwei
Ging nur die dritt erst hinterdrein
Im Dunkel wird mir wohler sein
Ich habe dieses enigmatische Gedicht immer gedeutet als das Zerbrechen des Dreizeitenraums und das Untergehen von Vergangenheit und Zukunft. Eine Gegenwart, die bleibt, wenn die Vergangenheit verblasst ist und die Zukunft dunkel, hat für den Wanderer keinen Wert mehr.
Wenn wir im Ritual das Gefäß erkennen, das die drei Zeiten in einem Raum beherbergt und in diesem Raum unser Leben zu führen lernen, dann können wir, da bin ich sicher, auch auf politischer Ebene Berge versetzen. Ich würde aber nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass die Geschichte notwendigerweise die Namen der wirkmächtigsten Figuren auf die Titelseite druckt.
Paula Fünfeck. Oktober 2020