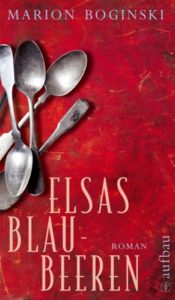Markus Ostermairs einnehmender Debütroman Der Sandler
von Nina Gretschmann und Steven Gabber
Es ist kein Geheimnis, dass im Umgang mit Obdachlosen die Würde des Menschen häufig mit zweierlei Maß gemessen wird. Die Schutzlosigkeit dieses Milieus setzt schwerwiegende Ausgrenzungsmechanismen frei, die Obdachlose häufig zum Opfer von pauschalisierender Abwertung, Feindseligkeit und Gewalt machen. Dass Obdachlose in der Bundesrepublik auch durch institutionelle Repressionen wie Platzverweise in Innenstädten oder Verbot des Pfandsammelns flankiert werden, verschärft diesen Umstand zusätzlich. Zugleich stellt sich die Frage, wie man Menschen in solch prekären Lebenssituationen wirklich unterstützen kann.
Der Autor Markus Ostermair versucht in seinem 2020 erschienenen Debütroman Der Sandler, das Problem an der Wurzel zu packen: Er gibt den Menschen, die allzu oft namenlos bleiben eine Stimme, indem er ihre Geschichten in den Mittelpunkt rückt. Mit von der Partie sind der Geschichtenerzähler Albert, der Zeitschriftenkünstler Norbert, ebenso Jürgen, der zwar aus wohlhabendem Hause stammt, sich aber aufgrund von Drogenproblemen von seinen Eltern abgekapselt hat. Mechthild, die trotz ihrer Obdachlosigkeit stets gepflegt aussieht, jedoch ständig mit sexueller Belästigung rechnen muss, gibt den Leser*innen einen konkreten Einblick in das Leben und die Probleme von weiblichen Obdachlosen. Der marxistische Pazifist Lenz macht seine selbstgewählte Obdachlosigkeit zum Teil seiner politischen Prinzipien, wenn er seinen eskapistischen Lebensstil als freiwilliges Exil vom Kapitalismus begreift. Das Zentrum bildet jedoch Karl Maurer – einst Ehemann, Vater einer kleinen Tochter und Mathematiklehrer von Beruf – jetzt der Obdachlose mit der nicht zu übersehenden Narbe im Gesicht, die ihn für die anderen zum „Barometer-Karl“ macht.
Durch dieses Perspektivenpanorama führt Der Sandler die Leser*innenschaft an die Tische der Münchner Bahnhofsmission, dem Bonifaz oder in die Teestube. Man wird mitgenommen auf Münchens Straßen, in die Parks entlang der Isar und hinab in die U‑Bahnstationen. Es gibt keine Distanz zwischen den obdachlosen Figuren und den Leser*innen. Man wird Teil der Gruppe, wenn beim gemeinsamen Essen in der Benediktinerabtei über verrückte Erlebnisse und lustige Vorfälle berichtet oder über das solidarische Sozialverhalten von Pinguinen diskutiert wird.
Der Sandler zeigt, dass häufig hinter einer obdachlosen Person ein schwerer Schicksalsschlag liegt. Bekannte Vorurteile gegenüber Obdachlosen werden im Sandler nicht bestätigt. Vielmehr wird darauf hingewiesen, dass viele Menschen, die auf der Straße leben, etwas so schwerwiegendes erleiden mussten, dass es für sie unmöglich ist, normal in der Gesellschaft weiterzuleben und zu bestehen. Die Flucht in den sozialen Abstieg ist oftmals die einzige Möglichkeit, den traumatischen Erlebnissen zu entkommen. Die kaleidoskopischen Einblicke in Vergangenheit und Gegenwart der Figuren vermitteln das anspruchsvolle Bild eines hochkomplexen Milieus, das keineswegs homogen, sondern von individuellen Geschichten geprägt ist.
Der Roman ist dabei alles andere als voyeuristisch. Die Erzählinstanz begegnet den Figuren mit Respekt und Unvoreingenommenheit und stellt die Würde jedes Einzelnen in den Mittelpunkt. Anstatt wertender Maßstäbe psychologisiert die Erzählinstanz mit geradezu analytischem Eifer das Verhalten der anspruchsvollen Charaktere, fern von Kitsch und Klischee. Damit richtet sich der Roman insbesondere gegen eine Rhetorik des herablassenden Mitleids und gleichzeitig gegen eine blinde Heroisierung oder Romantisierung des Lebens auf der Straße. Vielmehr geht es um die konkreten lebensweltlichen Probleme eines marginalisierten sozialen Milieus. Die Hoffnungslosigkeit, die innere Zerrissenheit, die Schuld- und Reuegefühle der Figuren sind mehr als deutlich zu spüren. Auch vor der schroffen Brutalität und Kriminalität macht die Erzählinstanz nicht Halt, was mitunter zu affektgeladenen Stolpersteinen im Lesefluss führen kann. Der Sandler ist somit keine einfache Lektüre und definitiv nichts für Zartbesaitete. Dennoch ist es ein wichtiger Beitrag zu einem ethischen Diskurs, den Ostermair mit seinem Debütroman leistet. Für die Leser*innen gibt es daher kein betretenes Wegschauen, kein Distanzieren. Man muss hinsehen, die Obdachlosen in ihrem Alltag begleiten, um zu begreifen, dass Obdachlosigkeit – ein Leben auf der Straße – vor niemandem Halt macht.
Die ethische Relevanz im Umgang mit obdachlosen Menschen ist unbestreitbar und jeder, egal auf welcher Seite des Pappbechers, profitiert von einem gestärkten Bewusstsein für diese Problematik. Wie gravierend die gesellschaftlichen Diskriminierungsmechanismen sind, wurde mir zuletzt Anfang Februar zuteil. Damals klopfte mein Nachbar eines Morgens unangekündigt an meine Tür und bat mich, ihm kurz in den Keller zu folgen. In die Dunkelheit sprach er zwei Mal ein kurzes Hallo, ehe sich ein Mann unter der Treppe hervorschob. Es dauerte nicht lange und die Hausverwaltung hatte davon erfahren und sofort veranlasst, dass fortan in roten Lettern auf laminiertem Papier „Zutritt für Unbefugte verboten.“ – „Bitte Türe geschlossen halten. Gefahr!“ auf der Eingangstüre zu lesen war. „Ja, auch wenn man bei diesen Temperaturen Mitleid haben könnte“, hieß es an alle Mieter*innen. Sollte man der Person im Gebäude begegnen, sei unverzüglich die Polizei wegen Hausfriedensbruchs zu alarmieren. (Die Schilder hängen immer noch.)
Ohne die moralische Keule zu schwingen, bietet Ostermairs Roman seinen Leser*innen eine hilfreiche Gelegenheit zum Perspektivenwechsel und zeigt auf, dass Obdachlose ein Teil unserer Gesellschaft sind.
Markus Ostermair, Der Sandler, 371 Seiten, Osburg Verlag, 22,00 €.