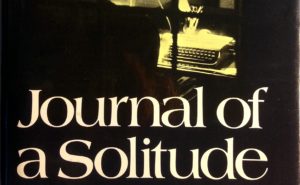Zwischen tiefenzeitlichem Ambiente und Terraforming könnte es künstliche Landschaften geben, die Ausgänge aus den entzündeten Aporien der Gegenwart ermöglichen. Joshua Groß denkt darüber nach, ausgehend von A Japanese Horror Film von Chester Watson, Reise zum Mount Tamalpais von Etel Adnan und Altiplano von Malena Szlam.
von Joshua Groß
A Japanese Horror Film von Chester Watson
2018, als es mir schlecht ging (aus Gründen, die gerade nicht wichtig sind), veröffentlichte Chester Watson das dunkle und sich düster voranschleppende Project 0 und es hat mich getröstet – weil meine eigenen Stimmungen darin wiederhallten; weil Musik dem Empfinden oft homogen zur Seite steht. Chester Watson sagte damals in einem Interview, dass er für Rap eine ähnliche Bedeutung haben wolle wie Jimi Hendrix sie für die Rockmusik hatte. Das imponierte mir. Im Herbst 2020, an Halloween, erschien A Japanese Horror Film – ein autofiktionales, psychedelisches Konzeptalbum, das Songs und hörbuchartige Sequenzen verbindet. Ich habe es schon viele Male gehört. Was ich verstanden habe, ist u.a. Folgendes.
Robert Walser schreibt in Das Traumgesicht: „Bald war der Raum, was er war, bald wieder war er ein Gedanke, so zart, daß der, der ihn dachte, fürchten mußte, er verliere ihn. Ist nicht immer der verloren gegangene Gedanke der schönste?“ Chester Watson imaginiert sich in diesen traumhaften, schwankenden Raum, der seine Formen verändern kann; wo sich das Bewusstsein loszulösen scheint, wo sich verschiedene Dimensionen berühren, wo trippige Erzählungen entstehen. Wie Etel Adnan schreibt: „Aber wir brauchen uns nicht von der Stelle zu rühren. Das Wahrnehmen selbst wird zur Bewegung.“
Will man die Handlung von A Japanese Horror Film nacherzählen, geht es in etwa so: Chester Watson fliegt nach Japan – ein fiktionales Japan, durchsetzt von Folklore und Animes und New Age-Einflüssen: ein paranormales, esoterisches Ambiente. Am Airport steigt Chester Watson, der sich selbst als „Monotone Samurai“ bezeichnet, high in ein Taxi (in welcher Stadt, wissen wir nicht); als er auf dem Rücksitz Platz genommen hat, bekommt er von einer Porzellan-Geisha lilafarbenes Gift zu trinken; die Realität wird durchlässig. Verschiedene Geister, Yokais, flüstern von Verheißungen und wirken auf den Erzähler mit runtergepitchten Stimmen ein, immer wieder flackert ein unheimliches Lachen auf. In einem vernebelten, aggressiven Zustand mentaler Entrückung begegnet er schließlich Veerie, die zu seiner spirituellen Führerin wird und ihm zeigt, wie er durch Astralprojektion nach Atlantis reisen kann. Obwohl er es unbedingt schaffen will, scheitert er immer wieder. Dann, nach mehreren Versuchen, gelingt es ihm endlich, nach Atlantis zu gelangen – und er trifft auf die Herrscherin der versunkenen Stadt.
In seinem Buch Das Seltsame und das Gespenstische schreibt Mark Fisher: „Die Perspektive des Gespenstischen eröffnet uns die Kräfte, die unseren Alltag regieren, die aber normalerweise verborgen sind, so wie es uns auch Zutritt zu Räumen jenseits des Alltäglichen überhaupt gewähren kann. Es ist diese Entlassung aus dem Alltäglichen, diese Flucht aus dem, was wir gewöhnlicherweise für die Realität halten, die ein Stück weit den eigentümlichen Reiz des Gespenstischen erklärt.“ Nach Fisher bezieht sich das Gespenstische immer auf das Unbekannte; beispielsweise, wenn unsere Aufmerksamkeit ohne erkennbaren Auslöser provoziert wird, von außerhalb der Kausalitäten quasi; als würde ein Jenseitiges an uns rühren vielleicht.
Aber es gibt kein Jenseitiges; wir sind nur zu verstiegen in das, was wir gewöhnlicherweise für die Realität halten. Das Alltägliche, es scheint für Fischer das Gewohnte zu sein, das Geronnene, das immerzu Gerinnende – das, worauf wir uns meistens beschränken. Darüber setzt sich Chester Watson hinweg. Und sobald das passiert ist (auf mehreren Ebenen: die fiktive Reise nach Japan, dort die geisterhaften Begegnungen, die Astralprojektionen), beginnt ein Wegdriften in traumhafter, verschwommener Präzision; eine andere, tieferführende Offenheit wird möglich. Plötzlich tritt ein, was Marcus Steinweg denkt: „Die Realität ist selbst gespenstisch. Sie zerfällt vor dem genauen Blick. Ihre Konsistenz löst sich auf.“ Insofern lässt sich das Wirkliche in der Umnachtung anders ausloten: dadurch, dass Chester Watson eine künstliche Distanz aufbaut, indem er dem Alltäglichen entflieht, entbindet er sich teilweise von seiner Eingebundenheit ins Realitätsgefüge, allerdings ohne den Verstand zu verlieren. Man könnte folgern: autofiktionales Schreiben ist wie Astralprojektion im Wachzustand.
Ich muss an Georg Christoph Lichtenberg denken, der geschrieben hat: „Die Erfindung der wichtigsten Wahrheiten hängt von einer feinen Abstraktion ab, und unser gemeines Leben ist eine beständige Bestrebung, uns zu derselben unfähig zu machen; alle Fertigkeiten, Angewohnheiten, Routine, bei einem mehr als bei dem andern, und die Beschäftigung der Philosophen ist es, diese kleinen blinden Fertigkeiten, die wir durch Beobachtungen von Kindheit an uns erworben haben, wieder zu verlernen.“ Und vielleicht ist genau das gruselig: vielleicht fühlt es sich gespenstisch an, einmal ohne die blinden Fertigkeiten auskommen zu müssen, die man sich immerzu aneignet; eine umfassendere Wahrnehmung von Wirklichkeit mag sich anfühlen, als wäre man selbst außerhalb von Kausalitäten.
A Japanese Horror Film ist dramaturgisch teilweise wie eine Anleitung gestaltet – der Erzähler dringt in immer tiefere Schichten seiner Seelenlandschaften vor; in einer Rezension wurden die Geister, denen Chester Watson dabei begegnet, als NPC’s bezeichnet, also jene Figuren in Computerspielen, die nicht gesteuert werden können, mit denen man mitunter aber interagieren kann und die einem durch Hinweise und Tipps dabei helfen, Aufgaben zu bestehen oder Level zu lösen. Allerdings wird der Erzähler von Veerie nur so weit geleitet, bis er selbst dazu in der Lage ist, von seiner Eingebundenheit abzulassen und in Entrückung wegzudriften. Marcus Steinweg schreibt: „Die Ergebnisse des Denkens verändern den Denkenden. Er wird ein anderer, erkennt sich selbst nicht wieder, setzt sich der Krise des Selbstverlusts aus. Denken heißt, seine Gewissheiten zu prüfen. Der Denkende verlässt sein identitäres Gehäuse, um mit einem Außen zu kommunizieren, das ihn längst beherrscht.“ Die Kräfte, die unseren Alltag regieren, die NPC’s, das Außen. Auch das Verlernen kann zu Krisen führen – wenn die Echos der eigenen Schreie nach einer Weile aus einer ungewohnten Ferne zurückfinden; mit so viel Verzögerung, dass man erschaudert. Endet es überhaupt, das Unbekannte? Entsteht der Horror, von dem Chester Watson rappt, dadurch, dass er sich einer endlosen Sphäre überlässt, die völlig unabsehbar (wenn auch nicht unerkundbar) ist?
Und die eigene Angst, dass man dabei aufbrechen könnte und dann unter Umständen einfach zerstäuben. Aber auch das Verlernen kann man üben, flüstert dieses Album. Ich bin bereit dafür. Ich liege im Bett, an deren Fußende eine Lavalampe steht: ich schaue zu, wie das rote, flüssige, leuchtende Wachs seine Formen verändert, nierenförmig aufsteigt, in Kugeln sinkt, entzwei bricht, sich neu verbindet, schwebt, rotiert, verharrt, fällt. Ich finde es hypnotisch; es ist unmöglich aufzuhalten. Mein Hirn fühlt sich an als würde es in sich selbst zerfallen. Natürlich zerfällt es nicht. Trotzdem, es gibt so viel zu verlernen; wenn nicht mehr diese unendliche Energie ins Funktionieren fließt, wird Astralprojektion überhaupt erst möglich. Ich schaue noch immer in die Lavalampe. Da taucht wieder die Frage auf, ob nicht immer der verloren gegangene Gedanke der schönste sei …
Ungefähr an diesem Punkt spüre ich, dass es Sinn macht, noch einmal A Japanese Horror Film zu hören. Ich überlasse mich – und das Album beginnt: „Life wrote itself, we helped it …“

Joshua Groß, 1989 geboren in Grünsberg, studierte Politikwissenschaft, Ökonomie und Ethik der Textkulturen in Erlangen. 2019 erhielt er den Anna-Seghers-Preis, 2021 wird er mit dem Literaturpreis der A und A Kulturstiftung ausgezeichnet. Zuletzt erschienen der Roman Flexen in Miami sowie der Essay- und Erzählband Entkommen bei Matthes & Seitz Berlin.