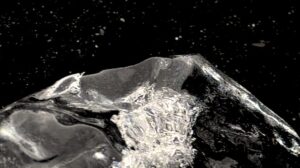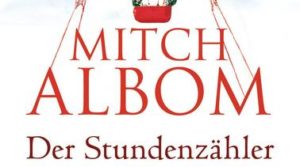Ein Gespräch mit dem Philosophen Wolfgang Welsch über Transkulturalität
von Christine Kleitsch, Julia Rössler und Lena Hübner
Der Begriff der Transkulturalität ist in den letzten 20 Jahren immer populärer geworden und versucht neue Beschreibungsansätze für die Kultur der Gegenwart zu finden, die sich vor allem durch Phänomene wie Globalisierung und Medialisierung auszeichnet. Der Philosoph Wolfgang Welsch, der diesen Begriff im deutschen Sprachraum eingeführt hat, hat im Rahmen einer Vorlesungsreihe zur Transkulturalität an der Universität Augsburg einen Vortrag zum Thema ‚Was ist eigentlich Transkulturalität’ gehalten. SCHAU INS BLAU hat ihn im Vorfeld zu einem Interview getroffen, um mit ihm über die Aktualität, Chancen und Grenzen sowie die ethische Ausrichtung von Transkulturalität zu sprechen.
SCHAU INS BLAU: Wir würden gerne mit einem Zitat von Ihnen einsteigen. In einem Ihrer Artikel sagen Sie: „Unsere Kulturbegriffe sind Korsette, die von unseren Kulturen gesprengt worden sind“(Welsch, Wolfgang. „Transkulturalität: Lebensformen nach der Auflösung der Kulturen“. S. 8). Sie plädieren für die Notwendigkeit der Rekonzeptualisierung des Kulturbegriffs. Inwiefern ist Ihrer Meinung nach dieser traditionelle Kulturbegriff in unseren Gesellschaften des 21. Jahrhunderts nicht mehr tragfähig?
WOLFGANG WELSCH: Als ich mich vor 25 Jahren mit Kulturphilosophie befasste, hatte ich den Eindruck, dass der Kulturbegriff, den wir haben, auf die heutigen Verhältnisse nicht mehr passt. Dieser Kulturbegriff war stark im Sinn von nationalen Kulturen geprägt: es gibt eine deutsche, eine japanische, eine russische Kultur und so weiter. Man nahm also eigentlich eine Gleichsetzung von Kultur mit Nation vor. Mein Eindruck aber war, dass dies für die zeitgenössischen Verhältnisse nicht mehr zutrifft. Zunächst wollte ich herausfinden, wo dieses obsolete Kulturkonzept eigentlich herkommt. Es stellte sich heraus, dass es aus dem späten 18. Jahrhundert stammt und maßgeblich von Herder propagiert wurde. Herder verstand Kultur als die Kultur eines Volkes. Sie sollte zum einen durch innere Homogenität bestimmt sein. Das bedeutet: Alle Angehörigen eines Volkes oder einer Kultur haben im Wesentlichen die gleichen Anschauungen und Praktiken – sie sind beispielsweise alle gottesgläubig, beten auf die gleiche Weise, so wie sie auf die gleiche Weise essen und schlafen und schwitzen etc. Die Kehrseite dieses inneren Homogenitätsgebots ist zum anderen die Annahme, dass die anderen Kulturen sich in allen wesentlichen Zügen von der eigenen Kultur drastisch unterscheiden. Bei Herder reicht das bis hin zu sehr massiven Äußerungen, dass man dem wirklich Anderen nur mit Verachtung und Ekel begegnen könne. Dieses Doppel von innerer Homogenität und externer Heterogenität führt also nicht zu einem Verständnis, sondern zu einer Abstoßung zwischen den Kulturen. Beides folgt aus dem Kugelmodell der Kulturen. Die Kulturen sollen so monolithisch und homogen sein wie eine Kugel es sein muss, um nicht zu zerfallen. Solche Kugelkulturen können aber dann einander gegenseitig nicht durchdringen oder verbinden, sondern können einander, wie Herder 1774 schrieb, “nur stoßen”. Das ist übrigens die Geburtsstunde des Theorems vom „clash of civilizations”. Dieses Kulturkonzept war vor 25 Jahren noch immer leitend und findet sich selbst heute noch vielfach, obwohl wir doch alle wissen, dass „Kultur“ ein sehr weiter und vielschichtiger Begriff ist. Clyde Kluckhohn, ein amerikanischer Soziologe und Ethnologe, und Alfred Kröber, ein amerikanischer Anthropologe, haben 1952 eine Liste der Kulturbegriffe erstellt und fanden heraus, dass es 164 unterschiedliche Kulturbegriffe gibt (Kroeber, Alfred und Clyde Kluckhohn. Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions. New York: Random House, 1952). Inzwischen sind sicherlich noch weitere hinzugekommen. Natürlich bestehen zwischen diesen Begriffen auch Gemeinsamkeiten, Überlappungen, Übergänge – sie sind, wie die Philosophen seit Wittgenstein sagen, durch Familienähnlichkeit verbunden. Aber die Vielfältigkeit ist überwältigend, wir sprechen beispielsweise von Jugendkultur, Stadtkultur, Esskultur oder auch einem Kulturbeutel – was ist da noch gemeinsam? Aber der alte, national oder nationalistisch geprägte Kulturbegriff will diese Vielfältigkeit wegschmelzen oder ausradieren.
SCHAU INS BLAU: Sind transkulturelle Gesellschaften nun vorherrschend im 20./21. Jahrhundert vorzufinden oder kann Transkulturalität historisch schon viel früher angesiedelt werden?
WOLFGANG WELSCH: Wenn ich an Kultur denke, ist für mich die kulturelle Identität von Individuen wesentlich. Mich interessiert, was ihren Lebensstil prägt, was ihnen wichtig ist, welche Wertvorstellungen sie haben, wofür sie sich einsetzen würden oder was ihnen gleichgültig ist. Wenn man sich mit dieser kulturellen Identität befasst, findet man heute allenthalben Mischungen und Durchdringungen. Die Identität heutiger Menschen ist aus kulturellen Einflüssen gebildet, die auch externe Quellen haben. Es ist nicht alles aus deutschen Wurzeln. Wir lesen italienische, amerikanische, vielleicht auch japanische oder südamerikanische Literatur, und in der Musik finden sich ebenso Einflüsse von überall her. Oder denken Sie an den Warenverkehr (exotische Artikel ganz selbstverständlich im Supermarkt) oder an die Migrationsprozesse: in jedem Land der Erde leben heute Angehörige auch aller anderen Länder dieser Erde. Diese Tendenzen zu Transkulturalität prägen die Gegenwart. Das rührt auch daher, dass die kulturellen Alternativen heutzutage sozusagen auf der Straße liegen beziehungsweise in den Medien allenthalben präsentiert werden. Die Leichtigkeit des Vertrautwerdens oder eines ersten Bekanntwerdens mit kulturellen Elementen anderer Herkunft ist ungleich größer als früher. Ein gutes Beispiel dafür ist die Popkultur. Man kann die Stars schon seit langem nicht mehr nach nationalen Gesichtspunkten sortieren. Insofern ist der European Song Contest mit seiner Anstachelung nationaler Emotionen hoffnungslos atavistisch.
Wenn man die Entwicklung historisch betrachtet, dann sehe ich die Bewegungen des Nationalismus im 19. und 20. Jahrhundert als einen Einschnitt in der Menschheitsgeschichte. Vorher herrschte eine sehr viel selbstverständlichere, wenn auch geringere, Transkulturalität als heute. Das wird zum Beispiel an der europäischen Kunstgeschichte deutlich. Die Stile waren länderübergreifend. Die Künstler übernahmen auf Reisen Vorbilder aus anderen Ländern. Man war transkulturell. Natürlich gab es politisch im Laufe der Geschichte auch immer wieder Absetzungen – die Griechen gegen die Perser und dergleichen – aber dabei hat man doch auch immer wieder kulturelle Güter aus anderen Ländern übernommen. Oder denken Sie an Alexander den Großen. Er hat in Persien 10.000 seiner Soldaten mit dortigen Frauen verheiratet, weil ihm klar war, dass ein einheitliches Reich Begegnung und Mischung der Völker erfordert. Nicht der Besatzer, sondern der Verwandte ist auf Dauer erfolgreich. In vielen Kulturkreisen galt früher, dass die Völker, Kulturen und Mentalitäten sich nicht einfach gegeneinander abschotten, sondern miteinander verbinden sollen. Der Nationalismus des 19, Jahrhunderts stellt gegenüber dieser früheren Internationalität oder Transkulturalität einen eklatanten Einbruch dar. Heute hingegen sind wir – trotz mancher Gegenbewegungen – wieder auf dem Weg zu mehr Transkulturalität der Gesellschaften wie der Individuen.
SCHAU INS BLAU: Sie haben gerade die Gegenbewegungen angesprochen. Vielleicht können wir an dieser Stelle auf das aktuelle Geschehen in Deutschland eingehen. Wie sind Ihrer Meinung nach die aktuellen Debatten um die Angst vor Überfremdung – Stichwort „Pegida“ – zu bewerten?
WOLFGANG WELSCH: Da herrscht eine große Diskrepanz. Es gibt reale Ängste, aber dass diese Ängste sich als Ängste vor einer Islamisierung artikulieren, ist grotesk! Mit realen Ängsten meine ich die Angst vor dem sozialen Abstieg. Die heutigen Arbeitsverhältnisse lösen im Verhältnis zu früher allenthalben Unsicherheit aus. Viele Menschen brauchen mehrere Jobs, um über die Runden zu kommen. Das bedeutet oft eine riesige Beanspruchung. Da ist nur zu gut verständlich, dass viele Menschen sich um ihre Zukunft, ihre Familie oder ihre Altersversorgung große Sorgen machen. Man bedenke auch, dass in Deutschland die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinander klafft. Es gibt also höchst verständliche ökonomische Ängste. Völlig abwegig aber ist es, diese mit einer Islamisierung in Zusammenhang zu bringen. Unter Bedrohung reagieren Menschen oft steinzeitlich. Man sucht sich einen Sündenbock. Dieses Muster kennt jeder von uns. Und heute gibt es zwar eine berechtigte Furcht vor Islamismus und islamistischem Terror, aber die eigenen Probleme nun mit einer “Islamisierung” zu amalgamieren, ist abwegig. Die Zahlen zeigen das eindeutig. Wo Pegida stark ist, leben ausgesprochen wenige Moslems! – Was kann man gegen solche Bewegungen tun? Aufklären, aufklären, aufklären – und die zugrunde liegenden sozialen Probleme wirklich angehen.
SCHAU INS BLAU: Die Angst vor „Überfremdung“ scheint ein interessanter Aspekt, gerade im Hinblick auf den von Ihnen beschriebenen in sich transkulturellen Menschen zu sein, Sie sprechen von „Patchwork-Identitäten“ und „Cross-Culture-People“. Zeigt das nicht, dass Menschen die Begegnung oder Konfrontation mit dem Fremden auch als solche empfinden und sogar Angst vor einer Umwälzung des eigenen Wertesystems haben, dass sie das Fremde sehr dominant als fremd wahrnehmen?
WOLFGANG WELSCH: Die französische Psychoanalytikerin Julia Kristeva hat vor etlichen Jahren ein Buch mit dem Titel Étrangers à nous-mêmes – Fremde sind wir uns selbst publiziert. Da sagt sie erstens, dass Hass gegenüber Fremden meist projizierter Selbsthass ist: Am Fremden lehnt man stellvertretend etwas ab, was man selber in sich trägt, aber nicht zulassen mag. Und zweitens stellt sie fest: Um offen zu sein für Fremde, um Interesse an der Andersartigkeit des Anderen zu haben, gibt es eine Voraussetzung: Man muss selbst einmal im Leben den Boden unter den Füßen verloren haben. Wer immer saturiert war und nie eine Erschütterung erlebt, einen Bruch verspürt hat, der hat keine guten Voraussetzungen, um mit Fremden als Fremden umzugehen, sondern der wird das Fremde ablehnen.
SCHAU INS BLAU: Sie sprechen von einer Erschütterung. Halten Sie es für erstrebenswert, dass eine solche gezielt herbeigeführt wird oder wie könnte das in der Praxis aussehen?
WOLFGANG WELSCH: Ich bin natürlich nicht dafür, sie gezielt herbeizuführen. Es wäre ja schrecklich, wenn nur Kinder, die einmal traumatisiert wurden, gute Erwachsene werden könnten. Lassen sie uns eine andere Möglichkeit erwägen. Irgendwann muss man in der Schule ja die Frage der religiösen, der ethnischen, der kulturellen Pluralität angehen. Wenn man das ohne Vorbehalte tut, wird es dazu kommen, dass Selbstverständlichkeiten erschüttert werden. Wenn man die Schüler aufschreiben lässt, was ihnen kulturell wichtig ist, dann wird man nachher feststellen können, dass ihre Antworten gar nicht den nationalen Stereotypen entsprechen. Wenn die anderen Schüler raten sollen, wer diese und wer jene Präferenzlisten aufgeschrieben hat, werden sie bemerken, wie oft sie falsch liegen – dass die Stereotypen, mit den individuellen Befindlichkeiten verglichen, einfach nicht stimmen. Das kann scheinbare Sicherheiten auflösen und die Bereitschaft wecken, sich wirklich auf die Individuen einzulassen, statt sie von vornherein national abzustempeln.
SCHAU INS BLAU: Transkulturalität kann man als deskriptiven Begriff auf der Makroebene erfassen, aber auch als etwas, was auf der Mikroebene stattfindet.
WOLFGANG WELSCH: Das ist für mich der entscheidende Punkt. Meine Hauptpredigt lautet: Nehmt die Individuen als Individuen und nicht als Vertreter einer Nation, schaut euch die Damen und Herren als Individuen an und nicht als Engländer oder Franzosen.
SCHAU INS BLAU: Inwieweit meinen Sie, dass durchaus Räume entstehen können, in denen man ohne diese Abgrenzungen denken kann? Es scheint uns doch schon so, dass in vielen Bereichen die Kategorie von Abgrenzung dominiert.
WOLFGANG WELSCH: Was für eine Art Abgrenzung meinen Sie?
SCHAU INS BLAU: Jegliche Art eigentlich. Zur kurzen Erläuterung: In einer Vorlesung, die Frau Prof. Dr. Waldow (Neuere deutsche Literarturwissenschaft mit dem Schwerpunkt Ethik) zum Thema „Transkulturalität“ gehalten hat, wurden von Studierenden verschiedene Phänomene vorgestellt, die Transkulturalität im Alltag aufzeigen, zum Beispielbei Dekoration, Essen, Tanz oder Literatur. Dabei wurde häufig festgestellt, dass es trotz transkultureller Komponenten immer auch zu Abgrenzungen kommt, oder wo transkulturelle Prozesse das Resultat von historischen Machtverhältnissen waren.
WOLFGANG WELSCH: Bevor wir uns dem fruchtbaren Kern nähern, möchte ich zunächst sagen, dass Unterscheidungen natürlich notwendig sind. Unterscheidungen schließen auch Abgrenzungen ein. Auch unter transkulturellen Bedingungen bleibt es vielleicht dabei, dass die nationalen Stereotype immer wieder mal hervorlugen. Dagegen ist nichts zu sagen, solange es nicht zu krassen Hochwertungen oder Abwertungen führt, gar in Verbindung mit Machtverhältnissen. Es gibt aber eben auch ein unschuldiges Bemerken oder Hervorheben von Nationalfärbungen. Dass man auch mal in frotzelnder Weise jemanden auf etwas aus seiner Kultur festlegt, das ist – solange man sich untereinander versteht – in Ordnung. Voraussetzung ist natürlich, dass beide Beteiligte über sich lachen können.
SCHAU INS BLAU: Gehen wir noch einmal auf den deskriptiven Aspekt ein.Sie sagen, dass unser Kulturverständnis ein wichtiger Wirkfaktor in unserem Kulturleben ist und sprechen von verantwortungsvollem Umgang mit Kulturbegriffen. Inwieweit haben Sie in Ihrem Konzept auch normative Aspekte angelegt?
WOLFGANG WELSCH: Transkulturalität war zunächst deskriptiv gemeint. Die Idee war: Der alte Kulturbegriff passt nicht mehr, also entwickle ich einen neuen, der deskriptiv auf die zeitgenössischen Verhältnisse passt. Aber Kulturbegriffe sind nie einfach neutrale oder unschuldige, sondern immer zugleich normative Begriffe. Sie haben Einfluss auf die Realität einer Kultur. Sie können diese verändern. Deshalb muss man mit Kulturbegriffen verantwortungsvoll umgehen. Wenn sie mich nun fragen, welche normative Vorstellung meiner Bevorzugung des Transkulturalitätskonzepts gegenüber dem von Nationalkulturen zugrunde liegt, so ist die Antwort einfach: die Normativität der Menschenrechte – wie sie in der europäischen Geschichte erkämpft wurden und mittlerweile immer mehr weltweite Anerkennung finden.
SCHAU INS BLAU: Sie haben von der Freiheit für Bürger gesprochen, das impliziert ja auch eine Wahl der Religion oder Sexualität. Nun ist es aber faktisch so, dass es in vielen Teilen der Welt diese Wahl für einzelne Individuen nicht gibt.
WOLFGANG WELSCH: Aber immer mehr…
SCHAU INS BLAU: …Ja, natürlich, aber das ist immer noch ein großes Problem! Ist es so, dass transkulturelle Phänomene eher auf den westlichen Teil der Welt begrenzt sind, auf Europa, oder können Sie das auch global festmachen?
WOLFGANG WELSCH: Zunächst ist Transkulturalität stärker in den westlichen und wohlhabenden Nationen ausgeprägt. Aber wenn sie zum Beispiel China betrachten, so handelt es ich um ein Land, das immer mehr Wohlstand gewinnt, aber nicht westlich ist. Und doch dringt auch in China Transkulturalität stark vor. Und wenn wir nun einen Schritt weiter gehen: in ein ganz armes Land, die Mongolei, dann wird zwar niemand behaupten wollen, Transkulturalität sei dort gleich stark ausgeprägt wie bei uns. Trotzdem hält sie auch dort Einzug. Es wäre schwierig, heute noch Flecken auf der Welt zu finden, die davon ganz unberührt sind. Wobei freilich hinzugefügt werden muss: Zum Teil hat dies auch dubiose Gründe – die kapitalistische Dynamik, Ausbeutung, Verarmung, Migration. Denken Sie beispielsweise an die von der westlichen Industrieproduktion induzierten Klimaveränderungen in Afrika, wodurch fruchtbare Striche zu Steppen werden, was dann Migrationsbewegungen auslöst – gegen die Europa dann wieder seine Grenzen dicht machen will.
SCHAU INS BLAU: Hat der Mensch Ihrer Meinung nach nicht auch das Bedürfnis nach Orientierung, festen Werten oder auch bestimmten gesellschaftlichen Schemata, die orientierungs- und stabilitätsgebend wirken? Wie würden Sie dabei die Rolle der Ethik einschätzen? Wo würden Sie die Ethik verorten? Nur noch im Individuum?
WOLFGANG WELSCH: Nein, sondern in der Menschheit: Das Individuum soll die ethischen Maximen natürlich realisieren, aber es soll sie nicht erfinden. Ich bin nicht dafür, dass jeder seine eigene Ethik entwickelt. Wir brauchen eher eine universale Ethik, die eng zusammenhängt mit Menschenrechten, Feminismus und Ökologie – was zwar Maximen sind, die aus der westlichen Tradition kommen, aber doch auch eine enorme weltweite Strahlkraft und Überzeugungskraft haben. Die Grundbedürfnisse der Menschen – Nahrung, Gesundheit, aber auch Anerkennung – sollten eine zentrale Rolle spielen. Und universale Aspekte wie Respekt vor dem Lebendigen, Eintreten für die Mitmenschen, Hilfe in der Not, Anerkennung von Personen in ihrer Einmaligkeit und Würde sollten ebenfalls zu den ethischen Maximen der Menschheit gehören – brauchen wir da noch bayerische Fahnen?
SCHAU INS BLAU: Abschließend würden wir gerne kurz auf Transkulturalität beziehungsweise Transdisziplinarität im Akademischen Bereich zu sprechen kommen. Sie haben immer wieder von ihrer Arbeit an der Universität berichtet und jetzt interessiert uns, als Studierende eines interdisziplinären Studiengangs, wie Sie die zukünftigen Entwicklungen in der Wissenschaft sehen und bewerten, was zu wünschen wäre und wie Sie die Durchführbarkeit und Umsetzung von transdisziplinären Ansätzen einschätzen?
WOLFGANG WELSCH: Bereits seit Anfang der 1990er Jahre habe ich versucht, in der Lehre transdisziplinär zu arbeiten, was damals noch äußerst schwierig war. Anhand konkreter Themenkomplexe (Postmoderne, Tierethik etc.) ging es darum, in gemeinsamen Seminaren mit Lehrenden aus anderen Fächern die Studierenden erfahren zu lassen, dass diese Themen und Probleme sich nicht an Fächergrenzen halten, sondern disziplinenübergreifende Bearbeitung erfordern. Später konnte ich in Forschungsverbünden mit Kollegen aus anderen Disziplinen (Neurobiologie, Psychologie, Paläoanthropologie etc.), die ebenfalls an Problemclustern interessiert waren, transdisziplinär arbeiten. Wichtig scheint mir, dass Studierende zumindest gelegentlich (aber curricular verankert) an transdisziplinären Kursen teilnehmen.
SCHAU INS BLAU: Auch in unserem Studiengang ist die Begegnung und gemeinsame Diskussion der beteiligten Disziplinen ein wichtiger Grundstein des Studiums. Dennoch ist es doch so, dass die Disziplinen nach zusammen gestalteten Seminaren wieder in ihre eigenen Bereiche zurückkehren. Inwieweit meinen Sie, könnte Transdisziplinarität darüber hinausgehen und wie würde das aussehen?
WOLFGANG WELSCH: Man darf die Disziplinen natürlich nicht auflösen, sie haben ein Spezialwissen, das unbedingt notwendig ist. Insofern ist das Erlernen des Handwerks und des Grundwissens der einzelnen Disziplinen unverzichtbar. Eigentlich müsste man die Struktur der Studiengänge ändern: z. B. zwei Semester disziplin-orientiert studieren und dann ein Semester transdisziplinär arbeiten. Gut, wir Philosophen hinterfragen ja ohnehin alles. Ich sehe aber auch, dass die Einrichtung transdisziplinärer Veranstaltungen im Gefolge des Bologna-Prozesses und der zunehmenden Parzellierung und Verschulung des Studiums immer schwieriger wird. Wohl den Lehrenden und Studierenden, die da kluge Auswege finden!
SCHAU INS BLAU: Herr Welsch, wir danken Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch.

Wolfgang Welsch, Jahrgang 1946, ist emeritierter Professor der Philosophie und lebt in Berlin.
Er lehrte an den Universitäten Bamberg, Magdeburg und Jena. Dazu zahlreiche Gastprofessuren, u.a. an der Humboldt Universität Berlin und der Stanford University. Seine Forschungsschwerpunkte sind Anthropologie und Epistemologie, Theorie der Evolution, Philosophische Ästhetik und Kunsttheorie, Kulturphilosophie und Philosophie der Gegenwart. Er erwarb sich vor allem durch seine zahlreichen Veröffentlichungen zur Postmoderne, zur Ästhetik, zur transversalen Vernunft und zur Transkulturalität einen Namen. Er ist Preisträger des Max-Plack-Forschungspreises (1992).