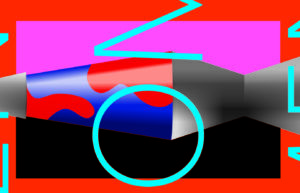© 2021 SANDMÄDCHEN. COPYRIGHTS BY WORKLIGHTS MEDIA PRODUCTION / MICHEL
von Veronika Raila
Vater und Mutter, Eigentumswohnung mit Garten und Pool gekauft, Tagesmutter engagiert, Baby zur Welt gebracht. Bis jetzt läuft alles wie geschmiert.
Baby war aus Sand, großer grobkörniger Sand, konnte man nicht anfassen, weil man Angst hatte, das Wenige, was es zusammenhält, bröselt auseinander. Der Sand schrie, es gab nur Tränen, die den zerbröselten Sand wieder zusammenbuken, in der Hitze der Nacht.
Erstes Gespräch: „Was haben sie da in der Schwangerschaft gemacht?“ Negredo — schwarz wie die Nacht, tiefes Fallen, niemals aufschlagen, niemals.
Nächstes Gespräch: „Sieht nur so aus, als ob Kind aus Sand wäre, ist aber nicht so.“ Licht, helles Licht. Steigen.
Gespräch: „Kind wird meiner Meinung nach nur im Rolli sitzen und Augen verdrehen“. Schwarz wie die Nacht, Abbruch.
„Wo ist Licht, wo wenigstens Feuer um sich daran zu wärmen, um aufzutauen?“
„Liebe Mama, siehst du mich denn nicht, siehst du nur den Sand, bitte grabe, grabe, grabe nach mir, ich habe mich nicht versteckt, ich liege unter dem Kies. Suche mich, suche mich.“
Truskawetz: Farben, Formen, Gerüche vermengen sich zu einer Einheit, der Professor ringt mit dem Sand auf meiner Oberfläche. Das Feuer tritt aus, er bringt es zum Brennen, zuerst lichterloh, dann schwächt sich die Flamme ab, aber sie brennt auch in mir. Ich kann gefunden werden, der Feuerschein erhellt die Nacht.
Liege auf dem Bauch. Spastisch betonte Athetose, Bauch tut weh, aber Licht kommt ins Dunkel. Licht, auf dass man mich finden möge, finden kann.
Da wo das Kraut wächst komme ich zur Ruhe – Filderhausklinik — nicht ganz so herb, aber Ruhe, die Stürme um mich herum legen sich, begeben sich zur Ruhe.
Der Kopf wird klarer, ich kann durchatmen, erkenne mich, zwar dunkel, aber die Umrisse sind da.
Jemand, eine dicke, dunkle Tonne sagte: „Brr, igitt! Das Kind ist eine Nullnummer, ist Sand wird immer Sand bleiben, nichts zu machen, außer als Sanduhr“.
Leitung nach außen fast verloren, aber da kommt Mama ins Spiel, eine vor Wut schäumende, eine riesige Büffelherde vor sich hertreibende, herzreibende Mama, die selber glüht, pflügte sich den Weg zu mir durch. Sie kam an!
Dieser Moment war der glücklichste in meinem Leben. Mama schaffte es. Durch den Sand durchzukommen und mir das Schreiben beizubringen. Wir kämpften beide, jeder auf seine Weise. Ich sorgte dafür, dass sich Wörter in Buchstaben verwandelten, die dann einzeln auf meinem Arm hinunterspazieren konnten, in die Finger flossen und auf dem Papier landeten. Mama sorgte dafür, meinen Impulsen Raum zu geben. Zeit gab sie mir, meinen Tonus, naja besser gesagt, meine Toni in den Griff zu bekommen. Licht war jetzt da, die Dunkelheit wurde erhellt, ich hatte zwar noch eine undeutliche, aber schon sehr wahrnehmbare Kontur. Jetzt erst bemerkte ich eine gewisse Weichheit im Ausdruck, eine Leichtigkeit und Eleganz.
In der Schule mutierte diese Eleganz wieder zu einem Stakkato. „Du nehmen Stift in Hand – du können das nicht – Kind ist dumm“. Dunkelheit um mich rum.
Aber am Abend stieg der silberne Mond wieder zum Himmelszelt hinauf, sanfte Töne erklangen, die Musik kündete von einer Zeit, als noch Ritter, Burgfräulein und Alchimisten die Köpfe der Schreiber inspirierten, von einer Zeit, die Begriffe wie Treue, Ehre und die Liebe noch hoch hielten. Am Tag war es Dunkel wie in der Nacht, abends stieg dann die Sichel des bleichen Mondes zu mir herab und leuchtete mein Antlitz.
Anderen lachte ich tagsüber ins Gesicht, mit der Überlegenheit des Narrenkappenträgers.
Sind Narren nicht die sehenderen Menschen? Narren sind Verrückte und Verrücker in einer Person. Narren ist bewusst, dass sie eine andere Sichtweise auf Erscheinungen haben, drücken sie dieses aus, verrücken sie damit auch die Sichtweise der anderen. Sie wissen, dass sie einen Mangel haben, durch diesen Mangel sind sie prädestiniert, Dinge anders zu sehen, einen anderen Blickwinkel einzunehmen. Ihre Realität ist nicht die der so genannten „Normalen“. Sie sehen vielmehr einen anderen Ausschnitt aus der Wirklichkeit, leider war mir dies damals noch nicht bewusst. Deshalb lagen pausenlos Fragen in der Luft – keine Antwort bekommen, weder die Anderen, noch ich, da die Zeit immer noch sehr finster war.
Auf Sand kann man gut barfuss laufen – mit Öl funktionieren nur Maschinen gut.
Szenenwechsel. Neue Schule – neues Glück.
Die Tage wurden so hell wie die Nacht. Es war ein wunderbares Gefühl dazuzugehören, bis die schwarze Tonne wiederkam und sprach: „Kind muss können selbstständig mit Computer schreiben, sonst zurück zu alter Schule“. Dieses Schwarz klammerte mich, zog mich hinab, auf den Grund eines vergessenen Brunnens.
Allerdings hatte niemand mit der Kraft meines Schutzengels gerechnet. Dieser Gabriel hatte ein silbriges Gewand, ein flammendes Schwert und eine Durchschlagskraft von vielen galaktischen Einheiten.
Ich kam auf das Gymnasium. Dort wurde meine sandige, teilweise schon versteinerte Oberfläche Stück für Stück, nein besser Körnchen für Körnchen abgerieben. Da bin ich zu mir gekommen, habe selbst geholfen, die Haut zu waschen, und an der lauen Sommerluft trocknen zu lassen.
„Früher warst du der Sand im Getriebe, heute bist du der Sand, auf dem ich gut barfuss laufen kann, es ist, als ob ich nach China gehe, jetzt aber dafür einen immerwährenden Sandstrand habe.“
Eigentlich spüre ich hier meinen Körper zum ersten Mal richtig gut. Ich konnte mich in ihm ausdehnen. Ich war angekommen in der Mitte der Klasse, war kein Außenseiter mehr. Langsam kam Eos mit ihren rosigen Fingern, lockte mich weiter zu gehen, weiter, immer weiter, bis der Morgen anbricht.
Und die Morgenfrühe, das ist meine Zeit,
wenn die Winde um die Berge singen,
denn die Sonne macht dann die Täler weit,
und das Leben,
ja das Leben …
Das Leben ist eine wunderbare Sache, wenn man es leben kann. Und man überlegt, wie man die Morgenröte, das Versprechen des Lebens, festhalten kann. Ich halte die rosigen Finger der Eos fest, lasse sie nicht mehr los. Das Leben ist ein Versprechen, ein Versprechen zwischen dem Schicksal und der Wirklichkeit. Das Schicksal verspricht eine Erlösung in der Wirklichkeit, wir dürfen unser Schicksal austrinken aus dem Becher der Hoffnung, für manche sieht mein Becher deutlich nach Schierling aus, es sieht aber nur eventuell so aus, er ist es nicht.
Aber was wird aus euch? Maschinen, nur Maschinen benötigen Öl. Ich muss meinen Sand abklopfen, um in mein Leben zu treten. Was macht ihr mit dem Sand, den ich überall verstreue? Findet Ihr ihn? Baut ihr ihn ein, oder stört er nur eure Funktion? Im schlüpfrigen Getriebe des Menschseins mutieren viele zu Stahl, am besten V2A — Stahl, für das immer währende Räderwerk. Es muss am Laufen gehalten werden, immer laufen, für manchen ist die Richtung egal. Klack, klack, ein Zahn fällt auf den anderen, ein Zahn treibt den anderen voran, oder vor sich her. Also kann ein Zahn alleine nichts vorantreiben, nur in der Menge kommt die Maschinerie der modernen Gesellschaft ins Laufen, entwickelt sich von Menschen zu einem Konglomerat aus Leibern, die durch das Vorantreiben aufeinander gepresst und gequetscht werden, so dass kein Hauch Leben mehr dazwischen passt.
Ich werde wieder zu Sand, wenn ich auf dem verdrehten Tisch liege, und der Totengräber eine Schaufel Erde auf mich legt. Auf meinem Stein steht dann geschrieben:
„War aus Sand, wurde wieder dazu“.
Dieser Text wurde für den Bayerischen Rundfunk anlässlich des Autorenwettbewerbs der Redaktion “on3” 2010 geschrieben und erhielt den 1. Preis.

Veronika Raila, 1992 in Augsburg geboren musste schon immer alles aufschreiben, was sie zu sagen hatte. Nach einer verkürzten Gymnasialzeit fing sie an der Uni Augsburg an, Neuere deutsche Literaturwissenschaften und katholische Theologie zu studieren. Bald gab es auch erste Veröffentlichungen und Preise für ihr Schreiben (Medienecho & Preise). Nach der Bachelorarbeit widmete sie sich voll und ganz ihrem autobiographischen Film „Das Sandmädchen“, der Preise in der Kurzversion und einige in der Langversion (Sandmädchen – Ein Dokumentarfilm von Mark Michel und Veronika Raila) erhielt. Danach kehrte sie an die Uni zurück, um ihre Studien fortzusetzen. Literarisch sind ihre Arbeiten meist im phantastischen Realismus anzusiedeln. Kafka hat sie immer unglaublich inspiriert, daneben Botho Strauß und die Lektüre der mittelalterlichen Heldengeschichten. Sollte sie einmal nicht schreiben oder lesen, frönt sie dem Malen, dem Malen ihrer inneren Bilder.