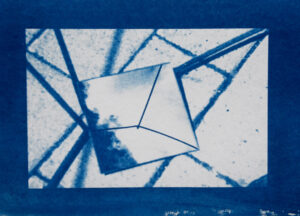von Jan Koneffke
Die Sprache hat ein Gedächtnis, ist ein Speicher der Geschichte, erinnert an etwas, auch wenn ihr Sprecher sich an dieses etwas nicht erinnert, wenn er sie gedankenlos benutzt, erinnerungslos. Und manchmal ist es eben die Entfernung zur Sprache, die jene Erinnerung stiftet.
„Nicht die Geliebte ist fern, sondern Entfernung ist die Geliebte”, lautet ein Bonmot des Wieners Karl Kraus. Die geistreiche Spitze gegen romantische Sehnsuchtsstrategien lässt sich aber auch ganz nüchtern verstehen, wenn man sie beispielsweise auf geliebte Mütter bezieht. Und, warum nicht, auf die Muttersprache.
Das Verhältnis von Nähe und Ferne in Bezug auf die Muttersprache ist komplex, die äußerste Nähe droht mit blinden Sprach-Konventionen, die äußerste Ferne mit dem Verlust der lebendigen Sprache. Letzteres war die Erfahrung der exilierten Autoren in den 30er und 40er Jahren. Sie verloren nicht nur ihr muttersprachliches Lesepublikum, sondern litten auch unter der Vertreibung aus dem heimischen Sprachraum, schrieben weiter unter dem Sauerstoffzelt des Exils. Sie beharrten auf einer modernen Sprache, während die zu Hause in barbarisches Kauderwelsch absank. Kuriose Konsequenz: Der heimgekehrte Döblin beispielsweise war nach dem Krieg zweifellos der modernere Autor verglichen mit den Borcherts und Bölls, die sich der Eichschen „Inventur” unterzogen hatten. Der modernere Döblin war ein anachronistischer Autor geworden. Oder sagen wir besser: Ein unzeitgemäßer. Nicht nur außerästhetische Gründe führten zur Ablehnung der Exil-Autoren durch das heimische Publikum, die im Vorwurf der Desertion, ja des Verrats gipfelten. Die Exil-Autoren wurden zu „Fremdlingen im eigenen Haus” auch deshalb, weil sie Sprach-Fremdlinge geworden waren.
In Hinsicht auf einen Döblin, einen Heinrich Mann oder — besonders trauriges Beispiel — einen Oskar Maria Graf bekommt das Kraus-Bonmot einen bitteren Hintersinn. Für diese Autoren war die Geliebte durchaus schmerzhaft fern, die geliebte Muttersprache, aber auch Entfernung war die Geliebte, nicht nur weil die Heimat Haft, Konzentrationslager und Ermordung bedeuten konnte, sondern weil die lebendige Sprache zugerichtet, entstellt, vergewaltigt wurde.
Ich mache diese Vorbemerkungen, um jedes Missverständnis auszuschließen. Wenn ich über die Nähe und Ferne zur Muttersprache reden werde, dann rede ich von Erfahrungen, die nicht vom Überlebensschmerz grundiert sind. Ich rede nicht vom Exil, sondern von einer aufhaltsamen Reise und Sprach-Reise durch das heutige, befriedete Europa.
Hölderins Hyperion konnte kein Volk sich denken, „daß zerrißner wäre, wie die Deutschen.” Er sah Handwerker, Denker, Priester, Herrn und Knechte, junge und gesetzte Leute — aber keine Menschen. Ich sah, Anfang der 90er Jahre, in Berlin lebend, lauter wiedervereinigte Deutsche. Und alle beklagten sich, kein Volk zu kennen, daß zerrißner wäre, als sie. Vor der verbissenen Nabelschau der Deutschen — nur noch die Parodie der Klage, die „der Eremit in Griechenland” geführt hatte — wich ich nach Italien aus. Ins Sehnsuchtsland der Deutschen also. Entfernung war die Geliebte.
Aber welch wundersame, europäische, Koinzidenz: In Deutschland regierten die treuen Hände der Treuhand, in Italien die mani pulite. In Deutschland wusch eine treue Hand die andere, aber auch die mani pulite wollten nicht richtig sauber werden. Die Deutschen hatten die Schnauze voll, vor allem von sich selbst, die Italiener die Schachteln — ne abbiamo piene le scatole -, die Norditaliener von den Süditalienern und alle zusammen von ihrer korrupten politischen Klasse. Deshalb wählten sie den Korruptesten unter ihnen zum Regierungschef. Während die Deutschen ihre Stasi-Leichen aus dem Keller zerrten — vorzugsweise die Westdeutschen, es waren ja auch weder ihre Keller, noch ihre Leichen -, holten die Italiener ihre Skelette aus dem Schrank — i scheletri nell’armadio -, staubten sie ab und stellten sie in den Schrank zurück, um fortan wieder Schulter an Schulter mit ihnen zu leben.
Stellen Sie sich, sagt Sigmund Freud in seinen Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse, stellen Sie sich das Gedächtnis wie die Stadt Rom vor, aber so, als ob in ihr noch alle Gebäude von ihrer Entstehungszeit bis heute gleichzeitig vorhanden wären. Mich beschäftigte diese Versinnbildlichung des Gedächtnisses nicht nur deshalb, weil in ihr das Gedächtnis eine — wie auch immer phantastische — Räumlichkeit annimmt. Nicht nur deshalb, weil in ihm, Freuds Vorstellung gemäß, nichts verloren gehen kann. Nicht einmal nur deshalb, weil seine bildlich-räumliche Beschreibung, wenn man sie beim Wort nimmt, das Gedächtnis zu einem Speicher der Geschichte überhaupt macht. Als ob das Gedächtnis, das es ja nur in den jeweils einzelnen Subjekten geben kann, mehr enthält, als ihre je eigenen Wahrnehmungen, Erlebnisse, Erfahrungen, nämlich auch Wahrnehmungen, Erlebnisse, Erfahrungen aus einer Zeit vor ihrer Geburt, die potentiell ins Bewusstsein treten können.
Nein, mich beschäftigte diese Freudsche Versinnbildlichung seines Gedächtnisbegriffs vor allem deshalb, weil ich in Rom lebte. Sie erinnerte mich an jene handlichen Touristenalben mit kolorierten Fotos der historischen Ruinen Roms, über die man eine transparente Folie legen kann, die sie um ihre verschwundenen Mauern, Säulen, Friese ergänzt: Ein Palimpsest der Zeit. Sie erinnerte mich nicht zuletzt an mich selbst, der die Stadt erkundete, halb betäubt von ihrer sinnlichen Gegenwart, die die Vergangenheit entrückte und verdeckte, um sie plötzlich, wie bei einer Luftspiegelung, aus dem Nichts hervortreten zu lassen. Ganz besonders deshalb, weil sich diese Erkundungen in einem so noch nie erlebten, geradezu wilden Traumgeschehen niederschlugen, das mir tief vergrabene Erinnerungen ins Bewusstsein spülte.
Und was mir in Berlin nicht möglich gewesen war, nämlich die mir seit meiner Kindheit vertraute Geschichte des „Paul Schatz im Uhrenkasten” zu erzählen — eine vierfach gebrochene Geschichte, weil sie durch das kindliche und das erwachsene Bewusstsein des Paul Schatz, darüber hinaus aber durch das kindliche und erwachsene Bewusstsein seines Neffen, des Ich-Erzählers, zur Sprache kommt; eine Geschichte, die sich vor der Geburt des Ich-Erzählers abspielt und durch seine individuelle Erinnerung hindurch zu tieferen, nicht mehr erlebten Vergangenheitsschichten hinabsteigt — diese Geschichte zu erzählen, gelang mir hier, in Rom.
Verstellte Großvater Haueisen einen Uhrenzeiger? Hockte er im Erdinnern am Schaltpult mit blinkenden Lampen und zweihundertdreißig exakten Uhren und zettelte Revolutionen an? Streichelte er seinen Bart, Karl Haueisen, der Logenmeister, Antisemit und Rechnungsrat im Reichspostministerium und Hitlerhasser gewesen war?
Bediente Großvater Haueisen in einer schalldichten Kammer mit Pritsche und Hollerithmaschinen, die Lochstreifen ausspuckten, Meßskalen, bebenden Zeigern in schwarzem und rotem Bereich, einen Hebel und rettete seinen Enkel? Haueisens Kommandozentrale war aus Eisen und stemmte sich gegen Sand und Steine, Wasser, erkaltete Lava, Kohlen und glimmerndes Erz, Dinosaurierskelette, vergrabenes Gold, gegen Abfall und Schutt. Ein Tunnelsystem verband sie mit anderen Kommandozentralen, wo andere Logenmeister hockten, und einer gigantischen Halle, nahe beim Erdmittelpunkt, wo man sich traf und beim Schachspiel Regierungen absetzte, Attentate beschloß, medizinische und physikalische Entdeckungen plante.
Preßte Großvater Haueisen sein Auge ans Teleskop, das Erde und Steine durchdrang und einen atomgroßen Menschen einfangen konnte, und erkannte Paul Schatz, seinen Enkel?
Die erste Bedingung, um diese deutsche Geschichte erzählen zu können, war der Gedächtnisraum Rom, der Zeit-Speicher Rom, der das individuelle Bewusstsein, sinnlich und akut, übersteigt. Die zweite Bedingung war die Entfernung zu der Stadt, in der die Geschichte spielte, ihre Spuren aber nicht mehr lesbar gewesen waren, eine räumliche Entfernung, die der zeitlichen im Gedächtnis-Raum korrespondierte. Die dritte Bedingung hingegen bestand in einer anderen Entfernung, nämlich der zur Muttersprache.
Was mich umgab, war ja nicht nur der Gedächtnis-Raum Rom, sondern auch ein anderer Sprachraum. Zunächst scheint der Begriff Sprachraum nichts anderes zu bezeichnen als den Raum, in dem eine Sprache, zumindest überwiegend, gesprochen wird. Aber es gibt auch einen Sprach-Raum, der die auf solche Weise festgelegte, die Beweglichkeit des Begriffs beendende, weil ihn de-finierende, Bedeutung aufhebt, und einen Raum meint, den die Sprache selbst besitzt, analog zum Gedächtnis-Raum Freuds.
In diesem Sprach-Raum haben sich Wahrnehmungen und Erfahrungen niedergeschlagen, historische Inhalte sedimentiert, und das nicht nur in ihrem Lexikon, sondern auch in ihrer Morphologie, in Syntax und Struktur, ihrer Satzgestalt. Dass dieser Sprach-Raum als Speicher der Geschichte fungiert und jede individuelle Sprach-Erfahrung historisch transzendiert, ist viel unmittelbarer einzusehen als beim Freudschen Gedächtnis-Raum.
„Schnell, schnell”, sagte der deutsche Archäologe zu meiner rumänischen Freundin, die das freigelegte frühchristliche Bodenmosaik in der Kirche San Stefano di Rotondo durch seine Abzeichnung dokumentieren sollte, „schnell, schnell. Sie kennen doch das deutsche Wort ‚schnell’, nicht wahr?” — „Ja” erwiderte meine Freundin, „aus all diesen Filmen mit den Nazis.”
Die Sprache hat ein Gedächtnis, ist ein Speicher der Geschichte, erinnert an etwas, auch wenn ihr Sprecher sich an dieses etwas nicht erinnert, wenn er sie gedankenlos benutzt, erinnerungslos. Und manchmal ist es eben die Entfernung zur Sprache, die jene Erinnerung stiftet.
Quando sono arrivato a Roma, non sapevo la lingua italiana. Oder: Als ich nach Rom kam, konnte ich kein Italienisch. Der Unterschied ums Ganze: Die Sprachkompetenz wird im Deutschen zu einem Können, einer technischen Fähigkeit. Im Italienischen ist sie sapere — Wissen. Freilich: Meine neue Umgebung wusste die Zunge, la lingua, ihr Sprach-Wissen existierte nicht jenseits der Aktualisierung von Sprache, dem Sprechen. Und so sprach es auch um mich herum. Diese Sprache war die Sprache des Sich-Entäußerns, die Sprache der piazza und des mercato, des Veräußerns, nicht die Sprache der Verinnerlichung. Für mich blieb sie anfangs ein Rauschen oder ein artikuliertes Geräusch oder auch ein Singsang, begleitet von auffallenden Gesten, die zu dieser sich entäußernden Sprache unmittelbar gehörten. Vielleicht vermochte ich mich auch deshalb, hier im kleinsten Quartier Roms, in San Lorenzo, dem einst von Eisenbahnern und Steinmetzen bewohnten Viertel — der Bahnhof Termini an dem einen Ende erzählte mir von der Lebens-Reise, aber sein Name Termini verwies schon auf den Totenacker am anderen Ende, den Campo Verano, auf die letzte Reise, die Endstation -, vielleicht vermochte ich mich auch deshalb in ein anderes kleines Viertel zurückzuversetzen, nämlich in das verschwundene Scheunenviertel am Berliner Alexanderplatz, mich zu über-setzen in die vernichtete Welt meines Paul Schatz: Denn um mich herum sprachen und fuchtelten die Menschen, temperamentvoll und extrovertiert, und in einer anderen Sprache und mit anderen Gesten hatten so auch die vor den Pogromen geflüchteten Ost-Juden das Scheunenviertel belebt, wofür sie im Übrigen geschmäht und verachtet worden waren.
Man muß aus seinem Leben eine Geschichte machen. Hand und Fuß sollte sie haben und komisch sein — wenn man nicht zappelt und strampelt in seiner Geschichte, wird man sein Leben nicht los.
Ich hatte es nicht nur mit einer Fremdsprache zu tun. An dieser Sprache war alles fremd, war alles anders. Sie zog mich umso stärker an. Entfernung war die Geliebte.
Und ich buchstabierte sie. Wort für Wort.
Und was war das, ein Herzensbrecher? Bei seiner Nenntante konnte sich Paul nicht erkundigen. Er mußte in seine Finger beißen, um sie nicht an Hals oder Ohren zu streicheln und zu zwicken. Als er einschlief, sah er seinen Vater vor sich, maskiert und in einem schwarzen Mantel. Und nachts stahl sich Vater auf Katzensohlen an fremde Betten und holte zierlichstes Werkzeug aus seinem Fledermausmantel, Zange und Eisen und Hammer. Er stemmte einen Brustkasten auf, um sich ein Herz zu holen. Und wenn er es in seinen Fingern drehte, zerbrach er es. Es knackte, mehr nicht. Waren alle Juden Herzensbrecher? Oder bloß sein verschlagener Vater?
Die Sprache buchstabierend, nahm ich sie wieder und wieder beim Wort. Und das Wörtlichnehmen der fremden Worte übersetzte sich unbewusst in eine andere Aufmerksamkeit gegenüber den mir vertrauten Worten der Muttersprache, Worten, die mich zusehends be-fremdeten. Oder um es mit einem anderen Aphorismus des Karl Kraus zu sagen: „Je länger man ein Wort betrachtet, umso ferner schaut es zurück.” Diese Aufmerksamkeitserfahrung war Bedingung, um, zusammen mit Paul Schatz, und später dem Kind Sebastian aus „Eine Liebe am Tiber”, wieder das kindliche Staunen zu erlernen, das Staunen gegenüber der Welt und der Sprache, der Welt aus Sprache. Prekäres Verstehen, sinnlicher Irrtum.
Ums niedrige Eckhaus am Treppenabsatz pflegten wir drei einen Bogen zu machen, Mutter, Lisa und ich. Das war schwarz vom Muff, der an seinen Mauern fraß. Es gruselte uns vor seinen Bewohnerinnen, zwei Zwillingsschwestern mit Adlernasen und zotteligem grauem Bart, der beiden am Kinn sproß. Wenn sie zusammen das Haus verließen, und niemals ging eine alleine aus, Arm in Arm oder Hand in Hand, heulten Kinder von allen Seiten: „Ei, brutte babbuine! Zitelle meschine!” und spritzten schreiend auseinander. Sie winkten dem Schuster zu, der vor den Stufen zur Werkstatt auf seinem Schemel hockte und sie mit derben Bemerkungen foppte. „Schwesterchen, zeigt eure Feigen! Sind sie saftig und frisch oder trockener als Schuhsohlen?” — „Trockener als Schuhsohlen”, schnatterten beide.
Es dauerte Monate, bis ich verstand, was sich Schuster und Zwillinge zuriefen, beugte mich halsbrecherisch ins Freie und konnte im Einkaufskorb der Schwestern nie eine Feige entdecken.
Ich berichtete vom wilden Traumgeschehen im Gedächtnis-Raum Rom. Dieses Traumgeschehen suchte mich geradezu heim, mit Erinnerungen aus der Kindheit, die mir längst entfallen waren. Eines Morgens wiederum erwachte ich weinend und erwachte, weil ich weinte. Mein eigenes Geräusch hatte mich geweckt. Gehandelt hatte mein Traum aber davon, dass ich in Berlin erwache. Deshalb hatte ich zu weinen begonnen und war wirklich erwacht — in Rom.
Können einen die Träume aber auch fremdsuchen? Irgendwann begannen sie es zu tun. Ich träumte auf Deutsch und Italienisch, ich träumte mich von einer Sprache zur anderen. Nicht nur Wahrnehmungen und Erlebnisse, Erinnerungen und Tagesreste überlagerten sich, sondern auch die Sprachen taten es, wie in jenen
Touristenalben, in denen die gezeichnete, transparente Seite auf das kolorierte Foto gelegt, die von der Zeit verschlungenen Mauern der Ruine ergänzten, mit dem entscheidenden Unterschied, das die beiden übereinander liegenden Traumbilder und Sprachtraumbilder kein Ganzes ergaben. Sie stellten keinen heilen, ursprünglichen Zustand her, weil der Zu-Stand nicht stehen blieb, sondern Bewegung war. Ständig verschob sich etwas oder verdichtete sich etwas zu einem Anderen, aber dieses Andere war nicht einfach ein Drittes, und schon gar kein festes Drittes, denn festhalten ließ es sich beinahe so gut wie nie.
Ich erinnere mich, wenn ich schreibe, hatte ich Jahre zuvor in einem poetologischen Text formuliert. Mir ging es dabei um die Darstellung eines bestimmten Welt-Bezugs, bei dem die Bewusstseinsinhalte zum Material der Erinnerung werden, werden müssen, bevor sie zur Sprache kommen, kommen können. In der Erinnerung verlieren die Bewusstseinsinhalte ihre fixe Gestalt und gehen neue Konstellationen ein. Die so verstandene Erinnerung ist nicht lediglich eine poetische Technik, sie bindet auch, mal schwächer, mal stärker, Affekte an sich, die der Erinnerungsarbeit auf die Sprünge helfen oder sie blockieren können, und die sich an den Erinnerungsinhalt heften.
Nichts intimer, als eine Erinnerung, die man miteinander teilt, ob es eine verbindende oder trennende, eine beglückende oder schmerzhafte, eine peinliche oder peinigende Erinnerung ist.
„Und was machst du?” wollte Lili wissen, als sie sich wieder neben mir niederließ, „womit verdienst du dein Geld?” — „Ich habe es leider nie zum Matrosen gebracht, falls du das meinen solltest.” Lili betrachtete mich verwirrt, und ich winkte ab, eine Spur verbittert. Was war diese Erinnerung wert, wenn wir sie nicht mehr miteinander teilten? …
Bis zum Sonnenuntergang hockten wir auf der Hollywoodschaukel in Lilis verwildertem Garten, und mit den zunehmenden Schatten, dem warmen Glanz auf der steinernen Wasserleitung, kam sie mir zusehends weicher und heiterer vor. Und als wir bei Dunkelheit zum Cinquecento schlenderten, mit dem sie mich in Trastevere abliefern wollte, bemerkte sie heiser: „Ich habe es nicht vergessen, ich meine, das mit dem Matrosen.” Ein phosphoreszierendes Blau spielte um Lilis Gesicht, und sie wandte sich schleunigst dem Auto zu, um das Verdeck zuzuklappen. Und trotzdem war Lilis Erinnerung ein Trost.
Ich erinnere mich, wenn ich schreibe — dieser poetologische Satz hatte einen hintergründigen Sinn, der mir erst später aufging. Er lautete: Ich schreibe, um mich zu erinnern. Oder besser: Ich schreibe, um eine Erinnerung mitzuteilen, damit ich sie mit anderen teilen kann.
Ein paar Absätze weiter, hieß es in jenem poetologischen Text: Ich erinnere mich, wenn ich schreibe, an Sprache. Die Sprache ist nicht die feste Form, in die die beweglich gewordenen Bewusstseinsinhalte hineingegossen werden, wie das sinnlich-chaotische Material in die Perzeptionsformen der Verstandeskräfte. Die Sprache selbst wird zum Inhalt der Erinnerung, zu einem Gegenstand, der seine Gegenständlichkeit verliert, und lädt sich mit Affekten auf. Wo aber erinnert man sich intensiver, tief- und abgründiger, wo verbinden sich die jüngsten und ältesten Bewusstseinsinhalte freier miteinander, als im Traum? Ihr zeitlicher Index spielt keine Rolle, denn im Freudschen Gedächtnis-Raum sind sie gleichzeitig da. Gewiss, der Zensor wacht. Verdichtung und Verschiebung sind seine Agenten. Die sich im Traum ergebende Konstellation alter und junger Bewusstseinsinhalte ver- und entstellt, mal stärker, mal schwächer, die durch die Traumdeutung zu ermittelnde Wahrheit. Aber im Traum öffnet sich das Tor, das im wachen Bewusstsein verschlossen bleibt. Hinzu treten Wunsch und Begehren, die die Bewusstseinsinhalte des Traumes in eine neue Konstellation bringen. Doch unter der Prämisse, dass letztlich jedes Denken wishful thinking ist, eine Prämisse, die das Bewusstsein selbstredend weit von sich weist, bietet der Traum noch die ehrlichste Figuration des Wunsches und des Begehrens.
Ich habe bei anderer Gelegenheit vom Realismus als Traumarbeit gesprochen. Realismus als Traumarbeit meint, dass das vorgegebene Material der inneren und äußeren „Wirklichkeit” in seiner literarischen „Übersetzung” durch die der Traumarbeit entliehenen Agenten Verschiebung und Verdichtung zu einer neuen Konstellation zusammentritt. Noch mehr: Dass diese neue Konstellation dazu führt, dass das Wirkliche — oder angeblich Wirkliche — durchsichtiger wird, dass es an Schwerkraft verliert, und dass seine Möglichkeiten freigelegt werden, so wie es auch im Traum geschieht. Dabei beziehen sich die genannten freigelegten Möglichkeiten im Innersten des Traums auf den Wunsch und das Begehren — und so tun sie es, auf einer qualitativ anderen Bewusstseinsstufe, dem, nennen wir es so, „poetischen Bewusstsein des Textes”, auch.
Als Großvater Haueisen tot war, verstellte er seine Uhrenzeiger. Er verstellte nicht einen, nicht zwei Zeiger, er … verstellte alle zweihundertdreißig Zeiger an seinen zweihundertdreißig Uhren. Und sein Freimaurerreich fing zu wackeln und beben an, und Meßskalenglas splitterte, Telefone hopsten zu Boden … und Sirenen heulten von Sinnen, und Warnlampen blinkten sich zu Tode … — und auf Erden hatte Judas Ischariot Jesus Christus nicht verraten und keine dreißig Silberlinge Kopfgeld kassiert … und er hatte nichts zu bereuen und zog sich keine Schlinge aus Hanf um seinen Hals und … starb als sechsundsiebzigfacher Urgroßvater mit hundertundzehn, und man brachte Jesus nicht zu Pontius Pilatus, der eh lieber frisches Obst aß und sich seine Zehen massieren ließ, als Kreuzigungen zu beschließen. Und im Heiligen Land lebte Jesus, bis er ein betagter Mann war, und litt nicht am Kreuz und hob nicht seine Augen zum Himmel und wandte sich nicht verzweifelt an Gott: „Warum, mein Vater?” Zeit seines Lebens heilte er Kranke und hatte eine Menge Zulauf, nicht anders als Hitler scharrte er Massen um sich am Fuß eines Berges und segnete sie und versprach ein besseres Leben. Lautsprecher brauchte er nicht. Als Lautsprecher dienten Palmwedel und Wind, und seine Botschaften liefen von Mund zu Mund, und wenn man Jesus falsch verstand, war es nicht tragisch. …
Wenn ich eben den Begriff „Übersetzung” in meinen Vortrag geschmuggelt habe, geschah das natürlich nicht absichtslos. Ilma Rakusa zitiert am Ende ihres Textes „Der Autor-Übersetzer. Sondierungen in einem vielschichtigen Terrain” einen Brief des Novalis an Schlegel: „Am Ende ist alle Poesie Übersetzung.” Übersetzung, füge ich hinzu, einer — Begehren und Wunsch lassen grüßen! — als ungenügend empfundenen inneren und äußeren Wirklichkeit, die, wenn sie nicht bereits eine sprachliche strukturierte Wirklichkeit war, es in der poetischen Übersetzung wird und werden muss.
Dass ich in einem anderen Sprach-Raum lebte und in der fremden Sprache zu träumen begann, die ins Unbewusste einsickerte, Teil des Vergessens wurde, das bekanntlich die Bedingung der Erinnerung ist, schlug sich auf die Text-Traumarbeit nieder. Die sich überblendenden Sprachen, die fremde und die eigene, ergänzten sich, wie die Bilder in jenen Touristenalben — aber auf widersprüchliche Weise. Der jeweils als besser empfundene Ausdruck, die jeweils als schlüssiger betrachtete Wendung drängte sich in den Vordergrund. Dabei konnte mir der muttersprachliche Satz auf einmal ganz fremd erscheinen, der italienische hingegen so selbstverständlich und angemessen, treffend und zu-treffend, wie nur ein muttersprachlich vertrauter. Es ergab sich eine verwirrendes Hin und Her, bei dem das deutsche Text-Material durchsichtiger wurde, bei dem es seine muttersprachliche Schwerkraft verlor — der deutsche Text konnte nicht mehr behaupten: hier stehe ich und kann nicht anders, denn ein Vergleich mit dem italienischen Äquivalent eines seiner Sätze oder Absätze bewies mir immer wieder, dass er auch anders konnte — und bei dem seine Möglichkeiten freigelegt wurden.
Dem Sprachmaterial widerfuhr bei der Arbeit also das, was bereits dem „Wirklichkeitsmaterial” widerfahren war: Transparenz, Schwerkraftverlust, das Erscheinen der Möglichkeiten.
Ich möchte hinzufügen, dass ich in diesen acht Jahren Rom durchaus mit dem Gedanken spielte, auf Italienisch zu schreiben. Aber ich tat es nicht. Schwer zu sagen, warum. Gab es noch eine letzte psychologische Blockade? Oder fehlte die letzte Notwendigkeit, sich dieser Erfahrung auszusetzen? Oder war die Entfernung daran schuld, und ich hielt der geliebten Entfernung die Treue — der geliebten Entfernung zur Muttersprache?
Ja, Entfernung war die Geliebte. Auch die Erinnerung entfernt und entrückt die äußere und innere „Wirklichkeit”, auch der Traum tut es auf seine Weise — um eine andere Nähe zu schaffen. Und wenn meine Arbeit an den Vorgängen der Erinnerung und den Vorgängen im Traum ihr Maß nahm, so ent-sprach ihr die Entfernung von der Muttersprache.
Das Ergebnis war umso kurioser — und nicht intendiert. Und dass das Text-Ergebnis kurios war, fiel mir selber nicht auf. Da hatten mich beim Schreiben die Sprach-Korrespondenzen und Sprach-Differenzen des Deutschen zum Italienischen und umgekehrt immer wieder beschäftigt, manchmal unbewusst, manchmal ganz bewusst.
Jetzt machten meine Übersetzer die Beobachtung, dass das Sprach- und Textergebnis besonders deutsch klang und war — in Struktur und Satzbau, Rhythmus und Lexikon. Und das galt für Übersetzer aus so verschiedenen Sprachen wie dem Niederländischen und dem Rumänischen. Den Schlusssatz des Romans „Eine Liebe am Tiber” hatte die grande dame der rumänischen Poesie, Nora Iuga, folgendermaßen übersetzt:
?i totu?i faptul c? Lili i?i amintise a fost o consolare. Aus: Und trotzdem war Lilis Erinnerung ein Trost wurde in der rumänischen Version: Und doch, die Tatsache, daß Lili sich erinnerte, war ein Trost. Aus der verdinglichten Erinnerung im Deutschen war durch die Verschiebung in der Übersetzung ein aktives, lebendiges Sicherinnern geworden: Transparenz, Schwerkraftverlust, das Erscheinen der Möglichkeiten.
Die Beobachtungen der Übersetzer erstaunten mich. Hatte sich die Muttersprache in ihrem Eigensinn gegen die fremden Sprach-Elemente behauptet? Oder spiegelte sich im Text-Ergebnis das komplexe Verhältnis von Nähe und Ferne zur Muttersprache wider? War die Entfernung auch deshalb die Geliebte gewesen, weil sie äußerste Nähe bereitgehalten hatte. Mehr Nähe als die Nähe. Dann hätte ich vielleicht in meiner römischen Ein-Zimmer-Behausung an der Aurelianischen Stadtmauer, dem einst von Eisenbahnern bewohnten Haus, in dem noch die Emailleschilder aus Zeiten der faschistischen Volkserziehung auf der Treppe hingen — „chi cura la casa cura se stesso” — und das, während der Besetzung Roms durch die Wehrmacht, von amerikanischen Bombern halb wegrasiert worden war, dann hätte ich also in diesem Haus und in diesen römischen Jahren — aus meiner Muttersprache in meine Muttersprache übersetzt?
Ich sprach bald nur noch Italienisch, das zur Intimsprache meiner rumänischen Frau und mir wurde, ich las Italienisch, sogar deutsche Bücher in ihrer Übersetzung, ich dachte und träumte auf Italienisch. Und schrieb auf — Deutsch.
Aus Furcht vor dem Verlust der lebendigen Muttersprache, brach ich nach acht Jahren in Rom die Zelte ab und zog in einen für meine Person „zweifelhaften” deutschen Sprachraum, nämlich nach Wien. Entfernung blieb die Geliebte. Aber ich entfernte mich noch etwas weiter, und pendelte fortan, pendele bis heute zwischen Wien und Bukarest.
Nicht, dass Bukarest zu meinem zweiten, balkanischen, Rom wurde. Obwohl auch diese Stadt zum Gedächtnis-Raum taugt, wenn auch einem jungen Gedächtnis-Raum, dessen Erinnerungsspuren umso verwirrender sind, weil sich in ihm Orient und Okzident begegnen, Stadt und Land, die architektonische Moderne der Zwischenkriegszeit und die architektonische Postmoderne des Feudalkommunismus — letztere eine Stein gewordene Kontradiktion.
Älter als dieser Gedächtnis-Raum ist hingegen der Gedächtnis-Raum der Sprache, eines oströmischen Dialekts, der sich vor allem mit slawischen Elementen anreicherte und in der Neuzeit mit französischen. In einem Landstrich, der das Einfallstor der Völker aus dem Osten war, erhielt sie sich — eigensinnig. Vielleicht war es ja ein Trost, wenn sie sich an sich erinnerte.
Meine erste Bekanntschaft mit der rumänischen Sprache waren zwei Einschlafverse: Somn u?or, vise pl?cute / puricii s? te s?rute. Leichter Schlaf, angenehme Träume/ die Flöhe sollen dich küssen. Bis heute betrachte ich diesen Zweizeiler als eine freundliche Aufforderung: Zur Traumarbeit.
Die eingestreuten Textzitate (kursiv) stammen aus den Romanen:
Jan Koneffke: Paul Schatz im Uhrenkasten. Köln 2000.
Jan Koneffke: Eine Liebe am Tiber. Köln 2004.
Jan Koneffke — Vortrag auf der Übersetzerwerkstatt Erlangen

Jan Koneffke, geboren 1960 in Darmstadt, studierte Philosophie und Germanistik in Berlin. 1986/87 schloss er sein Studium mit einer Magisterarbeit über “Erinnerung und ästhetische Erfahrung” im Werk Eduard Mörikes ab. Lebt als freier Schriftsteller (Lyrik, Prosa, Kinderbücher) und Publizist in Wien und Bukarest. Redaktionsmitglied des Wiener “Wespennest”. Gelegentliche Übersetzungen aus dem Italienischen und Rumänischen.