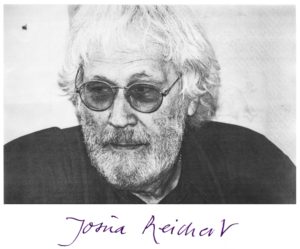© Quantrell D Colbert /Amazon Studios
von Steven Gabber
Nicht weniger als 33 Jahre ist es her, als die amerikanische Filmkomödie Coming to America (Der Prinz aus Zamunda) auf den Leinwänden der 80er Jahre zu sehen war. Es dauerte nicht lange und der Film erarbeitete sich einen Legendenstatus im Comedy-Genre. Dafür gibt es zahlreiche Gründe, die über die erstklassige schauspielerische Leistung von Eddie Murphy und Arsenio Hall hinausgehen. Vielmehr legt der Film auch seine Finger in die offensten Wunden der amerikanischen Kultur, wenn er beide Figuren aus dem fiktiven, afrikanischen Staat Zamunda in die Realität der Zuschauer*innen reisen lässt: Das ernüchternde New York, 1988, das seine Träume und Vorurteile auf die Protagonisten loslässt.
Zur Erinnerung der Plot in Kürze: Eddie Murphy flieht in der Haut des Thronerben Zamundas Akeem nach Queens, um seiner arrangierten Hochzeit zu entkommen und um schließlich eine Frau zu finden, ohne dass diese ihn sofort als einen Prinzen wahrnimmt. In Amerikas harter Realität angekommen gibt er sich für einen mittellosen Studenten aus und lernt seine Auserkorene Lisa McDowell (Shari Headley) kennen. Über viele komische Umwege, kulturelle Missverständnisse, Schein und Sein bröckelt die Fassade jedoch, Akeems wahre Identität fliegt auf, als sich sein Vater in die Angelegenheit einmischt, und erst nach einer Bewältigung des Konflikts kommt das Paar schließlich vor dem Traualtar zusammen.
Eigentlich eine runde Sache. Wozu einen zweiten Teil produzieren? Ohne sich dieser (für die Filmindustrie ohnehin rhetorischen) Frage anzunehmen, setzten die Paramount Studios dieses Projekt auf Biegen und Brechen um: Kurzerhand war die alte Besetzung wieder zusammengetrommelt, mit einigen neuen Gesichtern aufgefrischt und schon floss neuer Wein durch die alten Schläuche dieser längst verstaubten Coming-of-Age-Geschichte.
Da nicht nur innerhalb der Handlung, sondern auch in der Realität gut dreißig Jahre vergangen sind, liegt es nahe, Eddie Murphy nun für Coming 2 America (Der Prinz aus Zamunda 2) in die Rolle eines alternden Regenten zu stecken, der nun daran denkt, für seine älteste Tochter Meeka (KiKi Layne) eine Ehe mit dem Sprössling aus dem Nachbarstaat Nexdoria zu arrangieren. Doch diese Pläne geraten auf Eis, als König Akeem von seinem sterbenden Vater (James Earl Jones) erfährt, dass Akeem als junger Prinz auf seiner Brautschau (die Diskoszene im ersten Teil) den unehelichen Sohn Lavelle (Jermaine Fowler) gezeugt hätte. Aufgrund seines männlichen Geschlechts rechtmäßiger Thronerbe Zamundas. Akeem zögert nicht und holt Lavelle mitsamt seiner Familie nach Afrika. Doch bald kommt dem Thronanwärter der berechtigte Verdacht, dass er nur zur Lösung der Erbfolge benutzt wird, sodass er mit seiner zamundanischen Friseuse Mirembe nach Queens flieht und das Paar dort heiratet. Obgleich Akeem entschlossen war, seinen Sohn aus Amerika zurückzuholen, überkommen ihn Erinnerungen an seine eigenen jüngeren Jahre, sodass er bald alle Zwänge gegenüber seinen Kindern verwirft und seine älteste Tochter zur weiblichen Nachfolgerin erklärt.
Es ist aufgrund der vielen inhaltlichen Parallelen offensichtlich, dass man den zweiten Teil nur auf der Folie des ersten sehen und verstehen kann. Sich als Zuschauer*in in diesem enormen Figurenarsenal und Informationsüberfluss überhaupt orientieren zu können, ist nahezu unmöglich, wenn man nicht Teil Eins in den letzten 33 Jahren bis zur Zitierfähigkeit verinnerlicht hat — ein erstes Indiz dafür, dass die Zielgruppe etwas speziell ist. Der Film ist nämlich das, was Literaturwissenschaftler*innen “intertextuell” nennen: Er lebt förmlich davon, dass er sich ständig auf seinen Vorgänger zurückbezieht — eine Tatsache, die das Wiedererkennen von bekannten Schauplätzen, Figuren und Inhalten zum Grundmodus der Zuschauer*innen macht. Diese Technik sorgt sicherlich für zahlreiche nachsommerlich-nostalgische Momente im Publikum, auch wenn das immergleiche Copy-Paste-Schema mit gealtertem Cast manchmal ermüdend ist. Es scheint, als wäre der Nachfolger über weite Strecken zu sehr mit dem Kult des Vorgängers beschäftigt und macht sich dabei derartig abhängig von seiner Vorlage, dass die eigenständige thematische Entwicklung von Inhalten kaum möglich wird.
Blicken wir zum Beispiel auf das enorme kulturkritische Potenzial des ersten Teils, das ein Plot bietet, der zwei hochgeborene Afrikaner mit dem urbanen Amerika konfrontiert. Diese Konstellation ist logischerweise kulturpolitisch hochbrisant, weil sie sich nicht nur mit dem Thema sozialer Schicht beschäftigt, sondern auch zwei sich völlig fremde Kulturen miteinander kollidieren lässt — Anlass, um kräftig an den Vorurteilen Amerikas gegenüber dem afrikanischen “Anderen” zu rütteln. Damit kann Teil 2 kaum mithalten, wenn er lediglich zeigt, wie auf umgekehrte Weise Afrika auf einen amerikanischen Neuankömmling reagiert. Anstatt aus den Problemen zwischenkultureller Verständigung komische Effekte zu erzeugen, reiht sich Coming 2 America vielmehr in ältere, beinahe “kulturimperialistische” Traditionen ein, wenn der Film zahlreiche Klischees karikierend verfestigt anstatt sie aufzubrechen. So besitzt etwa Zamundas Königshaus einen geradezu peinlichen, mit getrockneten Vorhäuten hantierenden Schamanen oder einen abgegriffen trivialen Diktator aus dem Nachbarstaat. Dass Lavelle, um sich als würdiger Thronfolger zu erweisen, als Reifeprüfung einem schlafenden Löwen eine Wimper abschneiden muss, ist ebenfalls nichts als unkritischer, plumper Afrika-Sensationalismus, der dem geradezu dekonstruierenden Scharfsinn des ersten Teils weit hinterher hinkt.
Coming 2 America trübt leider auch den Fortschrittsoptimismus, den sein Vorgänger innehatte: Akeem, einst Sinnbild für den Wandel traditioneller, patriarchaler Strukturen, steckt nun selbst in den Schuhen seines konservativen Vaters — gewillt, die etablierten Machtverhältnisse zu erhalten. Sein einst hart erkämpfter Sieg gegen die Tyrannei seines Vaters scheint nicht gehalten zu haben. Er, der einst Lisa als nichtadelige Frau ein Mitspracherecht geben wollte, hat zu Beginn von Teil 2 anscheinend alle Lektionen verlernt. Provokativ gefragt: Ausdruck von Zweifel an politischem Fortschritt auf afrikanischem Kontinent? Auch wenn man sich nicht so weit aus dem Fenster lehnen muss und es gut tut, dass der Film die Dinge gegen Ende wieder ins Lot rückt — der Regress folgt dann wohl in Teil 3 -, wirft die Andeutung von Teil 2, dass jeder Fortschritt nur relativ ist und sich schnell in sein Gegenteil verkehren kann, einen beträchtlichen Schatten auf das abermals progressive Filmende, in dem Akeem mit Gedanken an seine verstorbene Mutter die Thronfolge zugunsten seiner Tochter verändert.
Doch ist nicht alles faul im Staate Zamunda. Hinsichtlich des Themas Gender trumpft Teil 2 zumindest mit der Tatsache auf, dass weibliche Figuren verstärkt in aktiven Handlungspositionen gezeigt werden. Es sind nicht mehr die Patriarchen des ersten Teils, die die Spielräume setzen, in denen sich Frauen bewegen können. Was es der damaligen Königin an Stimme und Durchsetzungsvermögen fehlte, haben Akeems Gattin Lisa sowie deren Töchter nun im Überfluss. Auch die Tatsache, dass Zamunda eine weibliche Thronfolgerin besitzt und die patriarchale Linie somit durchbrochen wird, ist ein sinnvoller, längst überfälliger Impuls. Man darf auch darüber schmunzeln, dass nun anders als im ersten Teil auch Badejungen für die „Körperpflege“ der weiblichen Figuren zur Verfügung stehen — eine angenehme Umkehr der unkritischen Geschlechterverhältnisse des ersten Teils.
Von einem feministischen Paradigmenwechsel sollte man trotzdem nicht sprechen, zumal ein Großteil des Plots nach wie vor um seine männlichen Akteure kreist. Immer noch dominieren Murphy und Hall die Bildfläche, direkt gefolgt von Jermaine Fowler, der im Gegensatz zu den weiblichen Rollen sehr viel Screentime genießt. Da lässt sich fragen, ob es nicht ausgereicht hätte, die Handlung auf Akeems Töchter zu richten, anstatt auf umständliche Weise einen amerikanischen Sohn in die Geschehnisse des ersten Teils einzuflechten. Dass Akeems Töchter tatsächlich häufig nur als Kollektiv auftreten und dabei kaum individuelle Charaktereigenschaften besitzen, trübt die Umstände weiter — ebenso wie die Tatsache, dass Lisa und Lavelles Mutter Mary (Leslie Jones) stärker in karikierte Verhaltenstypen (insbesondere das patriarchale Shrew-Klischee) gedrängt werden.
Auch wenn sich Coming 2 America kaum aus dem Schatten seines Vorgängers hinauswagt und in seiner Themenentfaltung meilenweit hinterherhinkt, bietet der Film Fans des Zamunda-Universums genug komisches Potenzial für 108 Minuten unkritische Unterhaltung. Für ein besseres Urteil stört die Tatsache, dass sich der Film zu parasitär vom innovativen Geist des ersten Teils bedient, ganz ohne dabei eigene, ebenbürtig komische Impulse mit zu setzen. Was bleibt, ist ein nostalgieerfülltes Wieder-Sehen.