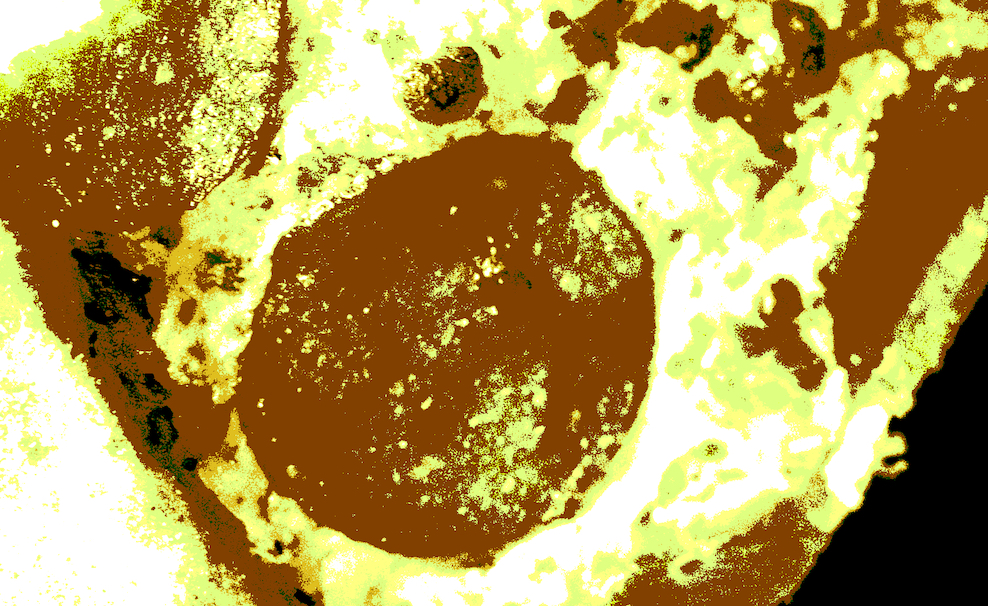von Lena Wenzel
Pizza wollte ich essen gehen. Manchmal muss man‘s einfach tun. Nicht aus Trotz, sondern weil der Gaumen schreit.
Am Dienstag vergangener Woche schrieb ich ihm also: „Ich will Pizza. Lass uns Pizza essen gehen.“.
Er schrieb: „Okay.“.
Heute, eine Woche vorher, am Dienstag vor dem Dienstag, bin ich vollkommen entspannt. Eine ungewöhnliche Ruhe umschließt meinen hungrigen Körper und legt sich um meinen Geist. Die Welt in Watte gehüllt. Wohin ich auch ging, mir war als lief ich auf Wolken. Die weißen schönen, nicht die grauen stürmischen. White Carpet unter meinen Füßen…
Ich ertappte mich dabei, wie ich manchmal wie verrückt zu Grinsen anfing. An der Bushaltestelle. An der Kasse. Unter der Dusche. Ich träumte tagsüber und nachts lief ich im Kreis. Und manchmal tanzte ich frei von allen Zwängen zur Musik. Dabei mochte ich sie nicht einmal.
Diese ruhige Euphorie hielt an bis zum Wochenende, als sich meine Laune schlagartig änderte. Schüchterne Sonnenstrahlen gespannter Vorfreude kämpften jetzt gegen die dichte Wolkendecke in meinem Innern. Ich war befallen von heißer Begierde. Speichel sammelte sich in meinem Mund. In meinen Augen glänzten Rinnsale süßer Tränen. Meine Zähne schmerzten vor Hunger. Ich konnte nicht stillsitzen. Nur bewegt laufen. Wie ein eingesperrter Tiger ging ich in meinem Zimmer ruhelos auf und ab, schaute aus dem Fenster in andere Fenster hinein. Und wenn einer zurückschaute, duckte ich mich. Zeitweise wurde ich richtig wütend. Anderen gegenüber oft aggressiv. Mir selbst wurde ich unerträglich und tief in meinem Innern fühlte ich einen stechenden Schmerz.
Auch die Nächte wurden seltsamer. Als ich eines Nachts schlief und einen sehr lebendigen Traum hatte, tastete ich vorsichtig nach meinem Nabel. Ich erschrak, als meine Finger in ein bodenloses Loch griffen. Ohne Anfang, ohne Ende. Mir wurde schlagartig übel. Und ich spürte, wie das Abendessen mit langen Beinen meinen Rachen hinauf wanderte. Mit einer Lawine voll Spucke schluckte ich es wieder hinunter, griff mit zittrigen Händen nach meinem Telefon und rief panisch den Notarzt an.
Mit Sirene und Blaulicht kam er herbeigefahren. Rüttelte mich wach. Ich hätte nur geträumt, versicherte mir ein Mann mit krausem Haar und Sommersprossen auf der Nase. „Stopfen Sie das Loch“, befehle ich ihm. Er verschreibt mir Pizza.
Glücklich über diese Entwicklung will ich ihm für seinen Einsatz danken. Da wird sein freches Gesicht plötzlich ganz lang und als ich mich umsehe, ist alles verzerrt. Mein Zimmer eine Kugel. Es dreht sich und ich entdecke mich, wie ich in einem Pferdchen-Karussell sitze. Dann wird alles dunkel. Schwarzer Nebel verschluckt erst den sommersprossigen Notarzt, dann mein Bett, mein Zimmer und schließlich mich und mein Karussell.
Als ich endlich am siebten Tag meine Augen öffnete, spürte ich die Macht der Schöpfung in mir. Es gab wieder ruhige Momente. Meine Gemütslage einigermaßen stabil. Und nachdem ich einmal auseinandergenommen und in Einzelteile zerlegt worden war, spürte ich nun, wie ein Teil das andere fand. Bis nur noch eines fehlte.
Ungelenk setze ich mich auf, stehe auf, taste mich vom Bett zum Bad und beginne mein morgendliches Ritual. Zähneputzen, Haare Kämmen, die Haare hochstecken, Gesicht waschen. Als ich fertig bin und an der Tür zur Küche vorbeigehe, spricht mein Bauch zu mir, aber ich bleibe standhaft und verzichte auf Apfel zum Frühstück. Bis zum Abend will ich nichts essen. Will mir die Qual zur Freude werden lassen. Meine Schritte führen mich an der Küchentür vorbei ins Wohnzimmer. Mein Blick zielstrebig auf den blauen Sessel mit einem Muster aus unzähligen Augen in ägyptischem Stil gerichtet. Ich ignoriere ihren Blick und setze mich auf ihre weitaufgerissenen Augen. Zu meiner Rechten das Fenster. Ein Laken aus grauen Wolken über dem Himmel gespannt. Und der Wind säuselt durch die undichten Rahmen, flüstert mir süße Verheißungen ins Ohr. Ich sage „Nein“ und bleibe sitzen. Zu meiner Linken ein leeres Bücherregal. Da und dort steht eine Kiste, eine Pflanze, oder ein Fotoalbum mit Erinnerungen, die ich längst vergessen habe. Doch die Leere der Bücher wiegt schwer. Ich wende meinen Blick von dem trostlosen Regal ab, schaue stattdessen geradeaus auf die kahle Wand drei Meter von mir entfernt. Höre die Uhr ticken, die dort hängt. Meine Pupillen folgen den Zeigern, bis mein Herzschlag sich ihrem Takt angepasst hat. Bis ich schlafe und der Film in meinem Kopf reißt.
„Ich glaube nicht an Karten“, sage ich zu ihm, als er mich fragt, warum ich keinen Blick auf die Speisekarte werfe. „Dann weißt du nie, was auf der Tageskarte steht, was es Neues gibt und was du vielleicht noch nie gesehen hast“, erwidert er. Ich zucke mit den Schultern. „Ich weiß, was ich will“, sage ich. Und damit es nicht zu schroff wirkt, lächle ich. „Ich auch“, sagt er und klappt die Karte zu. Sieht mich an. „Es fühlt sich an wie in Italien.“ Ich schwenke leicht mein Weinglas, atme den Duft eines Lächelns ein und trinke einen Schluck. „Wie der erste Urlaub.“ Ich stelle das Glas vorsichtig ab. „Als man noch nichts wollte, aber alles bekommen hat.“ Blaue Augen blicken mich an. „Was willst du?“, fragt er. „Ich will Pizza“, antworte ich schnell. Wie auf Befehl kommt eine schlanke Gestalt mit engen Hosen und weißem Hemd zu uns an den Tisch herbeigeeilt. Als ich zu dem ebenso schlanken Gesicht blicke, blendet mich das Licht der Deckenlampe. Ein Heiligenschein umstrahlt den Kopf über mir. „Was darf ich Ihnen bringen?“, fragt die Stimme. Mein Begleiter nickt in meine Richtung. Fordert mich damit zum Sprechen auf. „Ich hätte gerne eine Vierjahreszeitenpizza. Ein Viertel mit Pilzen und Schinken, das Zweite mit Ananas und Schinken, das Dritte mit Büffelmozzarella und das Letzte mit Knoblauch und Austernpilzen. Viel Knoblauch bitte.“ Ich lächle. Schaue mein Gegenüber herausfordernd an. Er ignoriert meinen Blick, seine Hände noch immer auf der Karte ruhend. Dann erhebt er sie, faltet sie, räuspert sich. „Für mich das Gleiche bitte.“ Er sieht mich an. Und wir grinsen beide.
„Man kann das Leben nicht erzwingen“, sagt er zu mir und küsst mich. Einfach so. Über uns der Mond, unter uns bodenlose Schwärze. Zungen, die sich gegenseitig zum Tanz auffordern. Lippen, die sich sanft berühren und in allem ein Zauber liegend, der jeden Zufall ausschließen lässt. Der erste Kuss, der nicht der erste ist, als hätte es nie ein Vorher gegeben und als gäbe es kein Nachher.
Der Nachgeschmack der Pizza liegt in unserem Kuss und obwohl mein Bauch für den Moment voll und satt ist, bin ich es nicht. Ich will mehr. Fordernd umkreise ich mit meiner Zunge die seine und erkunde seine Mundhöhle nach verbliebenen Schätzen. Mein Geschmacksinn auf der Pirsch hat die Fährte aufgenommen, die auf seinen schmalen Lippen endet. Und wie eine Katze, die ihre Beute im Visier hat, werde ich langsam langsamer. Taste mich vorsichtig heran. Will mein Ziel nicht verschrecken, nicht aus den Augen verlieren. Dann setze ich zum Sprung an. Gierig sauge ich an seiner Unterlippe. Knabbere daran und als ich ihm in die vom Mondlicht blau strahlenden Augen blicke, beiße ich zu. Fest. Bis ich Tomatensoße schmecke, rot wie Blut. Unzählige Geschmacksvarianten und Düfte dieser Welt vermischen sich in meinem Mund, in meiner Nase…
Und ich esse ein Stück Pizza zu viel.

Lena Wenzel, geboren 1997 in Krumbach und in Ulm aufgewachsen, studiert derzeit Germanistik und Philosophie an der Universität Augsburg. Am liebsten schreibt sie Kurzgeschichten, ab und zu auch Gedichte. Ihre Inspiration zieht sie vor allem aus der radikalen Kunstauffassung der Avantgarde des 20. Jahrhunderts. Mit ihren surrealistischen Formulierungen rückt sie den Blick des Lesers ins Abnorme. Ihre Spezialität: ein verstörendes Ende. Wenn sie nicht studiert oder schreibt, findet man sie in den Bergen beim Wandern und Klettern, mit einem Buch bewaffnet im Café, oder auf ihrem Pferd durch die Großstadtprärie reitend.