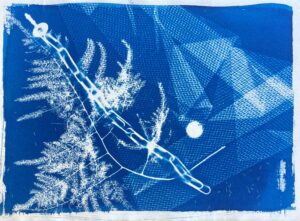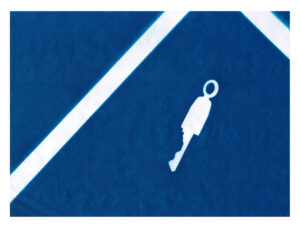von Helena Ressel
Eine Landschaft aus beschriebenen Blättern, aufgeschlagenen Büchern und bunten Klebezetteln. Textmarkerstriche sind überall verteilt und leuchten, krakelige, schnell mit Bleistift hingeschmierte Wörter stehen neben dem Text. Meine Gedanken sind Luftschlösser und die Luftblasen in der alten Heizung klingen wie ein Wasserfall.
Draußen vor dem Fenster höre ich so viele Stimmen, unablässiges Gerede, ein Summen, das allgegenwärtig ist. Autos hupen, lachende Kinder und ein Zug rattert in der Ferne. Die Stadt ist laut zu dieser Tageszeit. Dann denke ich oft an die Wohnung meiner Großmutter, wo die Großstadt nur eine Ansammlung von Strichen am Horizont ist. Im Erdgeschoss und an der Straße, aber grün und still wie auf dem Friedhof.
Wenn sich hier die Autos reihen, mittags vor der Ampel, sich Schlangen bilden in jede Richtung, dann stinkt die Straße. Dann stinkt die Stadt. Ich bin damit aufgewachsen.
Ich verfolge den Sekundenzeiger bei seinem Weg einmal im Kreis herum. Noch ein bisschen lernen, dann habe ich mir den Mittagsschlaf verdient. Drei Stunden sind genug. Zugegeben mit Ablenkung. Aber wäre ja auch krank sonst. Draußen im Gang höre ich es rascheln. Einstein ist anscheinend aufgewacht. Das fette Meerschweinchen ist keine sonderliche Bereicherung für diese Wohnung. Er kann gar nichts, raschelt in seinem Stroh und gluckert mit seiner Trinkflasche in einer unnatürlichen Lautstärke, immer genau dann, wenn man seine Ruhe will. Auch in der Nacht, weshalb sein Käfig auch nicht mehr bei Henry im Zimmer steht. Ich schließe die Türe und kehre zum Schreibtisch zurück. Die ganzen Arbeitsblätter und Bücher, Texte, Sätze, Worte.
Eigentlich kann ich das alles doch schon, rede ich mir ein, beuge mich aber dann doch noch einmal über die Lektüre.
»Wo bin ich?«, denke ich, als ich plötzlich aus dem Schlaf hochschrecke. Mein Kopf liegt auf einem Buch, ein Textmarker sticht mir ins Ohr. Ich richte mich auf und suche panisch nach der Uhr. Verschlafen wie ich bin, brauche ich ewig bis Zeiger und Ziffernblatt einen Sinn ergeben. Halb zwei. Ich bin zuhause. Ich kenne jeden Zentimeter dieses Zimmers. Ich bin beim Lesen eingeschlafen, das ist alles. Obwohl mein Kreislauf verrücktspielt, als ich aufstehe, schaffe ich es zum Fenster. Draußen gibt es nichts Neues. Der hellgraue Himmel leuchtet mir unfreundlich entgegen und blendet meine Augen. Der Boden ist kalt und es ist stickig. Ich reiße die Fenster auf und kuschle mich in eine Decke. Dann ein erneuter Blick auf die Uhr. Henry kommt erst in zwei Stunden heim. Kinderbetreuung in der Nachbarschaft. Die haben auch in den Ferien auf. Bis vier kann ich noch einiges schaffen. Danach wird Henry mich ablenken. Es wird mich nerven. Aber Recht hat er. Ich verbringe eigentlich viel zu wenig Zeit mit ihm.
Ich schlurfe in die Küche und stürze ein Glas Wasser hinunter. Dann zurück zum Schreibtisch. Wo war ich stehengeblieben? Wo will ich weitermachen? Die Auswahl ist groß. Navajo Code Talker im zweiten Weltkrieg? Provisorische Glossierung indonesischer Sätze? Dia mənǰerit… Übersetzung: Sie schreit … Oder doch Definitionen der Neuroanatomie: Broca, Wernicke, Sprachlateralisierung. Ich quäle mich durch den Stoff und die Zeit rinnt wie Sand durch meine Finger. Eineinhalb Stunden später fällt mir auf, wie alleine ich bin. Es fühlt sich an wie ein kühler Wind auf nasser Haut.
Draußen tobt das Leben, es ist laut. Menschen, Tiere, Autos. Sie alle hetzen vorbei. Bei mir ist es still. Die Heizung hat aufgehört zu gluckern, und obwohl ich die Tür offen gelassen habe, kommt auch von Einstein kein Geräusch.
Halbe Stunde, denke ich, dann kommt Henry.
Henry ist ein fröhliches Kind. Manchmal denke ich, so viel zu lachen ist doch nicht normal. Und dann denke ich, dass er noch ein Kind ist. Erst ein paar Jahre auf dieser Welt und gut behütet, immer umsorgt und geliebt. Manchmal ist er richtig übermütig, manchmal ist er schüchtern. Versteckt sich hinter Papas Füßen, guckt vorsichtig an ihm vorbei, mit dem kritischen Blick eines Jurors Mitte Fünfzig. Mama sagt, dass Henry und ich das Beste von ihr und Papa in uns vereinen. Wenn ich daran denke, wie wenig Talent ich in Bezug auf fast alles auf dieser Welt besitze, bin ich mir da nicht so sicher. Aber vielleicht wird es meinem kleinen Bruder da anders gehen, wenn er älter ist.
Ich versuche mich wieder auf die Texte zu konzentrieren, langsam bekomme ich Kopfweh, aber ich darf das jetzt nicht aufschieben. Minuten, in denen ich ins Leere starre. Habe ich eine Konzentrationsschwäche oder einfach keine Lust mehr? Mir ist kalt. Ich horche auf. Henry? Nein, da ist nichts. Kein Geräusch. Etwas fehlt. Ich gehe nachschauen. Das Rascheln!
Im Gang dämmriges Licht. Der Käfig am anderen Ende. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Trotzdem gehe ich näher ran, ich gehe vom Schlimmsten aus, das tue ich immer. Dann sehe ich das Tier im Stroh liegen. Offene Augen. Glasiger Blick. Keine Reaktion. Ich fass ihn an. Er ist steinhart und kalt.
»Wein jetzt bitte nicht, Henry, er war alt, das weißt du doch. Und sowieso nicht mehr fit und übergewichtig«, sage ich, als wir noch in der Tür stehen. Als er das tote Tier sieht, hört er mir nicht mehr zu.
»Hey Einstein! Einstein!«, ruft er immer wieder. Das Meerschwein ist tot, denke ich. Die Nervensäge ist weg. Hendry drückt seinen Finger immer wieder in das Fell und gegen den starren Bauch. Er spürt doch gar nichts, denke ich. Und merke, wie wenig ich selbst spüre. Was ich spüre, ist Anspannung. Was soll ich jetzt tun? Mit Henry und mit dem Meerschwein? Und Zeitdruck. Ich hab zu tun, muss weiter lernen. Seminare, Hausarbeiten und Klausuren. Schlafen wäre schön, statt nachts an die Decke zu starren. »Du knirschst nachts«, hat die Zahnärztin gesagt und mir eine Schiene und Physiotherapie verordnet. Dabei ist doch sowieso wenig Zeit.
Henry wimmert. »Einstein ist tot«, sage ich. Jetzt weint er. »Seit einer halben Stunde schon«, füge ich hinzu und kühle meine heiße Stirn mit einem feuchten Lappen. Zu viel gelernt, zu wenig behalten.
»Mach, dass er wieder lebt!«, schreit Henry. Und ich starre ihm in das tränennasse Gesicht. Beinahe zucke ich mit den Schultern. Beinahe. Doch dann gehe ich in die Knie und breite meine Arme aus, damit er hineinlaufen kann. So wie Mama. Und er kommt, krallt seine kleinen Finger in meinen Pulli und drückt seinen kleinen Kopf in meine Halsbeuge, sodass ich seinen hysterischen Atem auf meiner Haut spüren kann. Sein Körper zuckt, während er vor sich hin heult. Ihn halten und trösten, mehr kann ich nicht tun. Was tot ist, ist tot, denke ich.
»Ich bringe ihn runter in den Keller, da ist es kühl«, sage ich. Henry streichelt Einstein noch mal über den Kopf. »Da kann ihm nichts passieren«, sagt er und ich nicke.
Die Kellertreppe ist steil. Einmal fast ganz im Kreis herum, dann stehe ich unten und das bisschen Licht, das von der Decke kommt flackert. Es ist kühl, feucht und muffig hier. Nein, denke ich. Hier unten sollte kein totes Tier liegen. Und ich drehe mich wieder um.
»Was ist los?«, fragt Henry, der immer noch am Boden sitzt. »Ist zu dunkel da unten.« Er folgt mir zur Balkontür. »Draußen ist es kalt genug. Mach mal auf.« Er schaut mich skeptisch an. »Wird er da nicht gegessen?« Ich sehe ihn fragend an. »Weil er doch tot ist. Er kann nicht mehr beißen«, erklärt er mir und bleibt an der Tür stehen. »Es gibt hier keine so großen Katzen«, antworte ich und hoffe, dass ihm das genügt. Von den Mardern erwähne ich nichts.
Henry scheint beruhigt, zumindest fragt er nicht weiter. Er bleibt an der Glastür stehen und starrt das tote Tier an, als würde Einstein nur ein Schläfchen halten und gleich wieder aufwachen und weiter im Stroh wühlen. Ich weiß, dass er darauf wartet, dass genau das passiert. Ich lasse ihn ein paar Minuten alleine.
»Lass uns spazieren gehen«, rufe ich dann aus dem Gang Richtung Wohnzimmer, hole meinen Mantel und ignoriere die Ordner auf dem Schreibtisch. Ich mache mir zu viel Stress. Ich bekomme das schon hin. Henry geht vor. Ich will ihn ablenken. Und mich vielleicht auch.
»Schlaf gut, Einstein«, sagt Henry, dann gehen wir raus.
Im Park gibt es einen Teich mit Enten. Henry liebt Enten. Er wird ganz wild vor Freude, wenn er die trockenen Semmeln zerbröselt.
»Wenn Mama und Papa heute Abend heimkommen, überlegen wir uns, wo wir Einstein begraben«, sage ich. Er nickt und ich sehe, dass er fast wieder zu weinen anfängt. Ich nehme seine Hand. »Er ist jetzt bei Oma. Die freut sich sicher!«
»Denkst du, da oben hat er es schön?«, Henry schaut hinauf in den grauen Himmel und bei den vielen Wolken kann ich seine Zweifel schon verstehen. Trotzdem nicke ich, als wäre das selbstverständlich.
»Wahrscheinlich hat er einen riesigen Käfig. Und jemand geht mit ihm im Park spazieren wie Luis mit seinem Hasen!« Henry ist wirklich ein Stadtkind. Der Himmel für ein Meerschweinchen? Ein großer Käfig und ein Spaziergang an der Leine in einem Stadtpark.
Bevor Oma ins Krankenhaus gekommen ist, hat sie Henry Einstein geschenkt. Er hatte sich einen Hund gewünscht. »Ein Hund in der Großstadt? Was soll denn das?!«, hat sie gemeint und stand zu seinem Geburtstag mit dem Meerschwein vor unserer Tür. Schwarzweiß, runde Knopfaugen. Aus dem städtischen Tierheim. »Vielleicht ist es ein Bauernhof«, überlege ich. »Denkst du nicht, das würde Einstein gefallen?«
»Ja sicher!«, jetzt lächelt Henry das erste Mal. Ich drücke seine Hand und bin froh, dass ich ihn habe.
»Da vorne sind die Enten!«, ruft Henry plötzlich und zieht mich an der Hand hinter sich her. »Enten! Enten!«, schreit er und wir beginnen zu laufen.

Helena Ressel wurde 1997 in München geboren und ist in Burghausen an der Grenze zu Österreich aufgewachsen. Nach dem Abitur studierte sie in Regensburg erst Biologie, entschied sich letztlich aber für Medien- und Sprachwissenschaften. Seit sie 13 Jahre alt ist schreibt Ressel literarische Texte. Bei der Bayerischen Akademie des Schreibens hat sie zum ersten Mal mit anderen zusammen an Texten gearbeitet.