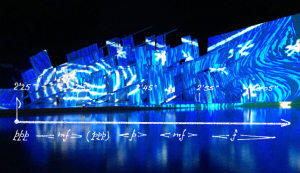Ron Winkler und Christian Schlosser im Gespräch über poetologische Positionen in der Lyrik
Ron Winkler: Du hast mir einmal geschrieben, dass sich Deine Gedichte permanent den eigenen poetologischen Überlegungen widersetzen. Könntest du das etwas näher erläutern, wie sich das Poetische den Intentionen des Autors fremd macht? Diesen Prozess der Verselbständigung …
Christian Schloyer: Dazu müsste ich ein Stück weit ausholen, um meine Intentionen etwas einzukreisen. Lars-Arvid Brischke hat neulich Gedichte mit den Apparaturen des Schweizer Künstlers Jean Tinguely verglichen. Das gefällt mir gut. Für Gedichte — so wie sie mir vorschweben — bedeutet das, dass sie sich der misshandelten Sprache annehmen. Sie brechen mit der werbegeleckten Sprachoberfläche, mit dem Glatten, Zugänglichen, Zudringlichen, Kitschigen und Aufdringlichen — und bauen aus dem Schrott etwas, was nicht mehr
unheimlich ist. Dieses Neue darf nur eines nicht sein: sinnvoll — im Sinne von »verwertbar«. Wenn es einen Sinn ergeben soll, dann ganz für sich selbst, einen bloßen
Eigensinn. Was sich aber nicht ergeben darf, ist eine Bedeutung: es gibt nichts, was
anstelle eines Gedichtes stehen könnte, nichts, was durch ein Gedicht lediglich bezeichnet, benannt, gesagt oder dargestellt wäre. Das Bezeichnen, Benennen bzw. Darstellen ist ein an sich paradoxer Vorgang: wie will man
etwas bezeichnen (benennen, darstellen), wenn jedes
denkbare Etwas erst durch das Bezeichnen selbst existent wird? Bezeichnen ist ein schöpferischer Gewaltakt, der Realität generiert. Diese Realität wird zu etwas Unumstößlichem, zu einem tyrannischen Dogma, sobald man vergisst, dass sie sprachliches Gebilde ist, d.h. dass sie lediglich der Spontaneität sprachlich verfasster Wahrnehmung entspringt. Dann nämlich nehmen wir nur noch auf Basis vorselektierter, eingeschränkter bis grob verhunzter Sprachlichkeit wahr und verlieren die Fähigkeit, verantwortlich (d.h. gestalterisch!) mit Realität umzugehen. Große Beispiele für festgefahrene und daher missgestaltete Realitäten sind »Gottesgnadentum« oder »freie Marktwirtschaft« oder »Globalisierung«. Das Gedicht ist ein Sprechen im Sinne eines befreienden Erinnerungsvorgangs: es stellt, sofern es Poesie ist, die Monsterapparatur des ökonomisierten Alltagssprechs kraft seiner Existenz in Frage. Zumindest ein ganz kleines Bisschen. Das tut es, indem es ostentativ etwas durch Sprache erschafft — und so demonstriert, dass Sprache schöpferisch ist. Die Alltagssprache verfährt genau umgekehrt: dadurch, dass in ihr der schöpferische Akt verborgen bleibt, täuscht sie erfolgreich vor, dass sie nichts erschaffe — was uns denken lassen soll, alles wäre schon (unveränderbar) so da, wie es die Sprache angeblich vorfindet. Nun haben diese Gedanken jedoch einen Haken, und dieser Haken ist die Antwort auf die Frage, inwiefern sich meine Gedichte den eigenen poetologischen Überlegungen widersetzen. Wenn Gedichte etwas Neues aus dem vorgefundenen Material der Alltagssprache generieren, dann können sie Sprache zerstückeln, verdrehen, neu zusammensetzen und insofern schöpferisch regenerieren. Sie greifen damit aber immer auf etwas Vorhandenes zurück: auf die Alltagssprache selbst. Jede Arbeit an der Sprache ist indirekt auch Bestätigung des vorherrschenden Sprachmaterials — es wird lediglich in Frage gestellt, dass dieses Material in einer (durch eine »unveränderliche Realität«) vorherbestimmten Weise zusammengefügt werden muss. Die Bruchstellen dieser Versatzstücke jedoch widersprechen letztlich auch diesem In-Frage-Stellen, sie raunen hartnäckig: ich gehöre nicht hierher, denn ich
bezeichne eigentlich etwas. So entsteht um das Gedicht herum ein weites Assoziationsfeld, wie Licht, das auf die Glasbruchstücke einer Discokugel trifft und einen ganzen Raum ausmalt. Diesem Raunen und Reflektieren nachzugehen scheint die Aufgabe der Gedichtinterpretation zu sein. Ich bin mir nicht sicher, ob Dichten nicht vielleicht sogar der Versuch sein soll, diese Bruchstücke deutlich zu Tage treten zu lassen. Ihnen das Raunen also zu erlauben — und mit ihrer Hilfe eine »eigentliche, hinter der Sprache befindliche Welt« zu simulieren — die freilich eine andere sein soll, als die in der Alltagssprache vorgefundene ökonomisierte Welt. Nicht ganz neu, ein ähnliches Programm hatte bereits die Romantik — und es war damals schon ein großartig vergebliches Bemühen. Vergeblich aber eben nicht deshalb, weil nur die vorgefundene Alltagssprachrealität die einzig mögliche wäre, sondern vergeblich in dem viel grundsätzlicheren Bemühen, auf der Suche nach einer Welt hinter der Alltagswelt sogleich hinter die Sprache selbst zu gehen, ins Magische. Poetisch ist ein solches Tun insofern, dass es innerhalb der Koordinaten eines ökonomisierten Alltagssprechens offenkundig keinen Sinn ergibt. Trotzdem stellen sich mir Fragen: Ist unser Sprachschrottmaterial für ein solches Unterfangen geeignet? Und kritischer: Funktioniert ein derart »romantisches« Programm als Simulation, als ostentativ luzide Vergeblichkeit? Oder soll es eher darum gehen, diese Brüche so ineinander zu fügen, dass man sie nicht mehr als solche wahrnimmt? Also ein (von hier aus gesehen) unsinniges Paralleluniversum zu erschaffen, eine Umschrift der Welt? Das wäre das (ebenfalls nicht neue) Programm einer autonomen Gegenwelt der Kunst — l’art pour l’art. Doch ohne Bruch (oder: Sollbruchstelle) begibt sich das genauso in Gefahr, dogmatisch zu werden. Das hieße, das eine Absolutum durch ein anderes zu ersetzen. Aber vielleicht ist das eine Luxussorge, die man getrost hintanstellen kann. Alles, was den sprachlichen Status quo hinterfragt, scheint mir zunächst einmal gut zu sein. Und weil unsere Gefangenschaft in der falschen, weil ökonomischen Sprache ein brisantes Politikum ist, ist jedes Gedicht, das sich an Sprache abarbeitet, potentiell politisch — während Gedichte, die dem modischen Social-Beat verfallen, ein Ausverkauf des Politischen sind: die für sich in Anspruch genommene lebensweltliche Notwendigkeit nehme ich den Texten und ihren Autoren in den seltensten Fällen ab. Gesellschaftskritik ohne Sprachkritik ist Authentizitäts-Schmuckwerk für Lyrik, die am vermeintlichen Puls der Zeit sein will. Denn ein von ökonomischen Zwängen bestimmter Sprachgebrauch ist nicht
Vermittler einer ungerechten sozialen Wirklichkeit, sondern ihre Ursache. Politische
Bezüge kann und soll Lyrik gerne haben, eine politische
Message aber bitte nicht, vor allem nicht zu Unterhaltungszwecken. Abschließend sei bemerkt, dass ich mein Scheitern eingestehen müsste, wenn meine Gedichte lediglich »Umsetzung« poetologischer Reflexionen wären. Es ist eher umgekehrt: Gedichte sind Impulsgeber zum Über-sie-Reflektieren. Sobald ich an und mit Gedichten nur etwas demonstrieren (sagen) wollte, würde im Erfolgsfall das zu Demonstrierende (das Gesagte) an die Stelle des Gedichtes treten — meine Gedichte wären dann bloßer Verweis auf eine (in meinem Fall erkenntnistheoretisch eingefärbte) Fragestellung. Der Zweifel am eigenen Tun muss im Übrigen zum künstlerischen Handeln dazu gehören. So könnte man auch bei den Tinguely-Apparaturen fragen: Stehen sie wirklich für sich oder demonstrieren sie lediglich etwas (z.B. die Unmöglichkeit des Für-sich-Stehens)?
Ron Winkler: Und demzufolge begeistern dich welche poetischen Entwürfe? Namen, Kosmen.
Christian Schloyer: Kosmen: Natürlich Celan. Der frühe Celan bisher mehr als der spätere. Ein Gedicht wie die »Todesfuge« durchkreuzt die Nullpunkt-Naivität der Kriegsheimkehrer, nach 1945 plötzlich in einer neuen, einfachen und von jeder Schuld befreiten Sprache dichten zu wollen, mit brillant schauderhafter Sprachschönheit. Ich kenne bis heute keine Dichtung, die sprachmächtiger, unversöhnlicher und ambitionierter wäre als seine. Der Schmerz darüber, ein derartiges Niveau niemals erreichen zu können, war für mich beinahe stark genug, authentische Gedichte hervorzubringen. Wirklich fruchtbar war für mich allerdings die mühsam erschriebene Erkenntnis, dass eine Celansche Schwere Gift für meine Gedichte ist. Ich weiß, dass ich hier bestenfalls mit einer homöopathischen Dosis arbeiten darf. Immer beeindruckt hat mich auch die intellektuelle Konstellation der Frühromantik. Die Verschwisterung mit der Philosophie. Kant. Fichte. Die (im Gegensatz zur katholizistischen Hoch- und Spätromantik) unglaubliche Beweglichkeit und Offenheit der Poetologien. Eine wirkliche Notwendigkeit zur Lyrik entsteht für mich nicht zuletzt da, wo man sich emotional an philosophischen (insbesondere erkenntniskritischen) Fragestellungen abarbeitet. Dann ist das plötzlich keine sportliche Intellekt-Jonglierübung mehr, sondern kommt mit der eigenen Lebenswirklichkeit in Berührung — das ist existentiell, potentieller Wahnsinn. Wer damals Kant wirklich begriffen hatte, war natürlich reif für die Irrenanstalt. Während ein Philosoph mit mangelndem Sprachvertrauen sich seine Grundlage entzieht, blüht da ein Lyriker erst richtig auf (wenn auch nicht immer in einem gesunden Sinne). Ich finde ambitionierte Poetologien spannend — auch dann, wenn die dazugehörige Lyrik, wie z.B. bei Thomas Kling, für meinen Eindruck hinter ihrem poetologischen Anspruch zurück bleibt. Bewegt haben mich auch Dieter Schlesaks »Fragmente zu einer posthumen Poetik« (gefunden im Band »Tunneleffekt«). Höchst interessant der Streifzug durch Jennifer Poehlers Gedichtband »Türkises Alphabet«. Eine Entdeckung, die für mein eigenes Schreiben prägend war, sind Gedichte der Berliner Lyrikerin Cornelia Schmerle. Insgesamt finde ich die Texte von Lyrikerinnen gegenwärtig spannender als die Texte von Lyrikern.
Dieser Beitrag erschien erstmals in “Hermetisch offen” in der Reihe “intendenzen. Zeitschrift für Literatur” als Heft Nr. 11, herausgegeben von Ron Winkler (Berlin, 2008). In “Hermetisch offen” geben 22 junge Gegenwartslyrikerinnen und ‑lyriker Auskunft über ihre poetologischen Positionen.