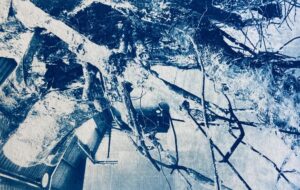von Vera Podskalsky
Ein Geschichtenerzähler, der, als Teil einer Geschichte, Geschichten erzählt, um zu überleben — das erinnert doch stark an den allseits bekannten Mythos aus „Tausendundeine Nacht“. Jan Koneffke verwendet diesen Mythos in seinem neuen Roman Die sieben Leben des Felix Kannmacher (2011) und versieht ihn mit zusätzlichen Bedeutungsebenen.
Sein Geschichtenerzähler Felix Kannmacher, ein Charakter, der aus Jan Koneffkes früherem Roman Eine nie vergessene Geschichte (2008) bekannt ist, ist Teil der historischen Wirklichkeit. Der ehemalige Barpianist ist aus Nazi-Deutschland geflohen, nachdem ihm ein SA-Mann bei einem Sturm auf ein jüdisches Restaurant drei seiner Finger zertrümmert hat. Nun muss er mit seinen Erzählungen die launische Virginia, die Tochter seines Fluchthelfers Victor Marcu, der Kannmacher in Rumänien als „Kindermädchen“ eine neue Identität verschafft hat, bei Laune halten. Er unterhält sie mit verschiedenartigsten mythischen Erzählungen, damit sie ihn nicht aus Missmut in gefährliche Situationen bringt.
Bald bekommt das Erzählen ums Überleben aber auch noch eine neue Dimension: Von Geschichte zu Geschichte scheinen immer mehr Figuren aus dem Umfeld Kannmachers zu Figuren in seinen Erzählungen zu werden. Der Protagonist beginnt, das Schicksal der Menschen, die ihn umgeben, und damit auch sein eigenes Schicksal so zu verändern, wie er es gern hätte. Auch als er längst nicht mehr bei Marcu lebt, der ihn unter einem Vorwand hinausgeworfen hat, weil er eifersüchtig auf das gute Verhältnis zwischen Tochter und „Kindermädchen” gewesen ist, denkt er sich weiter Geschichten aus.
Und sein Schicksal gibt ihm allen Grund, seine eigene Lebensgeschichte verändern zu wollen: Er lebt in ständiger Angst, von den Nationalsozialisten aufgespürt zu werden und muss schreckliche Vergehen an seinen jüdischen Freunden miterleben. Ironischerweise wird er schließlich nicht von den Nationalsozialisten gefunden, sondern von der neuen kommunistischen Regierung in Rumänien verhaftet und nach schrecklicher Folter zu Unrecht verurteilt, da man ihm Zusammenarbeit mit dem Nazi-Regime vorwirft. Koneffke beschreibt den Lebensweg des jungen Mannes bis ins hohe Alter hinein und gibt für jedes Kapitel die genaue Zeitspanne an, die sich insgesamt von 1935 — 2001 erstreckt.
So akribisch Koneffke einerseits mit historischen Persönlichkeiten und Ereignissen arbeitet, so leichtfertig überlädt er das Geschehen andererseits mit übertriebener Dramatik und einer Häufung von Schicksalsschlägen, die zu einem unerwartet guten Ausgang führen. So trifft Kannmacher zum Beispiel – lange nachdem er seinen Kindermädchenposten verloren hat – zufällig auf Virginia, die inzwischen zu einer selbstbewussten jungen Frau herangewachsen ist. Diese schicksalhafte Begegnung bleibt natürlich nicht folgenlos, hieraus entwickelt sich eines der zentralen Motive des Romans: Die unwirklich erscheinende Romanze zwischen Geschichtenerzähler und Zuhörerin.
Aber vielleicht ist diese Unwirklichkeit auch beabsichtigt. Bis zum Schluss treibt Koneffke das Spiel mit der Fiktionalität immer weiter, am Ende ist es schwierig, zwischen Geschichte in der Geschichte und eigentlicher Geschichte unterscheiden zu können. Der unzuverlässige Ich-Erzähler scheint nun endgültig seine Lebensgeschichte nach seinen eigenen Vorstellungen zu Ende geschrieben zu haben. Dieses Spiel wäre allerdings noch reizvoller, wenn der Ich-Erzähler den Leser zu Beginn jeden Kapitels nicht immer wieder explizit und in geradezu einbläuender Weise darauf hinweisen würde, dass er seine Geschichte für erfunden halte, dass er sich nicht sicher sei, ob nicht alles doch nur ein Traum gewesen sein könne.
Neben diesem Spiel mit Fiktionalität sind es die vielschichtigen, oft humoristischen Zeichnungen der Charaktere, die den Roman lesenswert machen. Da wäre zum Beispiel Marcu als selbstherrlicher Starpianist, der sich je nach Vorteil jedwede politische Einstellung zulegen kann oder der gleichgültige Dandy Haralamb Vona, der sich als wahrer Freund entpuppt. Humoristisch verfasst sind auch die Kurzzusammenfassungen jedes Kapitels, die Koneffke seinen Ich-Erzähler vorausschicken lässt. Sie werden erst nach der Lektüre des Kapitels tatsächlich verständlich und verleiten dazu, den Galgenhumor des Protagonisten zu übernehmen. Immer wieder werden Reflexionen über den Glauben und den Sinn des Lebens zwischengeschaltet, die durch wiederholt aufgegriffene Wendungen, wie z.B. den „Gott des Massels und Schlamassels“ unterstützt werden. Die Behandlung dieser „Sinn-Fragen“ scheint die übertriebene Dramatik der Handlung zu ironisieren und auf die Spitze zu treiben.
Nach der Lektüre des sehr umfangreichen Romans bleibt der Leser jedoch ein wenig ernüchtert zurück: Zum einen, weil der irgendwann verebbte Lebensdrang Felix Kannmachers bis zum Schluss nicht mehr richtig zu erwachen scheint. Zum anderen, weil der Roman fast schon eine Aneinanderreihung brutalster Vorgehensweisen verschiedenster Terrorregimes dieser Zeit enthält und durch detailreiche Beschreibungen den Schrecken in seinem gesamten Umfang deutlich werden lässt. Fast wünscht man sich, dass es sich auch hier um eine erfundene Geschichte handelt, in der, wie Kannmacher als Begründung für seine Lust am Erfinden anführt, „nichts unwiderruflich ist und nichts, was sich in der Vergangenheit abspielte, notwendig.“
Jan Koneffke: Die sieben Leben des Felix Kannmacher
Dumont Verlag 2011
507 Seiten