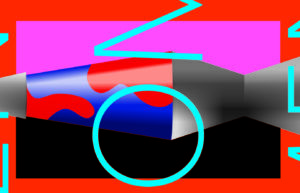Ein Gespräch mit Kristof Magnusson
von Manuel Illi
Wo gehört man hin? Wie will man leben? Der Autor Kristof Magnusson geht diesen Fragen nicht nur in seinen Theaterstücken und Romanen (Zuhause, 2005; Das war ich nicht, 2010) nach. Im Interview mit Schau ins Blau erklärt er, warum man nicht erst die Heimat verlassen muss, um sich fremd zu fühlen, was sich hinter dem Wort ‚Zuhause‘ alles verbergen kann und warum Generationsetikettierungen wenig Sinn machen.
SCHAU INS BLAU: Kristof, Du hast Dich mit dem Thema Fremdheit schon intensiver beschäftigt?
KRISTOF MAGNUSSON: Ja, ein Freund, Michael Kratz, und ich werden bei einer Sommeruniversität dieses Jahr dazu ein Seminar geben. Der Titel ist „Zuhause in der Fremdheit”. Michael ist Diplomat beim Auswärtigen Dienst im Migrations- und Asylreferat. Auf der einen Seite wollen wir von einer politischen Perspektive ausgehen und zum Beispiel klären, was das heißt: „Politisch Verfolgte genießen Asyl”. In einem zweiten Block wollen wir dem Gedanken nachgehen, wie in Literatur damit umgegangen wird. Es gibt ja wahnsinnig viel Literatur, in der Autoren entweder einer verlorenen Heimat hinterherschreiben oder versuchen, sich in der Fremde zurechtzufinden. Man könnte sagen, dass es sich um zwei Bewegungen handelt, einerseits das Erinnern und andererseits das Verarbeiten von Fremdheitsgefühlen an dem Ort, wo man ist. Beides sind ganz starke Schreibanlässe.
SCHAU INS BLAU: Was fasziniert Dich an dem Thema?
KRISTOF MAGNUSSON: Merkwürdigerweise hat mich das Thema schon immer interessiert, obwohl ich selber in Hamburg geboren und dort aufgewachsen bin und die ersten zwanzig Jahre meines Lebens nicht einmal umgezogen bin. Unmittelbar gibt es in meiner Biographie keine Migration — abgesehen von dem bikulturellen Hintergrund Deutschland-Island. Mir war immer klar, dass Deutsch meine Muttersprache ist und ich in Hamburg zu Hause bin. Island war immer meine zweite Heimat. Wahrscheinlich braucht man gar keine Fremdheitserfahrung; eine Zuhauseerfahrung kann genauso dazu führen, dass man nach den Faktoren fragt, die das definieren, wo man sich zu Hause fühlt. Und Schriftsteller überlegen sich dann natürlich ganz schnell: Wie narrativiert man das? Und so gelangt man ebenso schnell beim Schreiben zu der Frage: Wo gehört man hin? Wo will man sein? Ähnlich wichtig ist für mich in Das war ich nicht die Frage: Wie will man leben? Ich bin immer sehr vorsichtig mit Aussagen wie: Heute wird die Welt immer unübersichtlicher oder gewalttätiger. Das halte ich für einen höchst ärgerlichen Blödsinn. Der einzige Punkt, an dem man so etwas, wie ich finde, zu Recht sagen kann, ist die Auflösung der Biographien. Denkmuster wie: Man ist jung und suchend, dann lässt man sich nieder und schließlich findet man seinen Weg — das zählt heute alles gar nicht mehr. Das ist tatsächlich ein Kennzeichen unserer Zeit, das nachzuerzählen ich immer wieder aufregend finde.
Das Zuhause ist letztendlich auch immer voll von Fluchtbewegungen — die Vergangenheit holt einen immer wieder ein. In meinem neuen Roman ist das auch so: Alle drei Protagonisten hauen ab und merken dann, dass sie sich selber mitnehmen müssen. Ich habe einmal ein Theaterstück mit einer Obdachlosentheatergruppe gemacht: Ratten 07. Das war an der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin mit einem Ensemble von Obdachlosen, die Frank Castdorf zusammengebracht hat: Ursprünglich haben sie Büchner, Sartre, und so weiter gespielt. Irgendwann wollten sie ein eigenes Stück entwickeln und das habe ich mit ihnen gemeinsam geschrieben. Das Thema war für mich also schon immer da. Vielleicht ist das Interesse auch durch meinen Zivildienst mit Aktion Sühnezeichnen in New York entstanden, wo ich mit Holocaustüberlebenden und Obdachlosen gearbeitet habe. Beide Gruppen haben ganz verschiedene aber trotzdem tiefe Entwurzelungserlebnisse.
SCHAU INS BLAU: Entwurzelungserlebnisse werden auch in Das war ich nicht beschrieben. Für Henry LaMarck, ein Bestsellerautor unter Erfolgsdruck, bedeutet die selbst gewählte „Flucht” aus den USA allerdings die Möglichkeit eines Neuanfangs. Um was für eine Art von Flucht handelt es sich dabei?
KRISTOF MAGNUSSON: Wenn einen nicht äußere Umstände entwurzeln, kann man das hervorragend selber machen, zum Beispiel dadurch, dass man sich von seinem eigenen Leben entfremdet. Das kennen wahrscheinlich sehr viele Leute: Man lebt ein Leben und findet es ganz okay. Und trotzdem erodiert es kaum merklich, bis man an irgendeinem Tag realisiert, dass es so nicht mehr weitergeht. Es ist natürlich eine Art Luxusproblem, aber von denen ist es dasjenige, das mich am meisten reizt. Maike Urbanski in Das war ich nicht sagt: Ich hatte Heimweh obwohl ich seit zehn Jahren hier gelebt habe. Heimweh nach einem Ort, von dem ich nicht wusste wo er war. Das sich Zuhause-Fühlen kann an einem Ort, an dem man lange wohnt, auch absterben und das geschieht meist schleichend.
SCHAU INS BLAU: Vollzieht sich ein ähnlich schleichender Prozess auch in Deinem Roman Zuhause?
KRISTOF MAGNUSSON: Ja, und das ist immer auch literarisch interessant, man kann mehr in die Tiefe schauen, da es sich eben nicht um einen großen Knall handelt. Und abgesehen davon ist ein langsamer Prozess natürlich auch rein handwerklich eine schöne Sache, da man dauernd Motivverbindungen herstellen kann zwischen den Schauplätzen und den Figuren. Man kann mit dieser Interaktion besser Verdichtung erzeugen. Das ist auch in Zuhause der Fall: Familie ist in Island wahnsinnig wichtig und an Weihnachten ganz besonders. Insofern war es logisch, dass der Roman in Island spielen musste, weil das meiner Meinung nach die maximale Verdichtung des Familienthemas ist: Island — Weihnachten. Bei Das war ich nicht ist die Verbindung nicht ganz so stark, aber dennoch vorhanden. Die Stadt Chicago mit ihren Straßen auf mehreren Ebenen, auf denen Leute wunderbar aneinander vorbeigehen können, zeigt das, worum es in dem Roman geht: um das Aneinander-Vorbeigehen. Oder auch das an sich selbst Vorbeigehen, indem man sich Dinge vormacht, was wiederum auch der Erzählweise des neuen Romans geschuldet ist. Der Selbstbetrug lässt sich hervorragend zeigen, wenn man drei verschiedene Ich-Perspektiven hat. Wenn eine Figur sich dauernd selbst betrügt, kann das aus der Gegensicht einer anderen schön entlarvt werden. Es greifen nicht nur Ort und Personenkonstellation ineinander, sondern auch die Erzählweise.
SCHAU INS BLAU: Im Roman Zuhause gibt es noch eine andere Figur, eine Cutterin, die Larus’ Film schneidet. In der Vorweihnachtszeit fragt er sie beiläufig, ob sie zu den Festtagen nach Hause fährt. Sie antwortet, „sie sei jedes Weihnachten bei sich zu Hause, wo auch immer sie sei, wenn Zuhause nicht sowieso ein Konstrukt sei, genau wie freier Wille und Geschlechter”.
KRISTOF MAGNUSSON: Ja, das ist so ein bisschen Häme…
SCHAU INS BLAU: Wir wissen also scheinbar, dass Heimat und Zuhause Konstrukte sind, aber trotzdem sitzen wir diesen Konstrukten auf — ganz wie die Cutterin, die trotz allem emotional reagiert.
KRISTOF MAGNUSSON: Das ist doch die Postmoderne, oder? Dinge reflektieren, als Konstrukte entlarven und dann trotzdem machen; dieser Wille, inkohärente Denkbewegungen einfach parallel laufen zu lassen, ohne sich fragen zu müssen, wie die Widersprüche zu versöhnen sind.
SCHAU INS BLAU: Und außerdem ist ‚Zuhause‘ nicht mit ‚Heimat‘ gleichzusetzen, oder? Heimat ist ein großer Begriff. Heimat ist größer als das Individuum, das sagt: Das ist meine Heimat. Sie ist verbunden mit Sprache, mit Ritualen, mit der Landschaft usw. Das Zuhause dagegen ist etwas, das der Gestaltung des Einzelnen unterworfen ist und bietet mehr Raum für Willkür. Heimat kann man nicht willkürlich gestalten.
KRISTOF MAGNUSSON: Man bindet sich mit dem Erwähnen des Wortes ‚Heimat‘ immer in einen kulturellen Kontext ein — einmal abgesehen davon, dass es für manche Leute noch unangenehm völkisch klingt. So etwas von diesem Blut und Boden ist schon immer noch dabei — die Heimatfront. Es gibt eben nicht die ‚Zuhause-Front‘. Im Deutschen haben wir die wunderbare Möglichkeit beides zu trennen und dadurch ist Zuhause, wie du sagst, etwas, das man gestaltet, das mehr Spielraum bietet — allerdings auch Spielraum zur ironischen Brechung. Vor einigen Jahren bin ich mit der U‑Bahn durch Berlin gefahren. Damals ist Universal Music gerade von Hamburg nach Berlin gezogen, was sehr umstritten war, da viele der Mitarbeiter nicht nach Berlin wollten. Die Firma bezog einen riesigen, repräsentativ umgebauten Speicher an der Warschauer Brücke. An das Gebäude wurde ein großes Banner gehängt: „Zuhause”. Das ist eigentlich infam bei einem globalen Konzern, der seine Mitarbeiter entwurzelt, die ohnehin kaum zu Hause sind, weil sie so viel arbeiten müssen. Das heißt, das Wort ‚Zuhause‘ hat diese verschiedenen Brechungen. Auf dieselbe Art und Weise mit dem Begriff Heimat zu spielen, bietet sich nicht so an.
SCHAU INS BLAU: Und wie verändern die neuen Medien, die elektronische Kommunikation die Wahrnehmung von Heimat, Zuhause und letztlich auch von menschlichen Beziehungen? Spielt das eine Rolle in Deinen Büchern?
KRISTOF MAGNUSSON: Diese Überlegung habe ich auch schon gehabt, von wegen: Ich bin zu Hause, wo mein Handy ist. Das ist ein lustiger Gedanke, aber ich denke das ist Quatsch. Ich bin derzeit jeden Tag fünf oder sechs Stunden in der Bahn und würde trotzdem nicht behaupten, dass dort mein Zuhause ist. Wahrscheinlich sind das die beiden Dinge, aus denen wir versuchen, ein Zuhause zu basteln: aus menschlichen Kontakten und einem Ort, einer Wohnung zum Beispiel. Wenn es nur der Ort wäre, dann wäre es als literarisches Thema auch weniger interessant.
SCHAU INS BLAU: Dieses Fremdheitsgefühl ist ein Aspekt der Krisen, in die Deine Romanfiguren geraten. Früher gab es die klassische Midlife Crisis, die männlich konnotiert irgendwo in den Fünfzigern des Lebens angesiedelt wurde. Erfolgstypen, erfolgreiche Familienväter fragen sich nach dem Sinn ihres Lebens. Inzwischen gibt es angeblich die Quarterlife Crisis — zumindest als Begriff. Könnte man sagen, Larus und Meike stecken in solch einer Krise oder doch zumindest in einer persönlichen Umbruchphase?
KRISTOF MAGNUSSON: Die stecken in Krisen, ganz eindeutig! Die sind in einer Sackgasse und haben auf das falsche Pferd gesetzt. Aber das mit einem Begriff wie ‚Quarterlife Crisis‘ zu assoziieren oder zu einem Generationenproblem zu machen, das ist eine Sache, gegen die ich mich immer gewehrt habe. Deswegen habe ich schließlich im neuen Roman drei Personen gewählt, von denen die dritte sechzig Jahre alt ist. Mir kommt es gerade darauf an, dass sich heutzutage — mit dem Aufweichen traditioneller Biographien — solche Krisen und Sackgassengefühle immer wieder und unabhängig vom Alter einstellen können. Der Begriff ‚Midlife Crisis‘ hat vielleicht noch für die Babyboomer-Generation Sinn ergeben. Danach folgte schon sehr viel nebulöser die Generation X. Seitdem erscheint dieses andauernde Generationengewerkel und ‑gesuche nur noch als eine mühsame Form der Etikettierung, die letztendlich eine Art Abladestelle für Selbstmitleid ist, nach dem Motto: Ich muss nichts an meinen Problemen machen, weil das sind nun mal die Probleme meiner Generation. Deswegen gehen mir diese Generationenbegriffe auf die Nerven. Ich bin schon ein Fan von Versuchen, durch Reduktion von Komplexität zu einfachen Aussagen zu gelangen, aber das sind nicht die richtigen einfachen Aussagen. Generationenzyklen sind inzwischen so kurz geworden, dass man von Generationszuschreibungen einfach absehen sollte.
SCHAU INS BLAU: Das bedeutet aber auch, dass es nicht Sarkasmus ist, aus dem heraus Du Deine Figuren in solche Sackgassen und Krisen hineinrennen lässt.
KRISTOF MAGNUSSON: Nein, das ist kein Sarkasmus. Das ist einfach das, was ich aus persönlichem Erleben kenne und womit ich mich sehr viel beschäftigt habe. Was mich umtreibt, ist die Frage: Wie soll man leben?
SCHAU INS BLAU: Ich habe den Eindruck, dass diese Generationenetikettierungen ohnehin ein Feuilletonphänomen sind. Es entwickelt sich irgendwas, man weiß nicht genau was und sucht nach irgendeinem Begriff, um es benennen zu können, letztlich um etwas Handfestes zu haben.
KRISTOF MAGNUSSON: Ja natürlich, man erfindet Labels. Wie gesagt, generell habe ich auch gar nichts dagegen einzuwenden, in diesem Fall sind es nur einfach die falschen. Krisen gibt es immer, grundlegende menschliche Probleme, die immer wiederkehren. Das hat aber mit Generationen nichts zu tun. Sehr entlarvend empfinde ich das bei der Generation Praktikum. Da wird in die Verlage geguckt, zu den Medien, zu den hippen Architekturbüros, wo Leute für 300 Euro ein Praktikum machen. Das stimmt natürlich, aber das sind alles Leute, die ihren Traumjob verfolgen und die sich auf dem Weg dahin von ihren Eltern finanzieren lassen, um herauszufinden, ob er für sie erreichbar ist. Das ist ein Luxusproblem und kein Problem des sozialen Verfalls, denn Akademiker haben größtenteils keine Schwierigkeiten einen Job zu bekommen. In diesem Punkt wird es zynisch, weil es von unserem eigentlichen Problem, nämlich dem der Geringqualifizierten, ablenkt. Man könnte stattdessen auch sagen, dass es großartig ist, dass Leute solche Praktika machen können, dass viele von uns Eltern haben, die sagen können: Du willst bei Daniel Liebeskind arbeiten? Ich geb’ dir etwas dazu, mach’ dein Ding, verfolge deinen Traum.
SCHAU INS BLAU: Vielen Dank für das Gespräch.

Kristof Magnusson wurde 1976 in Hamburg geboren und studierte nach seiner Ausbildung zum Kirchenmusiker am Deutschen Literaturinstitut Leipzig und der Universität Reykjavík. Er war nicht nur Stadtschreiber des Goethe-Instituts in Pune (Indien), sondern auch Writer in Residence an der University of Iowa. Für seine Dramen und Romane erhielt Kristof Magnusson etliche Auszeichnungen (u. a. Arbeitsstipendien vom Deutschen Literaturfonds und Deutschen Übersetzerfonds; Literaturförderpreis der Freien und Hansestadt Hamburg sowie den Rauriser Literaturpreis für die beste Prosa-Erstveröffentlichung). Darüber hinaus ist Kristof Magnusson durch Übersetzungen isländischer Literatur bekannt (Prosa von Einar Kárason, Hallgrímur Helgason, Thórbergur Thórðarson; Gedichte von Sigurbjörg Thrastardóttir und Hannes Sigfússon; Theaterstücke von Thorvaldur Thorsteinsson).