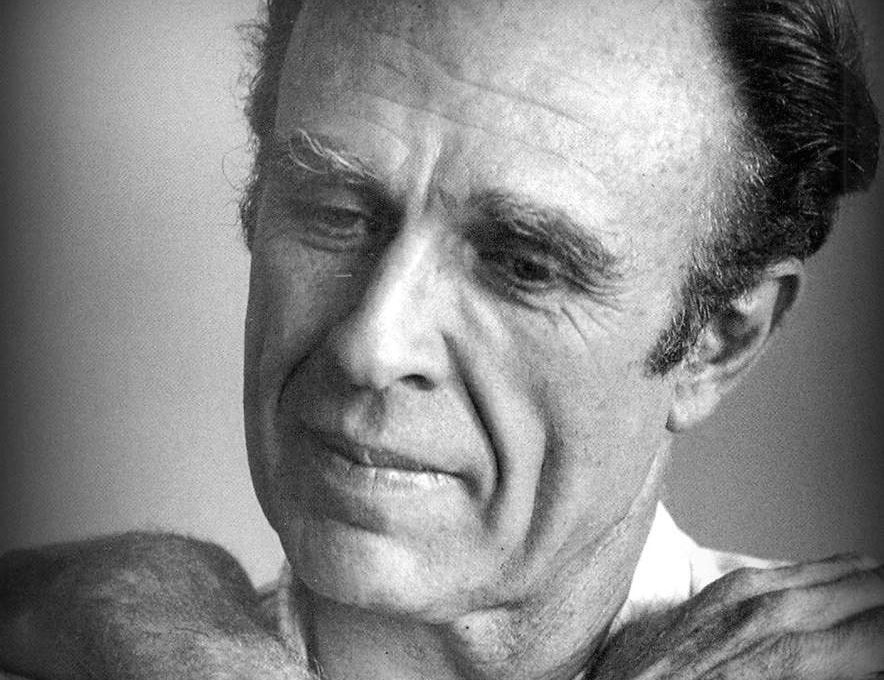von Julian Werlitz
Gelegentlich wird ja nach diesem einen Buch gefragt, das man auf eine einsame Insel mitnehmen würde. Die Antworten tingeln meist zwischen Klassikernennungen, der Beteuerung, man lese ja viel zu viel, um sich auf eines beschränken zu können, und genervter Ironie (Umberto Eco: Telefonbuch). Ungefragt, aber ganz ernsthaft, könnte ich die Sache immerhin mit einer Warnung eingrenzen: Auf gar keinen Fall sollte man Adolfo Bioy Casares‘ „Morels Erfindung“ (1940) einpacken. Denn der Roman erzählt, in Form eines Tagebuchs, von genau dieser Versuchsanordnung:
Ein Verfolgter flüchtet sich auf eine abgeschiedene Pazifikinsel. Wovor er geflüchtet ist, bleibt kafkaesk unklar. Er deutet an, Opfer eines irreparablen Justizirrtums zu sein. Überbevölkerung, Umweltschäden und eine Welt, die sich mit „Polizeidiensten, Ausweispapieren, Funktechnik und Zollsystemen“ zu einer Hölle perfektioniert habe, sind Gegenstand seiner paranoiden Gedankenschleifen. Dabei scheint die kleine Insel der ideale Zufluchtsort: sie ist schwer zu erreichen, das Betreten wegen einer rätselhaften Krankheit außerdem verboten. Sogar ein irgendwie unpassendes Ensemble von Gebäuden gibt es: ein Museum, ein Schwimmbecken und eine Kapelle. Dort führt er das Leben eines „überforderten Einsiedlers“, kämpft mit der Nahrungsbeschaffung und seinem Selbstbild. Er hält alles im Tagebuch fest. Auch das ist aber Quälerei, drückt er sich damit doch nur vor der nötigen Schreibarbeit, einer Schrift – „Verteidigung angesichts Überlebender“, die alles erklären, ja seine Existenz überhaupt rechtfertigen müsste.
Bioy Casares‘ Roman erzählt von Einsamkeit. Er tut das aber nicht aus einem psychoanalytischen Zauberkasten heraus oder mithilfe ausgeleierter Metaphern, sondern unmittelbar. Er lässt uns mitverfolgen, was hier einer nur an sich selbst gerichtet schreibt, der jedoch sein „ICH in Klammern setzt“. So gelingt ein Ton, der zugleich düster und humorvoll, entlarvend und verständnisvoll, analytisch und romantisch die Abgründe der Isolation zeigt. Zur menschlichen Grunderfahrung wird diese Isolation gerade im Versuch, sie zu überwinden, eine Verbindung herzustellen zum Anderen.
Und so beginnt der wahre Horror erst, als die Insel plötzlich, wie aus dem Nichts, von einer fröhlichen Gruppe von Freunden bevölkert scheint. Am Ende ist es eine Liebesgeschichte unter Social Distancing-Bedingungen, die hier eine ewig aktuelle Frage der Kunst aufwirft: Ist dieses Ich denn wirklicher als die Bilder, die es sich, durch Technik oder Vorstellung, von anderen erschafft? (Oder auch: rote oder blaue Pille?) „Morels Erfindung“ gibt darauf die traurigste, aber auch die schönste Antwort, die ich kenne.