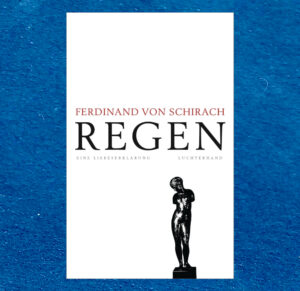Senthuran Varatharajah über seinen Debütroman, Social Media und Sprache
von Anna-Lena Eick
schauinsblau: Seit der Publikation deines Debütromans Vor der Zunahme der Zeichen warst Du eigentlich permanent „unterwegs“, – auf insgesamt 82 Lesungen. Wohin musst du zurückkehren, um sagen zu können: „Ich bin daheim“?
Senthuran Varatharajah: Nach Berlin, Tokyo, Chicago oder Toronto.
Ist denn „daheim“ für dich dasselbe wie Heimat?
„Daheim“ ist, als Begriff, unbelasteter, und auch unverbindlicher als „Heimat“. „Daheim“ besitzt eine Gegenwart, die nicht identisch ist mit unserer Vergangenheit. Ich spreche von „daheim“, wenn ich von Berlin, Tokyo, Chicago oder Toronto spreche. Das Wort „Heimat“ gehört nicht zu meinem aktiven Wortschatz.
SCHAU INS BLAU: Wie ist es für dich gewesen, so plötzlich ein gefeierter Jung-Autor zu sein? Was bedeutete das für dein alltägliches Leben? Wie hat dich das persönlich verändert?
Das kann ich noch nicht sagen. Ich weiß es noch nicht.
Dein Werk Vor der Zunahme der Zeichen konfrontiert den Leser unvermittelt mit einem Erfahrungs- und Gedankenaustausch zweier junger Erwachsener, welche beide auf ihrem bisherigen Lebensweg mit Flucht, Entwurzelung und dem Sein zwischen zwei Kulturen und zwei Sprachen in Berührung kamen. Kennt man deine Biographie, liegt eine autobiographische Lesart und eine potenzielle Identifikation des Autors mit dem Protagonisten nicht fern. Wie stehst du dazu?
Es liegt auf der Hand. Aber dieser Aspekt, der Roman als autobiographische Erkundung und Auskunft, ist unwesentlich, zumindest für mich. Ich identifiziere mich nicht mit mir selbst.
Vor der Zunahme der Zeichen wird oft als modernes Pendant zum klassischen Briefroman bezeichnet. Wie stehst Du selbst zum Briefe-Schreiben? Was verbindest du damit?
Ich schreibe keine Briefe. Das hat einen praktischen, keinen ideologischen Grund: meine Handschrift ist nicht leserlich. Man könnte Vor der Zunahme der Zeichen als einen modernen Briefroman bezeichnen, ja; es wäre nicht falsch. Meine Familie hat früher immer auf Briefe gewartet. Und wenn ein Brief aus Sri Lanka ankam – es war nicht sicher –, erhielten wir ihn mit einer zeitlichen Verzögerung von mindestens zwei Wochen. Wir wussten, dass das, was geschrieben wurde, nicht mehr aktuell war; ob die Person, die diesen Brief geschrieben hatte, noch am Leben war, das wussten wir nicht. Ich glaube, diese Unsicherheit und dieses Warten, diese Form des Zitterns ist auch in den Nachrichten, die sich Valmira und Senthil schreiben, präsent: als eine andere Ungewissheit – als die Ungewissheit eines anderen Ankommens, einer anderen Ankunft.
In einigen Rezensionen wird dann – ganz im Duktus der sozialen Medien — von einem „Chat“ gesprochen. Ich weiß, dass du dich persönlich dagegen vehement zur Wehr setzt. Was genau macht den Unterschied von Dialog bzw. Gespräch und Chat für dich aus?
Der Roman besteht weder aus einem Chat noch aus einem Gespräch. Das ist eine seiner Paradoxien. „Chat“ bezeichnet nicht nur ein bestimmtes Kommunikationsformat, wie z.B den Facebook-Messenger, sondern auch eine bestimmte Kommunikationsform – eine Art zu Schreiben, eine bestimmte Diktion. Einen „Chat“ charakterisiert z.B. die Missachtung von Orthographie, Interpunktion und Syntax, die Verwendung von Akronymen, Emojis, Gifs, etc. Es ist, dem Wortsinn nach, ein Plaudern, eine Unterhaltung. Der Roman besteht nicht daraus. Er besteht aber auch nicht aus einem Gespräch. Das, was Valmira und Senthil sagen, kann in einem Gespräch, in dieser konventionellen Form der Rede und Gegenrede, des Sprechens und Zuhörens, des Fragens und Antwortens nicht zur Sprache gebracht werden. Ich musste also die Kriterien, die ein Gespräch definieren, die ein Gespräch bestimmen – und im bestimmen liegt eine Stimme – außer Kraft setzen: diese Stimme brechen, um Valmira und Senthil sprechen lassen zu können. Ich wollte die Form des Ansprechens und Angesprochenseins aus dem Gebet säkularisieren. Vielleicht könnte man sagen, dass der Roman nicht aus der Realität eines Gesprächs, sondern aus der Idee eines Gesprächs, aus dem Traum eines Gesprächs besteht.
Ist der von dir geschaffene Dialog an das Medium (Facebook) gebunden? Ist das Medium also Bedingung oder gar Voraussetzung für diese Unterhaltung? Schafft die digitale Distanz des Mediums Facebook die notwendige Offenheit, solche Themen ansprechen zu können?
Der Facebook-Messenger vollzieht im Roman auf formaler Ebene das nach, worüber Valmira und Senthil sprechen, d.h. diese Variationen der Einsamkeit, auch der Einsamkeit der Sprache. Das ist seine poetische Funktion. Valmira und Senthil teilen keinen gemeinsamen Raum – sie studiert in Marburg, er promoviert in Berlin –, und der Raum, in dem gesprochen wird, ist kein Raum im physischen Sinn; es ist ein Nicht-Raum, ein Raum der Schrift; sie kennen den Körper und die Stimme des anderen nicht. Und obwohl sie keinen physischen Raum teilen, teilen sie – manchmal – eine gemeinsame Zeit: wenn sie gleichzeitig online sind. Nur in dieser Ferne kann es ihre Nähe geben. Von dieser Ferne des Sprechens, von diesem entfernten Sprechen geht die Intimität des Romans aus.
Also wäre ein solches Gespräch zwischen zwei zunächst Fremden auch von Angesicht zu Angesicht gar nicht denkbar?
Ja. So ist es.
Ein weiteres zentrales Element deines Werkes ist die Sprache und ihre Funktionsweise innerhalb der zwischenmenschlichen und interkulturellen Kommunikation. Ich hatte beim ersten Lesen des Romans sogar beinahe das Gefühl, die Sprache wäre eine eigenständige Protagonistin, welche zusätzlich zu den beiden Charakteren Senthil Vasuthevan und Valmira Surroi agiert und reflektiert.
Sprache ist immer eine eigenständige Protagonistin.
In einem anderen Interview hast Du einmal gesagt: „Oft denke ich, dass die Sprachlosigkeit meine Muttersprache ist.“ – kannst du das erklären? Wenn wir dein Buch lesen, haben wir das Gefühl eine sehr reflektierte Sprache vor uns zu haben. Ist vielleicht hierfür die Voraussetzung das Gefühl der Sprachlosigkeit zu kennen?
Sprachlosigkeit hat im Deutschen zwei Bedeutungen: das Fehlen eines augenblicklichen Zugriffs auf Sprache angesichts eines Ereignisses, das uns die Sprache nimmt: uns die Sprache verschlägt; wir sagen: ich bin sprachlos; oder: es fehlen mir die Worte; und die Permanenz eines fehlenden Zugriffs: die andauernde Abwesenheit von Sprache. Ich meine eine Abwesenheit, ohne diese Abwesenheit zu meinen. Ich meine zwei Formen eines Fehlens: das Fehlen einer Selbstverständlichkeit und das Fehlen eines Bekenntnisses. Sprache ist, für mich, das Unselbstverständlichste. Das betrifft alles, was mit ihr zusammenhängt: sprechen, hören, lesen, schreiben. Ich stehe in gleicher Entfernung zu jeder Sprache, die ich spreche, die mich beherrscht. Das ist keine Frage der Kompetenz, auch nicht der Kenntnis, sondern des Bekenntnisses: ich kann mich zu keiner Sprache bekennen. Das Fehlen dieser Selbstverständlichkeit und das Fehlen eines Bekenntnisses – das ist die Sprachlosigkeit, die ich meine. Es fehlen mir immer Worte. Und aus diesem Fehlen heraus spreche ich.
Reicht die Sprache den Protagonisten denn aus, um sich das mitzuteilen, was sie erzählen möchten? Gelingt der Sprache der Balance-Akt, die teilweise schmerzhaften Erinnerungen zu bewahren oder gar zu bewältigen und gleichzeitig ihre Kommunikationsfunktion im Hier und Jetzt zu erfüllen?
Sprache reicht nie aus.
Das führt ja wiederum zu der Frage, wo die Grenzen von Sprache und Sprachlichkeit verlaufen. Soll der Text gegen die Grenzen der Sprache anrennen?
Der Text wird von zwei Grenzen organisiert: einer grammatikalischen und einer geographischen. Das, was Valmira und Senthil erzählen, gehört nicht zum Bewusstsein der deutschen Sprache; es sind keine kanonisierten Erfahrungen, keine, für die es etablierte Modi des Erzählens gibt, auf die sie sich im Sprechen verlassen könnten – soweit man sich auf eine institutionalisierte Sprache verlassen kann. Sie müssen also mit der Sprache anders verfahren: sie biegen, brechen, um das, was sie sagen möchten, sagen zu können. Das ist der Augenblick der Lyrik – und Lyrik ist das Brechen der Sprache, die Unterbrechung der Linie, wie Blanchot sagt –, vor allem in Senthils Sprache, der, anders als Valmira, nicht nur eine transkontinentale Flucht erlebt hatte, sondern, angesichts seiner dunklen Haut, auch anders zu dieser Sprache und zu diesem Land steht, weil er anders in dieser Sprache und in diesem Land gesehen wird. Auf der anderen Seite sprechen beide immer auch von einer geographischen Grenze, von diesen Rändern aus: von den Stadträndern, wo die Asylbewerberheime, in denen sie aufgewachsen sind, standen.
Kann Sprache auch Heimat sein beziehungsweise zur Heimat werden?
Nein.
Franco Biondi – ein interkultureller Autor aus Italien – sagte in einem Interview, dass seine Wortschöpfungen, die sprachlichen Neukreationen in seinem literarischen Werk, unter anderem dazu dienen, selbst in einer Sprache vorzukommen, die einem nicht natürlicherweise angehört. Was hier anklingt ist eine Art „Einschreiben“ in eine neue Sprache, in der man nicht selbstverständlich zu Hause ist. Erfüllt dein poetischer und spielerischer Umgang mit der deutschen Sprache eine ähnliche Funktion? Eine Funktion des Selbst-Einschreibens in eine Sprache?
Sprache gehört niemandem, niemandem natürlicherweise. Wir sind in keiner Sprache selbstverständlich zu Hause. Und wir werden auch nie in ihr vorkommen.
Sprache hängt natürlich in gewisser Weise auch mit Institutionen, Politik und vielleicht der Idee von Nationalität zusammen. In deinem Roman thematisierst du verschiedene Versuche von institutioneller Auslöschung einer Sprache. So beispielsweise das Verbot der Tamilischen Sprache durch den Sinhala Only Act, die Ersetzung des Albanischen in Universitäten und Schulen durch das Serbische sowie das Einführen der lateinischen Schrift durch das Atatürk-Regime und das damit einhergehende Verbot der Buchstaben Q, X und W zur Sanktionierung des Kurdischen. Diese Parallelführungen der verschiedenen Machtmechanismen innerhalb deines Romans zeigen die existenzielle Bedeutsamkeit der Sprache auch als Merkmal kultureller, ethnischer und nationaler Zugehörigkeit auf. Kann man das Sprechen und Denken eines Individuums institutionell überhaupt bestimmen?
Sprache selbst ist eine Institution: in ihr, in der Grammatik, in den Wörtern und in den Redewendungen, die wir verwenden, wenn wir sprechen, ist ein Wissen institutionalisiert, eine bestimmte Ordnung der Dinge sedimentiert, die reproduziert wird, mit jedem Satz, jedes Mal wieder. Max Frisch hat diesen Zusammenhang sehr genau in einer Poetikvorlesung, die er 1981 am City College in New York gehalten hat, beschrieben: Jedes gesellschaftliche System entwickelt eine Sprache, die das System bis in die Nebensachen hinein affirmiert. Eine Herrschaftssprache, die nicht nur von der herrschenden Schicht gesprochen, als Alltagssprache, die wir lernen als Kind und lebenslänglich gebrauchen, ohne zu wissen, dass sie uns mit Vorurteilen füllt. Mit Redensarten: ein armer, aber ehrlicher Mann. Vielleicht ist der Mann in dieser Gesellschaft darum arm, weil er ehrlich ist. Warum sagen wir also nicht: ein reicher, aber ehrlicher Mann? Das sagt man nicht. Diese Sprache, die aus einer Summe von Redensarten besteht und Klischees, geprägt von den Interessen der herrschenden Schicht, diese Sprache, die wir in der Schule lernen als die einzig richtige Sprache, ist aber nicht unbedingt die Sprache unserer Erfahrung. Sie entfremdet uns also von unseren Erfahrungen. Viele erleben nicht so, wie diese Sprache es behauptet. Wie man es sagt. Da viele aber nicht sagen können, wie sie erleben, fühlen sie sich verpflichtet, so zu erleben, wie diese Herrschaftssprache es vorschreibt. Wie man erlebt.
Die selbe Sprache zu sprechen, bedeutet ja nicht nur sich verständigen zu können, sondern normalerweise auch: verstanden zu werden. Stellen damit einerseits die Bereitschaft zu verstehen und andererseits die Erwartungshaltung, verstanden zu werden die Grundpfeiler eines Gesprächs bzw. eines Dialoges dar?
Verstehen ist nicht an Sprache gebunden, auch nicht an diese eine, die selbe, die es nicht gibt. Es ist eine Frage der Anerkennung: des Anerkennens. Der Bereitschaft, die Differenz, die die Person, die zu uns spricht und die wir ansprechen, immer ist, anzunehmen; annehmen zu können. Das betrifft nicht nur das, was sie sagt, sondern auch die Zeit ihres Sprechens, des Erzählens. Das ist der Grund, warum Valmira und Senthil kaum Fragen stellen. Sie wissen: wenn es gesagt werden soll, wird es gesagt werden – alles zu seiner Zeit. Verstehen ist eine Frage der Haltung, man könnte sagen: des Vertrauens; auch das.
Bei genauerer Betrachtung der Textstruktur wird dessen Konstruktionsprinzip als mögliche Variation einer assoziativen Verkettung oder Reihung sichtbar. Erinnerung wird an Erinnerung geknüpft, ohne dass eine moderierende Instanz (z.B. eine Erzählerfigur) ordnend eingreift oder den Erinnerungsvorgang per se sowie die anschließenden Erinnerungsepisoden der beiden Dialogpartner kommentiert. Soll die Abwesenheit eines Moderators bzw. Erzählers den Rezipienten dazu bewegen, diese Brüche und Lücken zunächst einmal „auszuhalten“?
Ab einem gewissen Punkt – und dieser Punkt musste von Valmira und Senthil erst erreicht werden – organisiert die Assoziation das Sprechen. Sie erlaubt es, Dinge zu verbinden, die gewöhnlicherweise nicht in Verbindung gebracht werden. Dieses Verfahren, das ich der Psychoanalyse entlehnt habe, führt zum stream of unconsiousness, zum somnambulen Ton, die den Text von da an, als Valmira und Senthil verstehen, wohin dieses Sprechen führen könnte, wohin diese Schrift führt, bestimmen. Sie setzt das Erinnern in Gang, bewegt das, was verdrängt, verschwiegen, vergessen und verleugnet wurde, nach und nach. Valmira und Senthil schreiben vor allem nachts, in der Antwortlosigkeit der Nacht, in der die Grenzen zwischen Bewusstsein und dem Unbewussten brüchiger werden können. Es gab nie die Idee einer moderierenden Instanz. Eine moderierende Instanz wäre ein Zeichen dafür, dass ich dem, was die Assoziation zur Sprache bringen kann, dass ich dem Assoziieren als Verfahren sowie Valmiras und Senthils Logik der Erinnerung nicht vertraut hätte. Ich musste mich darauf einlassen. Es gab keinen anderen Weg.
An verschiedenen Stellen deines Romans wird der Leser mit einer latenten Form von Alltagsrassismus konfrontiert (Hautfarbe, Katzensprache, weißes Gesicht, Angst vorm schwarzen Mann etc.). Dies bleibt jedoch meistens unkommentiert im Dialog stehen. Gerade in den Passagen von Senthil ist das (Selbst-)Reflexionsniveau sonst sehr hoch. Wieso bleiben gerade diese Passagen „unkommentiert“ oder „unreflektiert“?
Das ist die Brutalität und Banalität von Rassismus. Wenn Senthil diese Passagen nicht kommentiert, ist das reflektiert. Es muss nicht mehr dazu gesagt werden.
Auch das Konzept eines Dazwischen spielt in deinem Roman eine wichtige Rolle. Bei der Lektüre des Romans hat man das Gefühl, die Protagonisten hielten sich in einer Art „Zwischenraum“ – einem Dazwischen (zwischen den Kulturen, den Sprachen, den Generationen) auf. Trotzdem sind diese Grenzen – im Roman – nicht als unüberwindbare Mauern, sondern eher als etwas Fließendes angelegt. Die Redensart: „Zwischen den Stühlen“ lässt sich demnach nicht gut darauf anwenden. Was wäre dein Bild für dieses „Dazwischen“?
Das Bild des „Dazwischens“ verfehlt das, was es ausdrücken will. Es suggeriert einen Abstand, der zwischen zwei Dingen liegt; diesen Abstand gibt es nicht. Er suggeriert, dass Kulturen, Sprache, etc. abgeschlossene Einheiten sind; das ist nicht der Fall. Als gäbe es keine Überschneidungen, Vermengungen. Und auch davon, von diesen Vermischungen von Sprache etwa erzählt der Roman, vor allem Senthil, wenn er über das Übersetzen spricht, im Studium, und wie er nicht mehr sagen konnte, nach welcher Bibelübersetzung er zitierte, weil sich Übersetzung über Übersetzung über Übersetzung gelegt hatten. Ich weiß nicht, welches Bild oder welche Rede richtig ist, um die Situation im Roman zu beschreiben. Vielleicht könnte man von „Nicht-Raum“ statt „Zwischenraum“ sprechen. Es wäre richtiger.

Senthuran Varatharajah, geboren 1984, studierte Philosophie, evangelische Theologie und Kulturwissenschaft in Marburg, Berlin und London. Im Frühjahr 2016 erschien sein vielbeachteter und mehrfach ausgezeichneter Debütroman Vor der Zunahme der Zeichen. Senthuran Varatharajah lebt in Berlin.