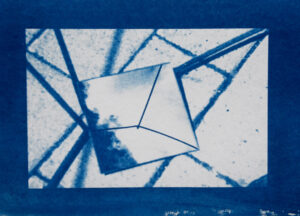Ein Interview mit dem Dramatiker, Regisseur und Intendant des Sensemble Theater Augsburg Sebastian Seidel
von Eva Pörnbacher
Allerorts verschwimmen Grenzen zwischen Kulturen, lösen sich auf, verbinden sich zu etwas Neuem. Zu Mittag gibt es Nasi Goreng, im Radio läuft bayerischer Hip-Hop und neben dem Gartenzwerg steht plötzlich ein Buddha. Nur eine Grenze scheint all diesen Entwicklungen zu trotzen: die Sprache. Nach wie vor stellt sie in vielen Fällen ein schier unüberwindbares Hindernis dar. In einer zunehmend transkulturellen Welt sieht sich daher insbesondere die Literatur mit neuen Herausforderungen konfrontiert. Schau ins Blau wollte von dem Dramatiker Sebastian Seidel wissen, warum transkulturelle Themen dennoch auch im Theater bearbeitet werden wollen, wie Übersetzter Autoren dazu verdammen sich Gedanken über die eigene sprachliche Herkunft zu machen und weshalb neuerdings intensiv an einem Brückenbauprojekt zwischen Jinan (China) und Augsburg gearbeitet wird.
SCHAU INS BLAU: Herr Seidel, Sie sind Dramatiker, Sie führen Regie und leiten das Sensemble-Theater in Augsburg, das Sie 1996 ins Leben gerufen haben. Auf Ihrer Bühne wird hauptsächlich Gegenwartsdramatik gespielt. Zum Teil Stücke, die Sie selbst geschrieben haben, zum Teil auch Stücke von anderen zeitgenössischen Autoren. Gleichzeitig spricht aus Ihrem Spielplan ein starkes Interesse an transkulturellen Themen. Stücke wie „Isola Di Lampedusa“, „Schwarze Liste. Exilhaus“ und „Heimat? Da war ich noch nie!“ finden sich im aktuellen Programm. Woher rührt Ihre Motivation, Themen wie Migration, Flucht und Exil zu bearbeiten?
SEBASTIAN SEIDEL: Ich bin in einer Familie aufgewachsen, die einen jüdischen Hintergrund hat, die emigrieren musste im Dritten Reich. Daher habe ich sehr viele Verwandte in verschiedenen Ländern, vor allem in Amerika und England. Einige sind dort wieder Germanistikprofessoren geworden und haben die deutsche Sprache in einem amerikanischen Umfeld hochgehalten. So kam es gewissermaßen zu einer Überlagerung der Kulturen und einem globalen Denken, das sich durch die Generationen meiner Familie zieht. Vor diesem Hintergrund habe ich bald erkannt, dass die großen Themen des Theaters, die Urkonflikte und die Tragik des Menschen, dass diese Themen transkulturell sind. Da ist es völlig egal, ob man in Kalifornien oder North Carolina, in Augsburg oder Berlin lebt. Die Form von Theater, die ich gut finde, muss diese übernationalen Zusammenhänge aufgreifen. Auch wenn die Stücke bei mir in der deutschen Sprache verfasst sind, so weisen die Probleme und Konflikte, die darin vorkommen, doch weit über Deutschland hinaus. Im Grunde war Theater schon immer transkulturell. Deswegen funktionieren antike Dramen ja immer noch, weil da Urthemen beschrieben wurden, die natürlich heute in anderen Kontexten erscheinen, aber von der Grundthematik immer gleich bleiben, weil sie das menschliche Wesen, seine Tragik, treffen. Ich glaube, wenn ein Stück gut geschrieben ist, funktioniert es weltweit. Vielleicht werden verschiedene Menschen unterschiedlich berührt davon oder sehen andere Aspekte, aber das wäre ja gerade auch das Spannende. Das ist doch gewissermaßen der Sinn von Transkulturalität, dass ich dadurch etwas entdecke, an meinem Werk oder meiner eigenen Sichtweise, was ich sonst nicht gesehen hätte.
Hinzu kommt, dass in meinen Augen Theater immer auch den Blick auf die richten muss, die zu kurz gekommen sind. Das geht natürlich auch außerhalb des Theaters – meine Großmutter zum Beispiel, die im KZ war, hat sich nach der Befreiung ihr Leben lang um Asylbewerber gekümmert. Das hat mich natürlich beeindruckt und geprägt und so versuchen wir das im Theater auf unsere Art und Weise. Ich kann solche Dinge ohnehin nicht außerhalb der Kunst denken. Während des Brecht Festivals gab es im Rahmen eines Kunstprojekts eine Zusammenarbeit mit Flüchtlingen. Wir gaben ihnen die Möglichkeit, sich einzubringen und ihre Erfahrungen mitzuteilen. Das war ein wunderbarer Prozess, in dem viele neue und unerwartete Dinge entstanden sind. Aber man braucht auch Mut zum Experiment, denn man weiß im Vorhinein nie, ob solche Ideen und Konzepte wirklich funktionieren und aufgehen und was sich dabei ergibt.
SCHAU INS BLAU: Aber birgt ein solches Konzept nicht auch eine Gefahr? Transkulturelle Entwicklungen werden immer begleitet von bestimmten Machtverhältnissen. Ein Flüchtling ist in den meisten Kontexten der Schwächere. Von einer Zusammenarbeit auf Augenhöhe kann kaum gesprochen werden.
SEBASTIAN SEIDEL: Ja, das ist natürlich richtig, aber in einem Kunstprojekt kann man auch genau dieses Machtverhältnis aufgreifen und bearbeiten. In unserem Fall haben wir das versucht, indem die Flüchtlinge nicht die Rolle der Flüchtlinge übernommen haben, sondern die Rolle der Machthaber, also der Wachmänner und Aufseher in Flüchtlingslagern. So konnten sie ihre ganze Erfahrung einbringen, die sie als Flüchtling in Deutschland gemacht haben. Das Publikum wiederum wurde zum Bittsteller und musste um eine Arbeitserlaubnis kämpfen. Es konnten willkürlich Leute verhaftet werden, die dann erst einmal in die Amtsstube gebracht wurden und dort einen Asylantrag ausfüllen mussten, der auf Arabisch geschrieben war. So wurden die ‚Zuschauer‘ für einen Augenblick in die Situation gebracht, in der Asylbewerber sich täglich befinden. Viele fanden es fantastisch, aber es gab auch welche, die richtig vor den Kopf gestoßen waren und meinten: “Das kann man doch nicht machen, ich lass mich hier doch nicht ausländisch anreden!” Wir haben versucht, den Flüchtlingen die Möglichkeit zu geben, ihre Erfahrungen einzubringen und das Machtverhältnis für einen kurzen Moment umzukehren. Das war wichtig und ich glaube deswegen waren auch viele sehr engagiert dabei. Letztendlich ist natürlich klar, dass wir uns das Projekt ausgedacht haben und wir es bezahlen. Völlig aufheben kann man die Machtverhältnisse nicht. Aber zumindest auf der Bühne kann man solche Dinge umkehren und beobachten, ob dabei etwas Neues entsteht.
SCHAU INS BLAU: Neben diesen transkulturellen Themen bezieht Ihr Theater auch viele lokale Aspekte mit ein. Es gab beispielsweise das Projekt „Stärken vor Ort“, das Kindern aus der unmittelbaren Umgebung die Welt des Theaters näher brachte. Wie kann ein solches Engagement einhergehen mit dem internationalen Anspruch ihres Theaters? Denkt man an ihr eigenes Stück „Böser Bruder“, tritt dieser Konflikt zwischen dem Lokalen und dem Transkulturellen in Gestalt zweier Brüder zu Tage. Ist Ihr Theater mit den gleichen Widersprüchen konfrontiert?
SEBASTIAN SEIDEL: Ich bin weniger ein regionaler Künstler. Auch wenn ich mich im Stadtteil einsetze, mit “Stärken vor Ort”, dann sind das vor allem Kinder mit Migrationshintergrund, die eher vernachlässigt sind von der Gesellschaft. Es wurde versucht, uns als Theater des Textilviertels zu etablieren, als Stadtteilkultur sozusagen, aber das geht mit mir nicht so gut. Ich kann mir nicht vorstellen, ein Theater zu leiten, das sich tatsächlich nur um einen Ort dreht. Das mag mit meiner Person zu tun haben. Ich kann kein Schwäbisch, obwohl ich in Augsburg wohne, obwohl ich in Ulm aufgewachsen bin. Ich bin wenig regional verwurzelt. Heimat ist für mich dann tatsächlich weniger der Ort an sich, sondern die Leute, die dort sind und mit denen ich mich auseinandersetzen kann über die Sprache, aber auch über die generelle Geisteshaltung. Ich habe in einem Stück über die Fuggergestalt geschrieben, die sehr eng mit Augsburg verbunden ist, aber das, was mich an der Figur interessiert hat, war besonders ihr globales Denken und Handeln. Das ist es, was ich spannend finde. Thematiken, die gänzlich auf einen Ort beschränkt sind, gibt es ohnehin kaum noch.
SCHAU INS BLAU: Man könnte sagen, dass Kunst im Allgemeinen Freiräume schafft, in denen Handlungs- und Sinnentwürfe, also im Grunde Identitäten erprobt und getestet werden können. Inwiefern bewegen Sie sich als Dramatiker in solchen Experimentierräumen des Austestens von Identitäten?
SEBASTIAN SEIDEL: Als Dramatiker kann ich mir natürlich jegliche Identitäten ausdenken, mich in die Figuren hineinversetzen und versuchen, aus den Figuren heraus zu handeln. Wenn die Figurenkonstellation stimmt, dann verselbstständigen sich diese Identitäten im Autor und man muss den Fortgang der Geschichte nur noch begleiten. So war es beispielsweise beim ‚Bösen Bruder‘, ich musste ab einem bestimmten Punkt nur noch verfolgen, wie die beiden Charaktere aufeinanderprallen. So kämpfen plötzlich zwei Identitäten im Autor. Und man selbst ist ja auch noch dabei. Dann sind es drei Identitäten. Das führt dann natürlich zwangsläufig zu der Frage, was eigentlich den innersten Kern des Menschen ausmacht. Ich habe über Robert Musils ‚Mann ohne Eigenschaften‘ promoviert. Dort wird genau dieses Urthema, die Suche nach der eigenen Identität angesprochen. Ich denke eher, dass der Kern gar nicht so groß ist und man je nach Kontext, den Lebensumständen, dem familiären und sozialen Umfeld Identitäten ausbildet, die natürlich immer veränderbar bleiben. Dennoch hat man, wenn man wie ich in einer international vernetzen Familie aufgewachsen ist, ganz andere Voraussetzungen und in Bezug auf Transkulturalität ein ganz anderes Verständnis, als wenn man in einem schwäbischen Dorf groß geworden ist. Da sind die Denkweisen natürlich sehr unterschiedlich. Dennoch besteht grundsätzlich in beiden Fällen die Möglichkeit, sich entweder von etwas Fremdem abzuschotten, oder offen dafür zu sein.
SCHAU INS BLAU: Hat auch das Theater ein Potential, Identitäten ins Wanken zu bringen oder gar Menschen zu verändern?
SEBASTIAN SEIDEL: Auf jeden Fall. Das Theater bietet da Unmengen an Spielmöglichkeiten. Es wäre zu viel, von Erweckungserlebnissen zu sprechen, aber das Theater kann durchaus Welten eröffnen. Es gibt Momente als Zuschauer, da merkt man, dass da etwas stattfindet auf der Bühne — man kennt es vielleicht nicht, aber es fasziniert einen. Wie eine Suche nach dem Anderen oder dem Fremden. Gleiches findet natürlich auf der Bühne und im Schauspiel statt. Gerade in dem Projekt „Stärken vor Ort“ haben wir versucht, Theaterszenen zu entwickeln, die den beteiligten Kindern vertraut sind. In einem zweiten Schritt gingen wir über diese Szene hinaus. Die Jugendlichen haben dann schnell gemerkt, was für eine Kraft im Theater und Schauspiel liegt. Sie konnten ihre eigene Identität von oben betrachten und sie dann auch einmal wechseln, in andere Figuren schlüpfen und dabei Grenzen austesten. Mich hat das Theater auch immer interessiert, weil es kritisch sein kann und keiner Ideologie folgt. Eine Figur stellt Fragen und kommt in Konflikt mit einer Ideologie, einem Herrscher oder bloß einer gesellschaftlichen Norm. Das Streben nach Freiheit ist ein extremer Motor des Theaters.
SCHAU INS BLAU: Ich würde gerne auf eine spezielle Arbeit von Ihnen zu sprechen kommen. 2014 haben sie zusammen mit Andres Nohl die deutsch-chinesische Anthologie „Tales of Two Cities“ herausgegeben. Sie enthält sowohl Texte deutscher als auch chinesischer Autoren und Autorinnen. Gleichzeitig ist die Anthologie in China in chinesischer Sprache veröffentlicht worden. Auch ein Ausschnitt ihres Dramas „Love Movie Theater“ ist darin zu finden. Wie kam es zu diesem einzigartigen Projekt?
SEBASTIAN SEIDEL: Die chinesische Stadt Jinan ist eine Partnerstadt von Augsburg. Es gibt immer wieder eine Delegation von Augsburger Schriftstellern, die nach Jinan fliegt. Im Gegenzug kommen dann Autoren aus Jinan nach Augsburg. Als Andreas Nohl und ich eingeladen wurden, haben wir überlegt, wieso wir eigentlich dorthin fliegen. Einfach um ein bisschen miteinander zu reden? Über die Strukturen in China, den Schriftstellerverband? Im Grunde wissen wir dabei doch gar nicht, was die andere Seite eigentlich schreibt und denkt über ihr Leben, über die Kunst. Gerade als Künstler kann man nicht nur über äußere Dinge sprechen. Was nützt es mir zu wissen, dass mein Gegenüber Romane schreibt und diesen und jenen Preis gewonnen hat. Man will doch dann auch über Inhalte und die kreative Arbeit sprechen. Daher dachte ich mir, dass das Treffen nutzlos ist, wenn nicht ein gemeinsames Projekt daraus hervorgeht. Mit diesem Vorhaben gingen wir schließlich in das Treffen und nach ein, zwei Stunden an Austausch von Höflichkeiten habe ich die Idee dieser Anthologie vorgetragen. Sie waren sofort begeistert, wobei wir zunächst nicht einschätzen konnten, ob diese Begeisterung eine der Höflichkeit oder eine ernst gemeinte ist. Wir jedenfalls haben es ernst genommen, sind nach Augsburg zurück und haben versucht, Geld aufzutreiben bei der Stadt und dem Ministerium. Als das funktionierte, wählten wir Augsburger Schriftsteller aus und dann haben die Chinesen auch schnell begriffen, dass wir wirklich wissen wollen, was sie schreiben. In Augsburg haben wir dann auch einen Chinesen gefunden, der die chinesischen Texte übersetzt hat. So war beim nächsten Besuch die Möglichkeit gegeben, sich wirklich über die Werke zu unterhalten und auch über unterschiedliche Literaturformen. Was ist in China ein Roman? Warum sind Gedichte so wahnsinnig wichtig? Jeder Staatschef schreibt dort Gedichte. Viele Gedichte werden in der Öffentlichkeit kalligraphiert. Besonders in Jinan ist die Lyriktradition sehr ausgeprägt.
SCHAU INS BLAU: Welche Erkenntnisse haben Sie dadurch über die Art des Schreibens in China gewonnen?
SEBASTIAN SEIDEL: Nun, sie denken und schreiben ganz anders als wir, sehr viel traditioneller oder traditionsbewusster, sie beziehen sich immer auf die Vergangenheit. Auf die Großmutter, auf die Urgroßmutter, auf den Krieg. Zumindest die Schriftsteller, die für die Anthologie ausgewählt wurden. Vielleicht findet momentan auch wieder eine Rückkehr zur Tradition statt, nachdem bei der Kulturrevolution alles über Bord geworfen wurde. Viele der Texte beschreiben die Stadt Jinan, die Landschaft, die Natur. Generell ist mein Eindruck, dass sehr viel über die Landschaft ausgedrückt wird. In diesen Landschaftsbildern stecken unglaublich viele intertextuelle Verweise, die wir natürlich gar nicht verstehen können, weil wir die Literatur nicht kennen, auf die sie sich beziehen. Die deutschen Autoren hingegen bewegen sich viel mehr im Heute, im Hier und Jetzt. Die Vergangenheit wird zu Gunsten der Gegenwart zurückgestellt. Aber obwohl die kulturelle Differenz zwischen China und Deutschland natürlich noch viel größer ist als beispielsweise zwischen der USA und Deutschland, ist sie dennoch im Endeffekt nicht so riesig, wie man im ersten Moment annehmen würde. China ist mittlerweile doch sehr westlich und sehr offen. Mit einzelnen Autoren haben sich daher sofort Verbindungslinien ergeben, die man weiterdenken wollte.
SCHAU INS BLAU: Was ich sehr gelungen fand, war, dass in der Anthologie immer abwechselnd ein deutscher und ein chinesischer Text abgedruckt wurde. Häufig stehen die beiden Texte dann auch in einem Bezug zueinander, was den Inhalt oder auch nur einzelne Worte angeht. Beispielweise beginnt das erste Gedicht von Lydia Daher mit dem Satz “Es reicht für den Anfang eine Balkonszene“. Der darauffolgende Kurzgeschichte von Hai Cheng spielt sich dann ausschließlich auf dem Balkon ab und beginnt mit dem Satz: „Für denjenigen, der in einer Stadtwohnung lebt, ist der Balkon der Ort, wo er der Natur am nächsten ist, wo er sich sonnen, frische Luft atmen und Blumen haben kann“. Als Leser beginnt man da sofort Bezüge und Verknüpfungen herzustellen und Szenen zusammenzudenken. Verbindungslinien sind auf jeden Fall vorhanden.
SEBASTIAN SEIDEL: Genau, für uns war auf jeden Fall klar, wir wollen es abwechselnd haben und nicht erst die deutschen Texte und danach die chinesischen. So findet eine bessere Durchdringung statt, durch die doch etwas Neues entstehen kann – und sei es im Kopf des Lesers. Hai Cheng, von dem die Balkon-Szene stammt, war auch der einzige Autor, auf den wir bestanden haben, ansonsten hatten wir keinen Einfluss auf die Auswahl der Autoren und Texte. Aber gerade er schien sich tatsächlich auszukennen, mit europäischer Literatur und wir haben sofort einen Zugang zu ihm gefunden.
SCHAU INS BLAU: Im ersten Moment scheint Text ein denkbar ungeeignetes Medium für eine transkulturelle Kommunikation und Zusammenarbeit zu sein. Sie hatten es ja eingangs schon angedeutet. Selbst wenn man Kulturen nicht mehr als klar voneinander abgegrenzt auffasst, so besteht in der Sprache doch eine große Barriere. In anderen Kunstformen, wie beispielsweise der Musik, scheint ein Zusammenspiel verschiedener Kulturen sehr viel leichter möglich. Wieso machen Sie sich dennoch die Mühe, eine transkulturelle Zusammenarbeit auch im Bereich der Literatur und Dramatik zu verfolgen?
SEBASTIAN SEIDEL: Also zunächst war es ja nicht meine Entscheidung, dass ich insbesondere sprachlich interessiert bin. Vielleicht hängt es doch mit meiner Identität zusammen, dass ich mit Sprache umgehen kann, oder Lust habe, damit zu arbeiten, mir darüber Gedanken zu machen. Ich bin eben kein Maler oder Musiker geworden. Ich habe da schon immer meinen Onkel, Karl Berger, bewundert. Der war Jazz-Musiker, hat überall auf der Welt gespielt und immer sofort Leute gefunden, die mit ihm musiziert haben. Musik ist in gewisser Weise eine international verstehbare Ausdrucksform. Aber bei mir ist es nun mal die Sprache und da ist es natürlich etwas schwieriger. Die Sprache hat aber auch Vorteile oder besser gesagt eine Kraft, die dazu herausfordert, sich über bestimmte Inhalte und Worte noch einmal genau zu vergewissern. Gerade in der Übersetzungsarbeit wird man häufig damit konfrontiert. In der Literatur muss man dann einfach nach dem konkreten Wort suchen. Die Sprache fordert höchste Präzision. Das wirft einen darauf zurück, wo man herkommt und was man kennt, was man gelesen hat und es begrenzt einen natürlich auch auf einen gewissen Sprachraum, oder vielleicht auch Denkraum oder Philosophieraum. Und genau das Entdecken dieser eigenen sprachlichen Herkunftsräume kann manchmal ein sehr guter Ausgangspunkt sein, um mit anderen Denkräumen in Kontakt zu treten. So können verschiedene Sprachräume in Beziehung gesetzt werden und sich beeinflussen. Die Übersetzer können da sehr herausfordernd sein. Sie fragen nach, weil sie wissen müssen, wieso etwas so und so geschrieben wurde. Man muss dann sehr genau erklären, was man mit einem bestimmten Satz, einem bestimmten Wort zum Ausdruck bringen will. In diesem Prozess entsteht dann eine neue Produktivität, in der man merkt, aha, diese Art von Redewendung, diese Art von Denkhaltung gibt es im Chinesischen gar nicht. Dann muss man ein Äquivalent finden, das annähernd passen könnte, dann aber vielleicht doch wieder andere Assoziationen hervorruft. In einer solchen Arbeit lernt man die Sprache der anderen Kultur kennen. Ich mache mir dann rückwirkend auch Gedanken, ob meine Sprache wirklich so gut und sauber formuliert ist, dass sie nur hier funktioniert, möglicherweise nur im süddeutschen Raum. Schon ein paar hundert Kilometer weiter können auch innerhalb der deutschen Sprache Redewendungen eine ganz andere Konnotation haben. Insofern ist die Sprache in einer transkulturellen Zusammenarbeit genau das Medium, das einen immer wieder herausfordert oder dazu verdammt, sich Gedanken zu machen, über sich selbst und darüber, wo man herkommt und wo man hingeht.
SCHAU INS BLAU: Haben Sie keine Angst um Ihre eigenen Texte, wenn sie übersetzt werden? Man kann ja nun kaum überprüfen, was da nun unter eigenem Namen geschrieben steht.
SEBASTIAN SEIDEL: Natürlich kann es da leicht zu Missverständnissen kommen und die Übersetzung kann ich letztendlich überhaupt nicht beurteilen. Die Übersetzerin, die meinen Text übersetzt hat, war einmal ein Jahr in Augsburg. Insofern kann ich nur hoffen, dass sie annähernd weiß, was ich geschrieben habe. Verstehen kann ich natürlich amerikanische Übersetzungen. „Hamlet for you“ zum Beispiel wurde ins Englische übertragen und dann in New York gespielt. Diese Übersetzung schien mir plausibel. Es wurde versucht, die originalen Wortspiele mit eigenen Wortspielen zu übersetzen, die nicht auf der Sprachebene, aber auf der inhaltlichen Ebene ähnlich sind. Dabei achtete man sehr darauf, ob an bestimmten Punkten nun Ironie, Satire, Sarkasmus oder bloße Unterhaltung gefragt ist. Wenn man es liest, erscheint es zwar als etwas völlig anderes, aber der Übersetzer hat versucht, der Funktion des Wortspiels nachzuspüren und dann etwas gesucht, was in eine ähnliche Richtung geht. Es ist wirklich wahnsinnig schwierig, Literatur zu übersetzen. Wir haben einmal ein Stück von einem kroatischen Autor gespielt. Die Übersetzung war höchst umstritten und am Ende haben sich zwei Übersetzer gegenseitig vorgeworfen, dass die Übersetzung des anderen nicht stimmt.
SCHAU INS BLAU: Ich bin froh, dass es dennoch immer wieder versucht wird. So habe ich zum ersten Mal in meinem Leben chinesische Literatur gelesen. Übersetzt lautet der chinesische Titel der Anthologie „Von der einen Seite der Brücke auf die andere gehen“. Wird diese Brücke auch zukünftig weiter benutzt werden?
Wir stehen nach wie vor in Kontakt zueinander. Die Chinesen sind nun die treibende Kraft und wollen unbedingt ein nächstes Buch machen. Der Präsident des chinesischen Schriftstellerverbandes hat eine ungemein rührende Einleitung für die chinesische Ausgabe der Anthologie verfasst, in der er betont, wie schicksalhaft die Begegnung für ihn war und wie sehr er sich verbunden fühlt mit uns. Wir bremsen gerade ein bisschen, weil wir erst einmal dieses Projekt verarbeiten müssen. Aber es wird auf jeden Fall weitergehen. Ziel ist es, aus diesem Dialog, den ich im momentanen Zustand noch als interkulturell bezeichnen würde, eine transkulturelle Zusammenarbeit zu entwickeln. Bislang haben die wenigsten der beteiligten Autoren eine Ahnung von der schriftstellerischen Tradition des jeweils anderen Landes. Aber es stehen Ideen im Raum. Beispielsweise, dass man als nächsten Schritt über die jeweils andere Partnerstadt schreibt. Da könnte etwas entstehen. Oder auch der Gedanke, dass zwei Autoren gemeinsam an einem Werk schreiben oder sich im Entstehungsprozess austauschen.
SCHAU INS BLAU: Ich bin gespannt auf das, was kommen wird! Herr Seidel, ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch und wünsche dem Sensemble-Theater und Ihrer Zusammenarbeit mit China weiterhin viel Erfolg und alles Gute!

Sebastian Seidel, geboren 1971 in Ulm, studierte Germanistik, Geschichte und Philosophie an der Universität Augsburg und an der University at Albany/NY. Nach seinem dem Studium rief er das freie Sensemble-Theater ins Leben, das er bis heute leitet. Im Jahr 2000 promovierte Seidel über Robert Musils „Mann ohne Eigenschaften“. Er verfasste zahlreiche Dramen, die wie beispielsweise „Hamlet for You“ internationale Erfolge feierten. Obgleich in seinen Stücken häufig traditionelle Figuren aufgegriffen werden, versucht er stets einen oft humoristischen, aber auch kritischen Bezug zur Gegenwart herzustellen. Im Rahmen eines deutsch-chinesischen Literaturprojektes entstand die Anthologie „Tales of Two Cities“, die Seidel 2014 gemeinsam mit dem Autor Andreas Nohl veröffentlichte.