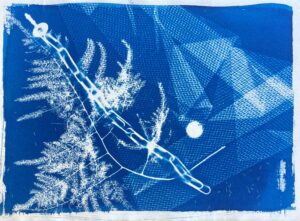von Anja Seemann
Tim war wach, und er hatte keine Ahnung, was ihn geweckt hatte.
Es war noch dunkel draußen und überhaupt hatte er ganz gut geträumt. Er tastete auf der Matratze herum. Hannibal lag nicht mehr neben ihm. Sie schnarchte manchmal. Leise eigentlich, aber zu laut für jemanden, den Oma immer als »Hase unterm Gebüsch« bezeichnete. Bevor sie Hannibal aus dem Tierheim geholt hatten, hatte Tim nicht einmal gewusst, dass Katzen schnarchen. Vielleicht hatte sie etwas runtergeschmissen. Machte sie beim Erkunden öfter oder wenn sie ihre »verrückten fünf Minuten« hat. Tim entschied sich nach ihr zu rufen. Hannibal hört nicht auf »Hannibal«. Sie hört nur auf Tim und nur wenn er mit seiner Zunge klackte. Heute hörte sie gar nicht. Etwas, das ein Mauzen zu sein schien, kam aus dem Wohnzimmer. Mama hatte Hannibal schon häufiger irgendwo eingesperrt: im Bad, im Schrank, in der Waschmaschine, meistens im Schlafzimmer, weil Hannibal allen auf Schritt und Tritt hinterherlief. Sogar aufs Klo.
Tim rollte sich vorsichtig aus dem Bett. Nicht einmal seine Nachttischlampe traute er sich anzumachen. Es war fast unmöglich sich an Hannibal anzuschleichen – sie war immerhin eine Katze. Katzen hören Mäusegetrappel unter der Erde. Wenigstens einmal aber wollte er sie mit den eigenen Waffen überlisten.
Die Wohnzimmertür stand einen Spaltbreit offen. Licht brannte. Hannibal war ein Profi, wenn es ums Türöffnen ging. Lichtanmachen wäre neu, was eigentlich nur eins bedeuten konnte: Mama war noch wach und wartete bis Papa von der Arbeit heimkam. Tim hatte auch schon versucht zu warten, war aber immer eingepennt. Außerdem konnte er Papa beim Frühstück sehen. Da war er immer da. Montags sogar den ganzen Tag, weil Montag für ihn das war, was für andere Sonntag ist.
Tim überlegte, ob er nicht lieber wieder ins Bett gehen sollte, als er das Mauzen noch einmal hörte. Jetzt, da klar war, dass Mama wach war, klang das Geräusch gar nicht mehr nach einer Katze. Tim kam näher. Der Fernseher war an. Mama hätte ihm nie erlaubt, so lange zu fernzusehen, weil er »viereckige Augen« bekommen würde und Tim sah nicht, warum für Mama andere Regeln gelten sollten, bloß weil sie ein Erwachsener war. Er übte kurz sein bestes Ausschimpf-Gesicht und ging dann entschlossen auf die Tür zu.
Mama hockte auf dem Boden, was merkwürdig war, schließlich hatte Papa extra eine neue und viel bequemere Couch gekauft. Sie heulte, was noch viel merkwürdiger war. Mama heulte nicht. Zumindest hatte Tim sie nie heulen gesehen. Er war sich nicht sicher, ob das etwas war, was sie überhaupt konnte – so wie er Schnipsen nicht konnte. Aber sie hockte da, zusammengekauert und sah aus, als wäre sie eben erst geschimpft worden: Ihre Augen waren rot, Tränen liefen ihr die Backen runter und Rotze aus der Nase. Trotzdem schniefte sie nicht in ein Taschentuch, was – mit den ganzen Tempos im Bad – nicht richtig war. Erst als sie zu reden begann, bemerkte Tim, dass sie sich das Telefon ans Ohr hielt.
»Hören Sie, ich weiß, die Lage ist chaotisch, aber – «
So hatte er Mama noch nie gehört: schrill und außer Puste. Wie ein Baby, das sich nicht beruhigen lassen wollte. Sie zitterte, als wäre ihr kalt. Langsam erst, dann ganz stark. Noch mehr Tränen kamen aus ihren Augen und sie schien angestrengt nachdenken zu müssen, um zu verstehen, was der Mensch – wer auch immer mit ihr so spät noch telefonierte – ihr am anderen Ende sagte.
»Bitte, ich will nur wissen, ob – « Mama erstarrte. Wie ferngesteuert nahm sie den Hörer vom Ohr. »Aufgelegt«, sagte sie.
Dann machte sie wieder dieses wimmernde Geräusch, bei dem Tim ganz schlecht wurde. Am liebsten hätte er sich die Ohren zugehalten und wäre in sein Bett zurückgekrochen, aber er konnte nicht. Mama hatte ihn nie alleine gelassen, wenn er traurig war. Er würde sie auch nicht alleine lassen.
»… Mama?«
Sie schien ihn nicht gehört zu haben.
»Mami?«, rief er noch einmal, etwas mutiger. »Was hast du?«
Sie sah ihn an, sagte aber nichts. Es war, als hätte sich zu ihnen eine dunkle Wolke ins Zimmer gequetscht.
»Warum weinst du?«
Sie wandte das Gesicht ab und fuhr sich mit dem Handrücken über die Augen. »Nicht jetzt, Timothy«, schniefte sie und wedelte in seine Richtung. »Geh zurück ins Bett.«
»Warum schläfst du nicht? Wo ist Papa? Wieso ist er noch nicht zurück? Er – «
»Nicht jetzt!«, schrie sie ihn an. Dann zuckte sie zusammen und schlug sich eine Hand vor den Mund. Die andere war eng um ihren Bauch gelegt. Tim wusste nicht, was er tun sollte. Gehen wollte er nicht. Bleiben wollte er nicht.
»Warum rufst du ihn nicht an?«, fragte er.
»Bitte«, bat sie, aber Tim verstand nicht, was genau. »Bitte. Es ist alles gut, Schatz. Bitte geh schlafen.»
»Ich kann ihn anrufen, wenn du magst.«
Endlich war ein Lächeln um ihren Mund, aber es war traurig. »Er geht nicht ran«, sagte sie. Das Wimmern wurde lauter. Tim hatte seine Mutter noch nie umarmt. Es war immer seine Mutter, die ihn umarmte und küsste und knuddelte wie ein Stofftier. Mutig sein. Er musste mutig sein. Sie hörte nicht auf zu schluchzen, aber vergrub ihr Gesicht in seiner Schulter.
»Mama, du machst mir Angst«, flüsterte er gegen ihren Hals. Sie drückte ihn fester an sich. Es war erst, als ihr Schnaufen leiser wurde, dass Tim mitbekam, was im Fernseher lief. Er hörte Eilmeldung, Hamburg, Explosion, Theater im Hafen und immer wieder ein Wort, das in den Nachrichten in letzter Zeit öfter aufgetaucht war: Terroranschlag.
Es war nur noch einer übrig – wenn man den Polizisten nicht mitzählte, der neben der Tür stand und die Leute nacheinander hineinließ. Ein Junge. Er war nicht so rausgeputzt wie er. Niemand hatte es für notwendig gehalten, ihm die Haare zu kämmen, ihn in seine besten Anziehsachen zu stecken und ihm zu verbieten darin herumzutollen. Tim zog eine Grimasse. Der Junge warf ihm einen kurzen Blick zu, sagte aber nichts. Nicht einmal als Tim sich neben ihn setzte.
»Ich heiße Tim«, sagte Tim und streckte seine Hand aus. Der andere Junge zögerte. »Eigentlich Timothy oder Timokles, der Große.« Gerade, als Tim ihm sagen wollte, dass es unhöflich sei, eine angebotene Hand nicht zu schütteln, griff der Junge zu.
»Mazin«, sagte er. »Nur – Mazin«, fügte er mit einem kleinen Lächeln hinzu.
»Mazin?«, wiederholte Tim. »Den Namen habe ich noch nie gehört.«
»Er bedeutet Regenwolken«, erklärte Mazin und klang so stolz dabei, dass Tim ihm nicht sagen wollte, dass er das sogar noch seltsamer fand. Wer wollte denn schon Regenwolken heißen?
»Kommst du aus einer Indianerfamilie?«, fragte Tim und hätte sich am liebsten auf die Zunge gebissen. Was für eine bescheuerte Frage.
Mazin schüttelte den Kopf. »Wie kommst du darauf?«
»Nur so«, wich Tim schnell aus und starrte auf seine Füße. »Hast du auch jemanden verloren?«
»Verloren?«
»Na, du weißt schon … gestorben.«
Mazin schwieg. Er starrte nun auch auf seine Füße. »Mein Vater.«
Tim nickte. »Ich auch.« Es war merkwürdig über etwas zu reden, das man nicht verstand und das nicht aufhörte wehzutun. Tim spürte die Tränen wieder brennen. Er hob seinen Ärmel und am liebsten wäre er jetzt bei Opa auf der Shelluna draußen vor der Küste. Opa hätte gewusst, was zu tun wäre. Da war ein Ziehen an seinem Arm. Tim sah hoch.
»Hier«, sagte Mazin und hielt ihm die Hälfte eines Keks hin. Den anderen schob er sich in den Mund. »Mit Honig«, erklärte er, als würde das den Keks zum allerbesten Keks auf der Welt machen.
»Danke«, sagte Tim. Tim mochte Honig nicht besonders, aber als er Mazins Blick sah, biss er ab. Und tatsächlich war der Keks gar nicht so übel. Er nickte zustimmend. Mazin lächelte.
»Glaubst du«, sagte Tim, nachdem er die Keksbrösel von seiner Hose gewischt hatte, »wir können spielen, wenn das hier vorbei ist?«
»Ich weiß nicht …«, antwortete Mazin unsicher. »Ich hoffe.«
»Bau keinen Mist, dann sagen unsere Mamas sicher nicht nein«, sagte Tim.
»Mazin Yousif?«
Die Stimme ließ ihn und Mazin zusammenschrecken. Es war ein Arzt. Zumindest sah er aus wie ein Arzt. Er stand neben dem Polizisten und lächelte. Tim hatte trotzdem das Gefühl, als hätten sie etwas falsch gemacht.
»Du darfst jetzt hineingehen.«
Mazin schluckte. Stocksteif stand er auf und warf der Tür einen ängstlichen Blick zu.
Tim, den Geschmack des Keks noch auf der Zunge, rief ihm hinterher: »Denk daran: ich warte später auf dich, ok?«

Anja Seemann, 1991 im Herzen des Bayerischen Waldes geboren, studiert in Regensburg Germanistik mit dem Schwerpunkt Neuere Deutsche Literatur und Didaktik der deutschen Sprache. Neben der Uni jobbt sie im Kino und ist als Regieassistenz beim Germanisten Theater tätig. Die Handlungen ihrer Texte beschäftigen sich mit den Auswirkungen des Weltgeschehens auf das Leben Einzelner. Sie schreibt in deutscher und englischer Sprache. T wie Timokles. M wie Regenwolken entstand im Rahmen des Studentenseminars der Bayerischen Akademie des Schreibens zum Thema „Stadt. Land. Fluss.“