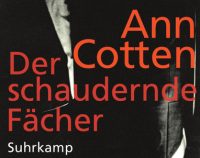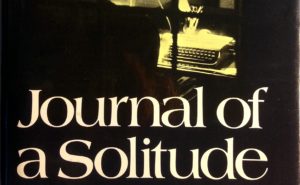“Finde ich einen guten Verlag? Wird mein Buch der Erfolg, den ich mir wünsche? Komme ich auf die Buchpreisliste?” Glavinics Roman-Doppelgänger ist gezwungen, unter dieser quälenden Anspannung sein Alltagsleben zu meistern. Und das mehr schlecht als recht, wie es den Anschein hat.
Mit irrsinniger Komik und halsbrecherischer Akrobatik zwischen Realität und Fiktion schildert der Autor den Standpunkt des Schriftstellers innerhalb des Literaturbetriebs. Wer einen Roman schreibt, muss “in gewisser Weise über sich selbst schreiben”, erklärt Glavinic bei einer Lesung. Und mehr als einmal fragt man sich: Wie viel vom Autor steckt denn nun in der Romanfigur? Oder wie viel Romanfigur steckt im Autor?
Die Romanfigur lässt sich treiben von der eigenen Hypochondrie, die ihn zu Dates mit unbekannten Ärztinnen zwingt, nervenaufreibenden Familientreffen und ganz zu schweigen von den Erlebnissen innerhalb der Literaturfabrik: Geschäftsessen, an denen das Beste der Wein ist, unangenehme Begegnungen mit Journalisten und Starautoren sowie Lesungen, die man besser nicht besucht hätte.
Dass der Autor seinen Romandoppelgänger bei all dem selten vorteilhaft schildert, macht die Figur umso sympathischer. Wir verzeihen ihm den übermäßigen Alkoholkonsum, wir verzeihen ihm, dass er seine viel zu verständnisvolle Frau eigentlich jeden Abend zu Hause warten lässt und auch, dass er sich gelegentlich nach zu viel Wein an deutlich ältere Frauen heranwagt. Denn während sein Freund Daniel Kehlmann es mit “Die Vermessung der Welt” auf die Bestsellerliste geschafft hat, fragt Glavinics Mutter, was ihren Sohn denn bis jetzt davon abgehalten hat. Nicht weniger komisch ist es, wenn der Erzähler mit seinem nörgelnden Schwiegervater im Sessellift festsitzt oder seine Oma ihm eine Widmung “für Herrn Primarius Doktor Weinstödl” in eines seiner Bücher diktiert, “mit innigem, herzlichen Dank für die Pflege, die Sie meiner Großmutter Judith Schneider im Krankenhaus haben angedeihen lassen”.
Doch bei aller unterschwelligen Kritik wollen die Romanfigur, als auch der Erzähler mit deren Darstellung, nie so recht boshaft klingen. Vielmehr hebt der (Anti)Held des Buches immer wieder ganz sanft hervor, dass er die Banalitäten des Alltags auch irgendwie mag. Er liebt seine Gewohnheiten und seine Familie, ja, er versteht eigentlich nicht so ganz, wie seine Verwandtschaft sich eigentlich so gut mit ihm arrangieren kann.
Indem der Autor Glavinic alltägliche Situationen pointiert beschreibt, vollzieht er einen sensiblen Balanceakt zwischen der Darstellung harter Realitäten und einem ausgeprägten Gespür für die zumeist tragikomische Wirkung dieser Situationen.
Eine Antwort darauf, wo Autor und erzählendes Ich aufeinander treffen, gibt das Buch jedoch nicht. Lediglich Glavinic selbst gesteht: “Wäre das mein Leben, würde ich Selbstmord begehen.”
Glavinic thematisiert die Frage nach dem Autor in der Gesellschaft, indem er die Erwartungshaltung des Lesers nutzt, um das scheinbar Reale in seiner Geschichte hervorzuheben und um die Fiktion als Teil des wirklichen Lebens vorzuführen.
So scheint auch das Urteil einiger Literaturkritiker, der Roman sei lediglich eine lasche Abrechnung mit dem Literaturbetrieb und der Autor selber ziemlich mutlos, in Anbetracht des Gespürs für derart wirkungsvolle Feinheiten ungerechtfertigt. “Das Heroische will nicht mein Fach sein”, gesteht auch Glavinics Roman-Ich ohne Scham. Maßlose Übertreibungen wären in diesem Buch fehl am Platz. Der Autor nutzt seinen grandiosen Wortwitz und die scheinbare Realitätsnähe, um zu zeigen, wie ein bangender Schriftsteller sich fühlen muss, der auf die Gunst des Literaturbetriebs angewiesen ist, aber gleichzeitig schon alles durchschaut hat. Auch sich selbst.