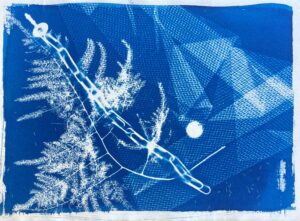von Carina Knobloch
»Wann treffen wir drei wieder zusamm?«
»Um die siebente Stund’,am Brückendamm.«
»Am Mittelpfeiler.«
»Ich lösche die Flamm.«
»Ich mit.«
»Ich komme vom Norden her.«
»Und ich vom Süden.«
»Und ich vom Meer.«
»Hei das gibt ein Ringelreihn,
und die Brücke muß in den Grund hinein.«
»Und der Zug, der in die Brücke tritt
um die siebente Stund’?«
»Ei der muß mit.«
»Muß mit«
»Tand, Tand
ist das Gebilde von Menschenhand!« — Theodor Fontane.
Sie fühlen sich selbstbestimmt, autark und frei. Sie denken, sie seien die Herrscher der Welt. Die Erde drehe sich um sie, die Menschen.
Nichts ist gefährlicher, als sich in Sicherheit zu wiegen.
Schottland, 28. Dezember 1879
Tunnel 47
Noch ein Strich. Meine Mutter schaltete die Scheinwerfer ein, keine zwei Sekunden später ließen wir das Sonnenlicht hinter uns und tauchten in das dunkle Gestein. Tunnel 47. Das monotone Brummen des Motors machte mich schläfrig. Den Kopf an die Fensterscheibe gelehnt, starrte ich die Reifen der Autos an, die an uns vorbeirauschten. Wenn man lange genug hinsah, wirkte es, als würden sie sich rückwärts drehen. Ich genoss das Nichtstun. Es lief ein Hörspiel meiner kleinen Schwester, das stimmte sie zufrieden, trotz der langen Autofahrt.
Kurz hell, als würde man bei einem altmodischen Diaprojektor ein Bild weiterschalten, und schon wieder war es dunkel.
»Ich hab noch nie so viele Tunnels gesehen.«
Lilli malte einen weiteren Strich auf ihre Liste.
»Tunnel«, verbesserte meine Mutter sie. »Oder was auch immer das hier sein soll.«
Der Zustand der Röhren hatte sich phänomenal verschlechtert, seit wir die italienische Grenze passiert hatten. Spärliche Beleuchtung, von den Wänden bröckelnder Putz und ungleichmäßig aufgehängte Notausgangschilder. Wenn es denn überhaupt welche gab.
Jetzt war der Urlaub vorbei.
Die kleine Küstenstadt war wirklich schön gewesen. Beinahe malerisch eingebettet zwischen dem endlosen Ozean und prominenten Bergen, die sich bis weit ins Landesinnere erstreckten. Die Häuser waren in gelb-orangen Farben gehalten, was das Ganze aus der Ferne wie einen Zitronenbaum wirken ließ. Eine Brise wehte vom Meer hoch hinauf ins Gebirge, es roch salzig und nach Süden.
Lilli saß neben meiner Mutter auf dem Beifahrersitz und übte Kartenlesen, als die Rücklichter des Autos vor uns immer roter wurden. Es krachte. Ich sah fast nichts, es war dunkel, und alles ging ganz schnell. Aber ich liebte Lilli, ich liebte meine kleine Schwester. Es knallte, Bremsen quietschten, Stillstand. Mein Kopf, der nach vorne flog, der Gurt, der mir die Luft abschnürte.
Schreie.
Panik.
Stille.
Noch ein lauter Knall, es wurde warm, wärmer. Licht flackerte. Loderte. Alles drehte sich, Licht verschwamm zu Kreisen, als würde man bei Nacht die Kamera nicht ruhig halten. Es roch seltsam, ich bekam schlecht Luft.
Wieder Stille.
Ich versuchte, die Augen offen zu halten. Ein dunkles Auto, das mit quietschenden Reifen davon fuhr. Schnell, sehr schnell, schon war es weg. Alles war doch so langsam.
Stille.
Die Tunnelbeleuchtung flackerte und flackerte, wie ein Meer aus Glühwürmchen. Dann wurde der Himmel schwarz. Unten. Das Meer?
Alles drehte sich.
Dafür war es warm, und ein neues Licht kam auf uns zu.
Auf uns?
Ja, auf meine Mama, meine Schwester und mich. Auf meine Familie.
Aber meine Familie schlief.
Ich wollte auch schlafen.
Ich war so müde.
Martinshorn. Konnte das mal jemand ausschalten?
So laut.
Scheinwerfer. Blaulicht.
Ich war doch so müde.
Als alles verschwamm und schwarz wurde — Stille.
Ich lag. Soviel registrierte mein Gleichgewichtssinn noch. Aber ich drehte mich auch irgendwie. Und gleichzeitig zog mich eine ungemeine Kraft tiefer in den Untergrund. Schwer war ich. Versteinert waren meine Glieder. Und Steine lagen auf meinen Augen.
Es drehte sich. Ich drehte mich. Die Stille kam und ging. Manchmal hörte ich leise Stimmen. Nicht so, dass man sie verstehen würde, aber so, dass man wusste, jemand war da. Meistens waren die Stimmen hektisch und unfreundlich, und ich wollte sie nicht ertragen. Dann wartete ich einfach, bis ich wieder tief in das Schwarz gesogen wurde.
In einem seltsamen Übergang zwischen leicht und schwarz vergaß das Schwarz, die Steine in meine Augenlider zu legen, und ich konnte sie ein bisschen heben. Da wurde es gelb. Aber nicht schön hell, so wie im tiefem Schwarz, sondern unangenehm, laut gelb. Also ließ ich die Steine wieder zu und versank.
Stille.
Ich war jetzt in Italien. Irgendwo zwischen Urlaub und daheim. Immerhin das erkannte ich an der Sprache. Und sonst? Keine Ahnung.
Meine Kehle fühlte sich an, als hätte ich seit Monaten nichts mehr getrunken. Alles war trocken, vollkommen ausgetrocknet. Meine Zunge pappte am Gaumen. Ich wollte die Augen öffnen, aber es ging nicht. Irgendetwas klebte. Ich probierte es wieder und wieder, doch nichts geschah. Ich wollte mit der Hand nachhelfen, aber keiner meiner Finger ließ sich bewegen. Ich bekam Panik. Was war hier los?
Ich begann zu schluchzen und musste tiefer Luft holen, um genug Sauerstoff zu bekommen. Und erstarrte mitten im Einatmen, als ich merkte, wie weh es tat. Mein ganzer Brustkorb schmerzte. Vor Schreck sog ich noch mehr Luft ein, schrie. Endlich ließen sich meine Lider öffnen. Menschen standen um mich herum, tuschelten. Nach ein paar Minuten konnte ich sogar Gesichter erkennen, auch ein Fenster links von mir und ein Nachtkästchen. Es war leer.
Eine Frau fragte den Mann neben meinem Bett etwas. Er trug einen weißen Kittel. Die Frau einen hellblauen Kasak. Ich ärgerte mich, dass ich es nicht früher verstanden hatte. Wo wachte man denn schon auf, wenn man nicht wusste, wo man war? Dabei hasste ich Krankenhäuser.
»Mama!? Lilli?!« Ruckartig versuchte ich mich aufzusetzen, um einen besseren Überblick zu haben. Da stand noch ein Bett neben meinem, irgendwo mussten sie schließlich sein. Wahrscheinlich ging es ihnen schon längst wieder gut und sie waren -
Der Mann im Kittel schaute mitleidig.
Die Frau neben ihm schüttelte bedauernd den Kopf. Das Bett war leer.

Dorothea Kaiser, 1991 in dem weitestgehend unbekannten Städtchen Minden geboren, studiert Theater- und Medienwissenschaften und Amerikanistik in Erlangen, arbeitet nebenher als Maßschneiderin in Nürnberg und als freiberufliche Kostümbildnerin deutschlandweit. Als Ausgleich zu wissenschaftlichen Texten und Näharbeiten widmet sie sich in ihren freien Minuten dem Schauspiel und dem literarischen Schreiben, dabei versucht sie sich an Kurzgeschichten, Gedichten, Theaterstücken und Songtexten. Ihr Schreiben bezeichnet sie als experimentell, rhythmisch und subtil selbstironisch.