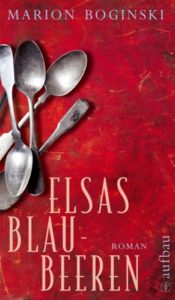von Veronika Raila
Seine Hand lag auf dem Notizbuch, seine rechte Hand. Er legte sie sanft auf das Leder, liebevoll strich er über die Narben. Seine Hände, weich in der Haltung, aber entschlossen in der Handlung, waren Klaviertasten gewöhnt, Klaviertasten aus Elfenbein und Ebenholz. Seltsam mutete es an, dass man Elefantenstoßzähne Elfenbein nannte, wo doch die beiden Körper so gar nichts gemein haben.
Schmales Handgelenk, weicher Handrücken, lange Finger, die beiden Gelenke mit samtigen Hautfalten gepolstert, gepflegte, kurze Nägel. Unmissverständlich sprachen seine Hände zu ihm. Diese Hände taten nie schwere Arbeit, schaufelten keine Kohle, hielten weder Hammer noch Sense, gruben auch nicht in der Erde, rollten keine Fässer und wer wusste, was sie alles noch nicht machen konnten. Stehen, ja das wollte er jetzt, aufstehen und in die Ferne blicken, ohne einen Blick zurückwenden zu müssen, nicht im Zorn, sondern im Nebel. Der Nebel verschleierte alles, an manchen Stellen lagen mehrere Schichten übereinander. Die Verdichtung hielt das Gestern fern.
Ein Gedanke konnte es schaffen, ein Gedanke konnte eine Lage wegziehen. Die Umrisse eines Erlebnisses, ein Gefühl, ein Geruch etwas Farbe kam zum Vorschein. Er strengte sich an, mehr zu erkennen, aber der Nebel wurde nie so dünn, dass er klar sehen konnte. Manchmal schien es ihm auch, dass, je mehr er sich anstrengte, der Nebel genau an dieser Stelle wieder dichter, undurchdringlicher wurde. Er legte sich nieder, das weiße Laken kühlte seine Gedanken, kühlte den erhitzten Körper, umhüllte seine Seele. Der Schlaf überfiel ihn, Morpheus nahm ihn in die Arme, ließ ihn fallen, ganz tief fallen, er schlug nicht auf, niemals. Es war immer wieder der gleiche Traum.
Er saß im Zug, schaute aus dem Fenster, die Landschaft flog an ihm vorbei, das Rattern der eisernen Räder auf den Schwellen beruhigte ihn, er döste ein. Und er hatte einen Traum. Er saß im Zug, die Landschaft flog an ihm vorbei, sie wurde mit zunehmender Geschwindigkeit immer mehr ins Rötliche getaucht, das Rattern der Eisenräder beruhigte ihn, und er schlief ein. Er saß im Zug, die ins Rot verschobene Landschaft flog an ihm vorbei, das Rattern der Eisenräder veränderte den Ton, wurde dumpfer, er schlief ein.
Sein Kopf nickte im Takt der Schwellen, er war noch zu Hause, lag in seinem Bett. Ein scharfer, beißender Geruch stach in seine Nase, hinderte ihn daran, einzuschlafen.
Seine Hände streichelten die Narben, die Narben des Leders. Er blätterte die Seiten des Notizbuches auf. Fein säuberlich waren zu den meisten Kalenderdaten Einträge geschrieben. Beginnend am 1. Januar des Jahres, mit Rosch ha-Schana, nach seinen Aufzeichnungen, feierte er da mit Esther und ihrer Familie. Der nächste und die darauffolgenden Tage waren der Übung von einer fast unbekannten kanonischen Studie von Mendelson gewidmet.
Er saß im Zug, blutrot zog die Landschaft vorüber.
Seine Hand blätterte um, hier stand, dass er am 10. desselben Monats ein Hauskonzert bei Esthers Familie gab. Die Wagners waren auch da, ja so hatte er es vermerkt. Die Rosensteins und sein Lehrer, Kantor Steinfuß, neben ein paar anderen. Ja, genau so stand es geschrieben. Er las es, als ob die Notizen nicht die seinen wären, als ob es ein Fremder geschrieben hätte. Aber nein, das Notizbuch gehörte zu ihm, da stand sein Name, da stand seine Adresse.
Er lag in seinem Bett, nickte im Takt mit den Schwellen, deren Klang immer dumpfer wurden. Ein kleiner Vogel, unscheinbar auf einer dürren Gabelung sitzend, zwitscherte los, tirilierte die Freude, die unbändige Lebenslust heraus.
Nun will der Lenz uns grüßen,
zu Mittag weht es lau;
aus allen Wiesen sprießen
die Blumen rot und blau.
Draus wob die braune Heide ….
… den Sand unter den Sohlen marschierte er in großen Schritten durch den Park, das angrenzende Wäldchen hinter sich lassend, hinaus, hinaus in die weite Welt.
Und er saß wieder im Zug, der die Schwellen fraß, die Gräser rot, die Blüten grün und schwarz. Die Scheiben der Klarheit trübten ein, milchfarben schützten sie.
Nach dem Konzert, also genau genommen vom 10. bis zum 17. Januar suchte er eine neue Bleibe. In der alten überraschten ihn oft Eisblumen auf der Bettdecke, morgens, beim Aufwachen. Treppauf und treppab lenkten ihn seine Schritte quer durch die Stadt, bis er endlich ein kleines, aber gemütliches Zimmerchen bei einer alten Dame fand. Zwei Tage später zog er ein, stand da.
Der Kopf nickte schon automatisch, übernahm den Takt der Räder, beschleunigte ihn, übernahm das Regiment, um endlich ans Ziel zu kommen. Dort würde der Nebel steigen, würden die Scheiben wieder klar werden, das Gras grün, die Blüten rot und weiß.
Er lag im Bett, sein Blick fiel auf die weißgestrichene Tür mit grüngetönten Scheiben in den Oberlichtern. Daneben, an der Wand, weiße Kacheln, die an manchen Stellen schon etwas abgestoßen waren. Ein Waschtisch und auf der Stange, ein Handtuch, dunkelrot, dunkelgrün und dunkelblau gestreift. Der Bademantel hing daneben, ebenfalls gestreift nach Herrenart. Kein Spiegel. Das Fenster zum Park, zimmerhoch, mit weißen Gitterstäben geschützt. Kein Schrank, nichts für die persönliche Habe und die Seligkeiten. Was hatte ich getragen, an und bei mir? Lange Hosen, kurze Hosen, Hemd, weiß oder kariert, Jackett mit Spiegel, oder kragenlos? Murmeln, einen Bindfaden, oder einen Bleistift mit Radiergummi? Er konnte sich nur an etwas Glattes, Kühles erinnern, Farbe verschwand hinter Schleiern aus Nebel.
Der Schlüssel drehte sich im Schloss. Knarzend öffnete sich der Flügel ein kleines Stück, das Licht der Glühbirne im Gang zeichnete einen hellen Streifen am Boden, bis zum Fenster. Draußen war es dunkel geworden. Eine Schwester in Tracht kam und hielt mir ein kleines Glasschälchen hin, wortlos deutete sie, die beiden Pillen zu schlucken. Seine Finger zitterten, die Hand auch. Er nahm beide in den Mund, nahm einen großen Schluck Wasser aus dem hingehaltenen Glas und sank wieder in Morpheus Arme.
Wieder saß er im Abteil, blickte nach draußen, die Landschaft flog vorbei. Das Rattern der eisernen Räder auf den Schwellen beruhigte ihn, er döste ein. Und er hatte wieder den gleichen Traum. Er saß im Zug, die ins rötlich verschobene Landschaft flog an ihm vorbei, je schneller der Zug fuhr, desto roter wurde die Landschaft, bis das Ganze kippte. Das Gras blutrot, die Bäume weiß, die Blüten schwarz. Gelbe Blumen waren mit Tinte übergossen, die orangen ins Violett gefallen. Das Rattern der Eisenräder beruhigte ihn nicht mehr, dennoch sank er in ein tiefes Loch. Er träumte, er saß im Zug, verdrehte Landschaft flog an ihm vorbei, das Rattern der Eisenräder veränderte seinen Ton, wurde pochender.
Die Hand lag auf dem Leder mit den Narben. Das vergilbte Papier des Notizbuches offenbarte eine Lücke zwischen dem 19. Januar und dem 2. Februar. An diesem Tag war eine Kerze zu finden, eine Kerze, deren Bedeutung er sich nicht mehr entsinnen kann, aber die darauffolgenden Tage waren wieder mit Übungen angefüllt, Tschajkowskijs 6. Symphonie nahm viel Raum ein.
Am Ende der Musik schwoll der Applaus an, eigentlich sollte man sagen, er brauste über ihn hinweg, rauschte auf den hinteren Teil der Bühne, und machte sich davon, stahl sich hinaus, durch den Bühnenausgang und war dann einfach weg. Der Applaus konnte nicht zu ihm gehören, er war zu groß, zu mächtig, seine Ohren konnten ihn nicht ertragen. Schwarze Blumen an den Fenstern, seine Haut eiskalt und schwitzend. Dennoch: Hier war etwas, was zu ihm gehörte, etwas Kleines, Leises. Er durchforstete seinen Körper von oben bis unten, vom Kopf bis zu den Füßen, ja genau, die Füße, mit denen er die Pedale trat, am linken Fuß die Ferse, die, an die erinnerte er sich genau. Der Schmerz war immer da, der Schmerz, der ihn an etwas erinnerte, aber das Ganze war hinter den sieben Schleiern verborgen. Erleichtert atmete er auf, an den Schmerz konnte er sich genau erinnern, ja der gehörte zu ihm.
Er schlief ein, Landschaften in Rot, Blumen in Schwarz, Zug fraß die Schwellen.
Er erwachte. Der Morgen vertrieb das Dunkel der Nacht, die Sonne strahlte so hell, klärte auf, und wog ihn in Gewissheit. Es gab noch den Tag, der die Nacht ablöste. Darauf konnte er bauen. Er sog die frühe Morgenluft durch die Nase in die Lungen. Er verband sich mit der Welt. Er wollte nicht aus der Realität fallen. Durch das Atmen verknüpfte er sich mit ihr, verzurrte sich in ihr. Bloß nicht aufhören zu atmen, immer weiteratmen, sein Brustkorb hob und senkte sich im Rhythmus der Verknüpfungen. Ich spüre mich, ja hier bin ich, noch nicht in der absoluten Leere verschwunden. Trunken vor Freude schlief er ein.
Landschaft blutrot, Blumen kohlrabenschwarz, das Hämmern der Schwellen erschlägt.
Die Hand lag wieder auf dem genarbten Leder. Die darauffolgenden Tage, also die nach Tschajkowskij „Sechster“ nahm er sich Liszt vor. Er fiel in die Klangräume von Nocturne. Sie umarmten ihn, umwanden seinen Körper, streichelten die wunde Seele. Die einzelnen Töne baten um Einlass, schmeichelten sich in sein Ohr, verbreiteten ein Gefühl der Liebe.
Er lag in seinem Bett, blickte auf die weißen Gitterstäbe, die die Welt draußen hielten, die Schleier des Vergessens umhüllten seinen Kopf, umhüllten das, was er suchte, die Erinnerung. Aber er ließ es geschehen, wehrte sich nicht, ließ seinen Körper entgleiten, trennte Körper vom Geist, hoffte auf Vergebung.
Gehörte der Name im Notizbuch zu ihm? War es sein Notizbuch? Braun vernarbtes Leder, vergilbte Seiten, das Papier schon mitgenommen, abgetragen vom angefeuchteten Zeigefinger, nein, nicht vom Finger, sondern von der Feuchte und dem Papier, das anquoll und bei jedem Umblättern ein kleines bisschen abrieb, ein paar Fussel, die dann zu Boden fielen, die das Blatt verkleinerten, die einfach nicht mehr da waren. So gesehen, ein schmerzhafter Verlust seiner Aufzeichnungen, ein unwiederbringbarer Verlust. Jedes Mal, wenn er etwas nachschlägt, versucht sein Leben zu ordnen, die Bilder, die unter dem Schotter zerstreut, teilweise zerborsten liegen, zusammenzusetzen und dann noch chronologisch zu ordnen, fällt es ihm schwerer. Je mehr er sich erinnern möchte, desto weniger ist da, einfach abgerieben, abgerieben zwischen Finger und Papier.
Ja, was gehörte zu ihm, was war seines? Das Notizbuch mit seinem Namen, dessen war er sich aber nicht ganz sicher, was, wenn es doch einem anderen gehörte, einem Freund vielleicht, einem Freund, den er gut kannte, dessen Vorlieben die seinen waren, dessen Gefühle den seinen ähnelten, oder sich aufgrund einer besonderen Zuneigung bereits eingeschrieben hatten? War es die besondere Vorliebe für glatte und kühle Stoffe, die sich durch den Nebel kämpften, oder war das auch eine Einbildung?
Er sah an sich hinunter, begann von oben. Der Kopf, ja der gehörte zu ihm, mitsamt seines Inhalts, die Arme, ja auch diese, die Hände waren ihm vertraut, er liebte sie sogar ein kleines bisschen. Sein Körper, besser gesagt, sein Rumpf, zäh ausgeformt, oder sollte man sagen, hager, der gehörte wohl auch dazu, ganz einfach, weil er am Kopf festgewachsen war. Nun waren da seine Beine, die in die Füße ausliefen. Und hier war ein starkes, ein sicheres Merkmal. Hier war der Schmerz, der Schmerz, der manchmal vom ganzen Körper Besitz ergriff. Genau dieser Schmerz, dessen bin ich mir ganz sicher, dieser Schmerz gehört zu mir.

Veronika Raila, 1992 in Augsburg geboren musste schon immer alles aufschreiben, was sie zu sagen hatte. Nach einer verkürzten Gymnasialzeit fing sie an der Uni Augsburg an, Neuere deutsche Literaturwissenschaften und katholische Theologie zu studieren. Bald gab es auch erste Veröffentlichungen und Preise für ihr Schreiben (Medienecho & Preise). Nach der Bachelorarbeit widmete sie sich voll und ganz ihrem autobiographischen Film „Das Sandmädchen“, der Preise in der Kurzversion und einige in der Langversion (Sandmädchen – Ein Dokumentarfilm von Mark Michel und Veronika Raila) erhielt. Danach kehrte sie an die Uni zurück, um ihre Studien fortzusetzen. Literarisch sind ihre Arbeiten meist im phantastischen Realismus anzusiedeln. Kafka hat sie immer unglaublich inspiriert, daneben Botho Strauß und die Lektüre der mittelalterlichen Heldengeschichten. Sollte sie einmal nicht schreiben oder lesen, frönt sie dem Malen, dem Malen ihrer inneren Bilder.