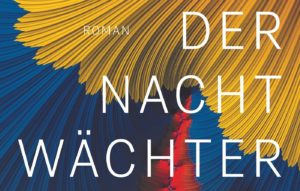Ein Gespräch mit der Schriftstellerin Ulrike Draesner
von Stephanie Waldow
Schau ins Blau traf die Autorin und Übersetzerin Ulrike Draesner im Rahmen des Poetenfestes in Erlangen und sprach mit ihr über die Milch der Postmoderne, die Verwandlung des Gegenwartsautors in eine Stubenfliege und den Luxus, den Literatur bedeutet.
SCHAU INS BLAU: Frau Draesner, in Ihrem Roman Mitgift (2002) gibt es eine sehr enge Verbindung von Körper und Sprache, die mir symptomatisch auch für andere Texte von Ihnen scheint. Ein schönes Beispiel wäre der Umgang mit dem Wort ‚Zeugen’, den Sie in Ihrem Essayband Zauber im Zoo praktizieren. Zum einen verstanden als Geschlechtsakt, als Schöpfung neuen Lebens, und zum anderen als Möglichkeit mit der Sprache ‚Zeugnis abzulegen’.
ULRIKE DRAESNER: Ja, ich fange mal an bei dem Grundversuch, Körper und Sprache überhaupt zueinander zu bringen. Zum einen sind sie auf das Natürlichste miteinander verbunden, ich spreche ja mit meinem Körper, also auch die Wortsprache ist ein Körperprodukt, Lippe, Zunge, Daumen, Kehle. Sie ist in einer zweiten Hinsicht ein Körperprodukt, das sich — und da wird es jetzt schon spannender, was die Körperlichkeit angeht -, das sich der körperlichen Kontrolle ja auch wiederum entzieht. Stimme transportiert viel mehr als man transportiert haben möchte, in sehr vielen Situationen. Hier spricht dann etwas aus meinem inneren Zustand mir in die Sprache hinein, in die geformte Wortsprache, Satzsprache — da spricht mir der Körper in diese Sprache quer. Jeder kennt das: er ist aufgeregt, und was macht man in dem Moment, wo man das Referat hält, den Vortrag: man fängt an zu stottern, zu hicksen, zu schlucken, lauter unwillkürliche Körperreaktionen.
Ich hab in Oxford besonders viel Sprachphilosophie studiert, und eine der Fragen, die mich damals bereits interessiert hat und auf die ich bis heute keine Antwort weiß, ist jene nach dem Zusammenhang von Körperempfindung und Sprache. Was war zuerst da? Es ist eigentlich unsinnig, diese Frage zu stellen, trotzdem taucht sie in diesem Zusammenhang auf, als ein heuristisches Mittel, um sich der Dualität von Körper und Sprache anzunähern. Konkret gesagt: Wir haben fünf Wörter, eigentlich nur vier, vier Geschmacksrichtungen auf der Zunge, vier, fünf Grundwörter für Geschmack. Dennoch ist die Ausdifferenzierung des Geschmacks unendlich. Da ist plötzlich das körperliche Spektrum so weit und ganz diffus und amorph, und die Sprache greift darauf zu, aber tut das extrem ungenau oder sehr unbeholfen. Man lese Weinbeschreibungen, Teegeschmacksbeschreibungen — nur noch Metaphernbildung. Etwas so Grundsätzliches wie diese Vielfalt der Wahrnehmung haben wir nie in Sprache umgesetzt, und da sieht man, wie Körper und Sprache auseinanderklaffen können.
Gegenbeispiel: Man weiß aus psychologischen Studien, dass es hilft, wenn man sich selbst immer wieder anlächelt, schon steigt die Laune. Wenn man sich zehn Mal den Satz vorsagt „Ich bin glücklich‚ ich bin glücklich”, steigt die Laune. Was macht die Sprache? Sprache wirkt zurück auf die Hormonbildung im Gehirn, also Sprache lenkt den Körper. Diese Nahtstellen, diese seltsamen Verbindungen, die sich der willentlichen Steuerung entziehen, nicht aber der Manipulation, interessieren mich. Grundsätzlich gesagt: Sprache und Atem. Gerade im Gedicht natürlich, das ist rhythmisches Sprechen, laut gesprochen, es beeinflusst den Körperzustand, man fühlt sich nach einer halben Stunde Gedichtsprechen — und übrigens auch Gedichthören — anders als vorher, wenn man sich darauf eingelassen hat, die Rhythmik mit dem Körper auch aufzunehmen. Es gibt diesen schönen Gedanken von Roland Barthes, dass Schreiben der Versuch sein könnte, das Sprechen des Körpers in Wortsprache zu transformieren. Das ist für mich in der Lyrik entscheidend. In diesem Zusammenhang sprach mal jemand von der Doppelrhythmigkeit meiner Texte. Es gibt sozusagen den Oberrhythmus, den man als Jambus, Trochäus, Freie Rhythmen oder so etwas bezeichnen kann, und darunter gibt es immer einen zweiten Rhythmus, einen ganz gezielt, nicht bewusst, aber gezielt gebauten Rhythmus aus der Körperlichkeit, der dieses Gebilde, sozusagen die Vision dieses Gedichtes, in mir rückwirkend über den Sprachfilter erzeugt.
In der Prosa ist es anders. In der Prosa eröffnet das Thema der Körperlichkeit eine weitere Ebene. Wenn man an Mitgift denkt, die Festschreibung von Körperlichkeit durch Zweigeschlechtlichkeit, eben dies wird in diesem Roman ja auch als Thema virulent — womit wir endlich beim Akt des ‚Zeugens’ wären und der Frage nach Festschreibung.
SCHAU INS BLAU: Ich möchte noch mal auf die soziale Konstruiertheit von Geschlecht zurückkommen. Inwiefern ist Sprache immer auch Ausdruck von Macht und welche Möglichkeiten gibt es, mit der poetischen Sprache diese Festschreibungen aufzubrechen?
ULRIKE DRAESNER: Für mich ist diese Möglichkeit ein Kern von Literatur und Kunst.
Ich hasse Kästchen, ich muss das wirklich sagen. Wunderbar ist an der Literatur, dass man da sozusagen wie ein echter Holzwurm — kein Bücherwurm — diese Kästchen annagen, aufmachen kann. Man nimmt sie natürlich auf im Schreiben, man zeigt sie. Man zeigt auch ihre Gemachtheit, baut andere. Also dieses Vorgehen aufbrechen und von verschiedenen Seiten beleuchten durch Perspektivwechsel, durch Sprachumgang, auch durch Rhythmik, die da untergründig dagegen läuft. Das gefällt mir, das ist auch einer der Gründe, warum ich lese.
SCHAU INS BLAU: Warum funktioniert dann das Familienmodell in Mitgift am Ende nicht, warum muss Anita sterben? Ist die Gesellschaft noch nicht reif für ein Modell des anderen Geschlechts, nicht nur eines Geschlechts, sondern eines Menschen, der nicht in ein Kästchen passt?
ULRIKE DRAESNER: Ja, vielleicht würde man das so sagen, wenn man von außen auf den Text schaut. Ich versuch es jetzt mal von innen her zu sagen. Das ist ja das, was ich als Autorin vielleicht beitragen kann. Ich schreibe meine Texte nicht mit einem festen Plan, d.h. ich wünschte mir manchmal, das wäre so, aber ich kann es leider nicht. Ich glaube, bei der Mitgift habe ich ungefähr 2000 Seiten weggeworfen, weil dieser Text ganz woanders anfing, als das, was man heute liest, vermuten ließe. Er hat sich erst im über Jahre gestreckten Schreibprozess in seine Form und damit auch seinen Inhalt hineinentwickelt. Für mich entstehen die Figuren erst im Schreiben selbst, und die Antwort auf Ihre Frage ist kurz und knapp: Die Figuren haben das „schöne Ende” nicht hergegeben. Nach dem langen, langen Arbeitsweg war klar: Ich kann diese Utopie vielleicht sehen, aber nicht fühlen. Ich hab es versucht, es war eine Möglichkeit, in die hinein sich das Ende hätte entwickeln können, wie gesagt, es war offen. Aber ich bekam kein Gespür dafür, meine Figuren entglitten mir geradezu. Ich sehe die Figuren im Schreiben vor mir, da ist immer so ein Körper, ein Ton, aber es gibt viele Teile oder Räume in diesen Figuren. Ich hätte sie alle drei, Aloe, ihre Schwester Anita und deren Sohn, in diese neue Familienkonstellation nehmen müssen und das ging nicht. Bei diesem inneren Durchdenken tauchte, sozusagen vom Rand her, Anitas Mann immer stärker auf — wie eine Figur, die sich über einen Horizont herbeischiebt -, und dann steht sie im Bild. Damit war klar, dass die Rechnung nicht ohne ihn zu machen sein würde. Merkwürdig, nicht: es sind nur fiktive Figuren, aber ich bekomme sie ‚real’ in die Wunschvorstellung nicht hinein. Und dann kann ich es auch nicht schreiben.
SCHAU INS BLAU: Der Text und mit ihm die Figuren entwickeln also eine Eigendynamik und emanzipieren sich von der Autorin.
ULRIKE DRAESNER: Das tun sie. Es ist so eine Widerständigkeit des Materials und eigentlich ist es auch ganz gut erklärlich. Der Roman hat fast 400 Seiten und so viele weggeworfene. Er ist eine wirklich ausgebaute, in vielen Details besetzte und ausgestaltete Welt, und diese Dinge fangen an, miteinander zu interagieren. Womöglich können die meisten Leute sich das besser so vorstellen: Mit dem ersten Satz schon legt der Autor die Spur fest. Der große Raum aller Möglichkeiten wird enger, weil es nun bestimmte Vokale, bestimmte Konsonanten, eine bestimmte Silbenlänge, eine bestimmte Farbe, einen bestimmten Rhythmus, eine bestimmte Sichtweise auf die Welt gibt. Und alles andere, was jetzt kommt, muss sich darauf in irgendeiner Weise beziehen. Auf welche Weise, das ist offen, aber es ist da, und je weiter das geht, umso klarer wird, was funktioniert und was nicht.
SCHAU INS BLAU: Sie schreiben immer wieder vom ‚blinden Fleck’. Es gibt so schöne Sätze in Ihrem Essay-Band Zauber im Zoo: „Wie man wird, wenn man erfindet, wer man war.” Oder aber „Herkunft ist immer Erzählung.” Mit Judith Butler gesprochen: Ist dies ein Hinweis auf die sog. ‚Leerstelle des Ursprungs’, eines Ursprungs, den wir mit faktischem Wissen nicht einholen können und stattdessen beginnen, ihn narrativ auszugestalten? Uns selbst zu (er)finden? Wir wissen nicht letztgültig, woher wir kommen, weil unsere Erinnerung und unsere Wahrnehmung erst viel später einsetzen. Das Ich immer auch als Fiktion.
ULRIKE DRAESNER: Ich empfinde das als schönes Geschenk, als Freiheit und Offenheit. Ich glaube, eine meiner ersten Erinnerungen ist: Ich bin in dem Haus, in dem meine Eltern damals lebten, es war so ein angemietetes Haus, und ich sehe das alles vor mir aus der Perspektive einer — ich weiß es nicht — Zweijährigen oder noch nicht mal Zweijährigen. Ich erinnere mich, dass ich laufe, und ich spür’ auch dieses Laufgefühl noch im Körper so stark auf und ab. Das Licht und ich waren auf dem Weg ins Wohnzimmer, da gab es so eine Schiebetür zur Küche. Und da erinnere ich mich daran, dass ich dachte: „Ich. Das bin ich”. Und das war schön, das zu denken. Danach versinkt wieder alles, nach dieser Erinnerung, und davor gibt es mich also auch nicht.
Ich glaube, wenn wir wüssten, wie diese Leerstelle des Ursprungs besetzt ist, wüssten wir auch, wie es ist, zu sterben. Ich weiß nicht, ob ich das wissen möchte. Und vielleicht — das mag alles Illusion sein — gibt es mich sozusagen auch ohne mich. Das Ich ist Fiktion, wenn man so will. Fragt sich nur: was ist dann der Körper?
SCHAU INS BLAU: Das Ich also auch als Lust an der Erfindung oder als Lust am Ich-Sein?
ULRIKE DRAESNER: An dem Gar-Nicht-Ich-Sein vielleicht. Das denke ich, ist ganz eng mit dem Schreiben verbunden.
Im Schreiben gibt es die Erfahrung, dass das eigene Ich zunehmend verschwindet. Ich fühle mich manchmal erinnert an Zustände als Kind. Ich hab’ sehr gern riesengroße Puzzles gemacht. Da sitzt man in seinem Zimmer, ist allein und ist ganz bei der Sache. Ich fühle mich gar nicht mehr, sondern bin total konzentriert. Ich werde da immer unwichtiger, obwohl ich ganz konzentriert und ganz da bin, ganz wach, hellwach, ohne Ich. Dieses Paradox ist ein Zustand beim intensiven Schreiben. Ich werde als dieses Ich, dieses soziale Ich, das hier sitzt und spricht, immer durchlässiger, kleiner. Ich mag diesen Zustand, ich finde ihn wunderbar, denn es ist paradoxerweise zugleich das Gefühl, ganz bei sich zu sein, obwohl ich ganz bei anderen Figuren bin.
Warum erfinde ich fremde Figuren? Diese Figuren bin nicht Ich, sie haben vielleicht einen Teil von mir, auch das mag sehr wohl stimmen, gerade die Figuren, von denen man das vielleicht am Anfang gar nicht denken will, übernehmen Ich-Teile, aber auch viele andere Teile, und das ist eine ganz intensive Art von Kommunikation mit diesem entstehenden Du. Dieses Du ist dann überall, in mir taucht überall dieses Du auf.
SCHAU INS BLAU: Schreiben als Prozess der Entsubjektivierung mit einer sich anschließenden neuen Subjektkonstitution? Und zwar auf beiden Seiten, auf der Ebene des Schreibens und auf der Ebene der Lektüre.
ULRIKE DRAESNER: Das finde ich einen sehr schönen Gedanken, dass man so sagt, wenn ich lese, ziehe ich mir sozusagen auch diese Haut an, ich schlüpf’ da in das Innere hinein. Wenn ich sehr intensiv lese, stundenlang, bin ich vollkommen in dieser Welt drinnen, einst fremd, jetzt nicht mehr, dann wieder, und mache ich dann das Buch zu, ist eben dies der Moment des Übergangs in das, was meine Wirklichkeit ist. Man ist ja da ganz benommen, auch als Leser, man muss auftauchen. Und das gibt es beim Schreiben auch
SCHAU INS BLAU: Sie sind ja auch als Übersetzerin tätig. Könnte man die Arbeit des Übersetzens, dieses sich ‚In-Anderer-Sprache-Befinden’, auch als einen Prozess der Entsubjektivierung, des Abtauchens und Wiederauftauchens als eine Andere, umschreiben?
ULRIKE DRAESNER: Da ist der Prozess ja insofern um eine Ecke gedacht, weil wirklich eine Fremdsprache noch mal mit reinkommt. In meinem Fall als Übersetzerin meldet sich erst einmal das englische Lese-Ich, das auch einen anderen Raum, Leseraum und Erfahrungsraum hat, einen anderen Sprachraum, einen anderen Identitätsraum aus sich heraus entfaltet, was sehr viel unsicherer ist in vielerlei Hinsicht als das deutsche Sprach-Ich, einfach weil es sich in einer fremden Sprache bewegt, in einer Nicht-Muttersprache, die nahe gekommen sein mag, die geliebt wird, und doch eben ‚die Zweite’ ist. Das englische Lese-Ich hat seine Identität aber dort ‚drüben’. Und dann kommt der Moment im Übersetzen, in dem man versucht, die beiden Sprachen sehr präsent zu halten, beide gleich in der Waage zu halten.
Ich hab dann zwei Ichs, das eine, deutsche, ist relativ untergründig, relativ halbbewusst, unkontrolliert. Das lässt sich anstoßen von der zweiten — und beim Übersetzen ja dann doch ersten Sprache. Und zwar am liebsten, ohne dass ich irgendwas weiß von diesem „Original”-Text, etwa davon, wo er hingeht. So lese ich und mache eine Rohfassung. Sie wird für mich die Matrix. Danach muss ich mich auf die andere Seite bewegen, in meine deutsche Sprachidentität. Ich versuche dann, den Text als Objekt zu sehen, Distanz und Nähe sich abwechseln zu lassen, aber erst brauche ich die Affizierung, um sie dann wegzuschieben und dieses deutsche Ich zu werden. Und manchmal kann man das nicht deutlich voneinander trennen, das ist ja auch das Problem bei allem Übersetzen. Man braucht dringend jemanden, der korrigiert und liest, weil sich immer an ein paar Stellen die Grenzen zwischen den Sprachen aufgelöst haben.
SCHAU INS BLAU: Wie gehen Sie mit der Übersetzung von sprachlichen Leerstellen um, gerade die poetische Sprache ist ja geprägt von Leerstellen. Wie lassen sich diese in der anderen Sprache präsent halten?
ULRIKE DRAESNER: Stellen wir uns das mal als großen Abakus vor. Nehmen wir ein Gedicht, stellen es uns als Abakus vor, die verschiedenen Wörter sind jetzt schwarz und rot und man kann sie schieben. Die Drähte sind die Zeilen, und der Trick, wie das Ganze funktioniert, ist, es funktioniert nur über die Leerstellen.
So, und beim Übersetzen übersetze ich alles. Ich handle, also ich will wirklich das Übersetzen jetzt hier ersetzen durch „handeln”, das ist ein Handeln mit diesen Kugeln und den Leerstellen. Und ich muss beides mitnehmen. D.h. ich habe ein Wort, nehmen wir etwa so etwas wie „mind”, ich übersetze es jetzt in meinem spezifischen Zusammenhang mit „Seele”. Ich habe da natürlich schon eine massive Verschiebung. Im Englischen hat das Wort einen ganz anderen Hof — also Konnotation, Assoziation und grammatische Verbindung nehme ich da jetzt alles mit hinein in diesen Hof — als etwa das Wort „Sinne”. Oder „Seele”: Oder „Geist”. Es hat ja auch eine semantische Verschiebung, d.h. die Leerstelle, der Abstand der Leerstelle zu den nächsten beiden Wörtern in der Übersetzung hat sich jetzt schon vollständig verändert, es ist eine ganz andere Form von Leerstelle, die ich da sehe. Eigentlich müsste man es sich dreidimensional vorstellen. Das vergessen viele Übersetzer, dass sie eine doppelte Arbeit haben, eben die Wörter, die Bedeutungen, die Syntax, grammatische Struktur, und zu all dem hinzu dann auch immer noch die Leerstellen mitzunehmen. Ich muss als Übersetzerin diese Leerstellen formen, und das ist aber das Schöne, das besonders Tolle — in mehrfachem Wortsinn — am Gedichtübersetzen. Gedichte arbeiten nun mal in höchstem Maße mit diesen Leerstellen. Jede Sprache hat ihre ganz eigenen Muster, ich kann das ja sowieso nicht eins zu eins übersetzen. Also, was mach ich — und deswegen komm ich doch nochmal zum Abakus -, ich mach ein Plus-Minus-Geschäft, die ganze Zeit. Ich schiebe etwas, handle etwas da hinüber, d.h. da hab’ ich jetzt dieses „mind” verschoben in Richtung „a”, und dann versuch ich natürlich irgendwo an einer anderen Stelle in Richtung „minus a” zu schieben, damit sich ein Gegengewicht bildet. Natürlich gibt es dieses „minus a” nicht einfach so vorgefertigt auf der Texttafel — ich muss es erfinden.
SCHAU INS BLAU: Das ist eine große Verantwortung und nicht zuletzt auch eine ethische Verantwortung, diese Leerstellen nicht festzuschreiben, sondern sie als das klingen zu lassen in der Übersetzung, was sie im Original auch sind.
Apropos Festschreibung: Auch Heimat ist für Sie kein festgeschriebener Ort, sondern ein Vorgang der Kommunikation. Kann also Heimat immer nur das Dynamische, das ‚Sich-in-Bewegung-Befindliche’ sein?
ULRIKE DRAESNER: Das ist natürlich sehr optimistisch gedacht. Ich habe einen Vater, der davon spricht, seine Heimat verloren zu haben, als Flüchtling aus Schlesien, und das auch so empfindet. Für ihn ist Heimat eben nicht nur Kommunikation, sondern ganz eindeutig ein Ort. Und zwar ein merkwürdiger, doppelter Ort. Es ist nicht einfach der polnische Ort, wie wir ihn heute kennen, sondern seine Erinnerung an diesen Ort während seiner Kindheit und an die Gefühle, die an diesen Ort fixiert wurden. Eigentlich eine Form von innerer Kommunikation.
Der Begriff ‚Heimat’ ist vielfältig. Eine Art große Handtasche, die manche Menschen zum Trost mit sich herumtragen. Dagegen ist nichts einzuwenden, aber im Deutschen wird der Begriff von der Tradition her noch immer sehr festgeschrieben und örtlich definiert. Da ist mir die Handtasche lieber. In beiden Fällen allerdings spielt die Kommunikation, die ich mit diesem Ort aufnehme, eine Rolle.
Und natürlich denke ich auch an Sprache bei dem Stichwort ‚Heimat’. Vielleicht weil die Verbindung Sprache-Heimat so ein Schriftstellerklischee ist, und ich sie daher nicht sonderlich mag. Aber es scheint etwas dran zu sein, Ich finde es allemal kurios, dass ich es eigentlich andersherum erlebt habe, also nicht für das Deutsche, sondern für das Englische: das wurde eine Heimat, als es, während ich in Oxford lebte, in meine Träume einwanderte. Also innerlich bei mir ankam. So etwas, eine „fremde Heimat”, kann man dann mitnehmen, an verschiedene Orte mitnehmen. Und das Wort ‚Heimat’ braucht endlich einen ordentlichen Plural.
Heimat aber kann auch Text sein, gelesener Text, geschriebener Text, auch eine bestimmte Landschaftsformation, auch einfach ein Bild, ein Gemälde. Heimat ist also beides: Festschreibung und Beweglichkeit. Gerade deswegen übrigens gefällt mir das Bedeutungsfeld, dieser Wortruf des ‚Zeugens’, von dem zu Beginn unseres Gesprächs kurz die Rede war. Was steckt da im Deutschen nur alles drin und dran. Da hat man also das Zeugen, das Bezeugen, darüber haben wir geredet in Bezug auf die Körpersprache. Aber großartigerweise liegt in diesem schönen Festschreibungsakt des Zeugens — da werden genetische Alphabete aneinandergelegt und festgeschrieben, verhakt miteinander — ebenso das Zeugs, das totale Chaos und Gebrauchs-Durcheinander. Mitklingt zudem der Zug, also etwas wie „das hat Zug”, das zieht mich an, es zieht mich aber auch weiter. Ich bin in Bewegung, war gerade noch festgeschrieben und gleich wieder in Bewegung — und das alles erzählt mir dieses kleine Wort.
SCHAU INS BLAU: Drückt sich in dieser scheinbar widersprüchlichen Bewegung, die für den Begriff der ‚Heimat’ und der ‚Zeugung’ spezifisch zu sein scheint, nicht auch der Wunsch aus, Haltepunkte zu finden, die sich jenseits einer Festschreibung befinden? Und ist diese bewusst aufgesuchte Ambivalenz vielleicht auch spezifisch für die Gegenwartsliteratur?
ULRIKE DRAESNER: Was Sie da beschreiben ist sozusagen die Verwandlung des Gegenwartsautors in die Stubenfliege. Also Saugnapffüße — saugt sich an, klettert die Wand hoch, hängt an der Decke, fällt nicht runter und versucht dann ein bisschen weiterzuklettern. Schönes Bild. Ja, im Großen und Ganzen würde ich jetzt hier plakativ, weil kurz, sagen: Ich bin quasi mit der Milch der Postmoderne verwissenschaftlicht worden -, ich fand das ganz toll, sehr schön, weil das einfach hieß, Bewegung in Dinge zu bringen, die viel zu festgefahren waren, und das schöne große Narrativ als inszeniertes Böses hat mir gefallen. Zugleich habe ich wie wild Romane gelesen und bin schon immer narrativsüchtig gewesen. Gerade bin ich umgezogen und habe in einer uralten Kiste, die lange in meiner Münchner Wohnung auf dem Speicher stand, eine Jacke gefunden aus den achtziger Jahren. So superwattierte Schultern, und ich habe sie angezogen und fühlte mich extrem postmodern. Es ist einfach das Konglomerat der achtziger Jahre — sehr fett. Grafisch breite Schultern, synthetische Stoffe. Und die ganze postmoderne Theorie war quasi in der Luft, um diese Jacke herum. Postmoderne war notwendig, wichtig, ich würde sie in keiner Weise missen wollen.
Und dann war diese Zeit absolut vorbei. Und jetzt sag’ ich etwas, was man auf Deutsch nicht sagt: sie informiert mich und meine Weltsicht vermutlich bis heute, informs it, also in-forms, bildet die Form und steckt auch Mitteilungen und Nachrichten hinein. Das sei zugestanden. Nun aber das große ABER: Die Wende war sehr schnell das Ende der Postmoderne in Deutschland. Zumindest für mich. Das Ende der breiten Schultern. Das Ende der fetten Kohlzeit. Auch in der Literatur entwickelte sich von nun an eine ganz andere, innere Verfassung, etwa was ihre Gefühlsstrukturen angeht, z.B. den Umgang mit Pathos. Was sind Pathosgrenzen? Das find ich sehr spannend. Was wird als Pathos empfunden, wo verlaufen hier Sprechmöglichkeiten? Wo Tabus? Mehr Raum für Ironie, zugleich mehr Luft für Gefühlsausdruck, ohne dass man sich — Ironie ist ja auch immer eine Form von Scham -, ohne dass man sich dessen gleich schämen muss. Mich hat das angezogen. Ich wollte mich nie entscheiden zwischen der Avantgarde und dem Erzählen. Dieser Gegensatz muss doch zusammengeführt werden können. Wie kann ich Pathosgrenzen so erweitern, dass ich in einem literarischen Text ohne Kitsch den Satz „Ich liebe dich” schreiben könnte? Wie schreib’ ich mich dahin? Und vielleicht komme ich nie dort an. Aber: was (er)finde ich auf dem Weg?
Ich möchte noch etwas ergänzen zum Thema „Gegenwartsliteratur”. Als Autor hat man da eine eigene, wohl leicht verschobene Wahrnehmung. Nehmen wir an, mein neuer Roman wäre jetzt erschienen — er kommt erst nächstes Jahr. Ich sitze seit 2005 dran. Den Vorlauf in Gedanken nicht mitgerechnet. Wenn ich mit dem Manuskript fertig bin, vergeht normalerweise etwa ein halbes Jahr, manchmal auch mehr, bis das Buch gedruckt ist. Es liegt da, ganz neu — und ich bin idealerweise bereits anderswo: in einem anderen Text. Er ist meine Gegenwart — die Gegenwart dessen, was ich schreibe ist das, was in fünf Jahren zu lesen sein wird. Gerade in so einer beschleunigten, an Stellen beschleunigten Gesellschaft, ist das fast paradox. Was also ist Gegenwartsliteratur in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit? Und wie sieht sie aus in den Schreiborten?
Hier zeigt sich etwas Schönes an Literatur: Sie ist Luxus. Das hängt eben mit diesem Zeitmoment zusammen. Mag sein, dass sie manchmal ‚voraus’ ist, in Themen und Wahrnehmungsweisen. Vor allem aber zwingt sie zu einer Zeitverlangsamung: ich muss mir Zeit nehmen. Gerade so ein kleines Gedicht liegt ja völlig jenseits aller Verhältnismäßigkeiten, wenn man betrachtet, wie viel Zeit es erfordert — bei Leser und Autor. Das ist extremer Luxus. Es ist ideologisch, was ich da sage, auch das ist natürlich eine extreme Luxusposition. Was ich natürlich sehr schön finde.
SCHAU INS BLAU: Wie würden Sie dann den Zusammenhang von Ästhetik und Gesellschaft sehen? Hat Literatur und hier insbesondere die Gegenwartsliteratur eine ethische Relevanz vielleicht gerade dadurch, weil sie sich den Luxus erlaubt, die gesellschaftliche Zeitrechnung ästhetisch zu unterwandern?
ULRIKE DRAESNER: Literatur hat die Funktion zu bereichern. Ich bereichere mich, indem ich lese, mich auf eine wunderbare Art und Weise mit geistigen und emotionalen Reichtümern konfrontiere, die mir eine Welt nahe bringen, die ich sonst nicht erfahren könnte, die ich mir gar nicht leisten könnte, die man vielleicht nicht mehr betreten kann, weil sie vergangen ist. Und wachse da sozusagen innerlich und füttere mein Innenleben. In den meisten Kontexten wird ja Außenleben gefüttert — Konsum, Werbung usw. Man lebt besser und träumt besser, und das ist für mich eine ganz wesentliche Funktion.
Die Bereicherung durch Literatur ist also nicht nur ästhetisch. Es geht auch um ‚Lebenswissen’. Es sind konkrete Dinge, die mir gezeigt werden. Verhaltensweisen von Menschen, Typologien, Charaktere, Gefühlsmuster — ganze Welten.
SCHAU INS BLAU: Wird also durch die Bereicherung, die ich durch Literatur erfahre, auch meine Lebenswelt in Frage gestellt? Liegt darin nicht auch eine ethische Qualität von Literatur begründet, die den Leser zur Auseinandersetzung mit dieser Bereicherung auffordert, ihm neue Handlungsräume eröffnet, neue Denkmöglichkeiten?
ULRIKE DRAESNER: Nach allem, was man allmählich wieder entdeckt, beeinflussen die ‚ästhetischen Gebilde’ die denkerischen und emotionalen Strickmuster von Menschen. Autoren glauben das schon lange. Vielleicht, weil sie es an sich selbst erfahren haben. Bei mir war es jedenfalls so. Ich liebe diese Rückwirkung auf das (eigene) reale Leben. Das man ja „führt”, heißt es. Auf die Wahrnehmung, und sei es nur, dass man auf Grund eines Bildes, eines Wortes, eines Buches, einen Moment innehält und nachdenkt oder ein zweites alternatives Reaktionsmuster erprobt. Dass man Dinge überhaupt erst entdeckt. Wenn es mir gelingt, meine Wahrnehmungsfähigkeiten zu steigern, dann führe ich in allem ein reicheres Leben, und das kostet mich so gut wie nichts, nur den Preis des Buches, aber vielleicht habe ich es geliehen, und die Lesezeit — eine Zeit, die die Literatur mir nicht vertrieb, sondern vielfach füllte.

Ulrike Draesner, geboren 1962 in München, lebt als Romanautorin, Lyrikerin und Essayistin in Berlin. Ihr erstes Buch, gedächtnisschleifen (Gedichte), erschien 1995. Es folgten weitere Gedichtbände (für die nacht geheuerte zellen, 2001, kugelblitz, 2005, berührte orte, 2008) sowie Romane (u.a. Spiele, 2005) und Erzählungen (Hot Dogs, 2004). Als erste Preisträgerin erhielt sie 2002 den Preis der Literaturhäuser, der sowohl die Qualität des literarischen Oeuvres als auch seine Vermittlung und Präsentation ehrt. Draesner studierte Anglistik, Germanistik und Philosophie, sie promovierte 1992. Sie übersetzt Gedichte aus dem Englischen (u.a. Hilda Doolittle, Heimliche Deutung, 2006, Louise Glück, Averno 2007 und Wilde Iris, 2008, sowie die Radikalübersetzungen von Shakespearesonetten : to change the subject, 2000) und war an verschiedensten intermedialen und on-line-Projekten beteiligt. Gast- und Poetikdozenturen in Kiel, Birmingham, Bamberg. Mehrfache Gastprofessuren am Deutsche Literaturinstitut in Leipzig. Für ihr Werk erhielt die Prosaautorin und Dichterin zahlreiche Auszeichnungen, zuletzt den Drostepreis 2006 sowie den Raika-Lavant- Lyrikpreis 2008. (Foto: Daniel Biskup)