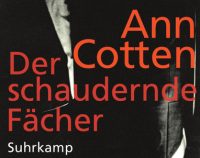Juli Zehs bilderreiche Sprache
Kaum eine andere Autorin ihrer Generation ist so umstritten wie Juli Zeh. Der Zankapfel ist ihre ‘bilderreiche Sprache’. Hymnische Lobpreisungen und hysterische Verrisse wechseln einander ab in der Reaktion auf ihre Romane. Letztlich halten sie einander wohl die Waage. Ihr Augenmerk richten die Rezensenten hauptsächlich auf zweierlei: Spannung und Sprachstil. Ersteres gestehen sie Zehs Romanen uneingeschränkt zu, hinsichtlich des Stils scheiden sich jedoch die Geister. Als “eine ganz ungewöhnlich begabte Schriftstellerin” bezeichnet sie Ulrich Greiner in seiner Rezension zu ihrem zweiten Roman Spieltrieb (2004), der ihn ebenso überzeugt wie Zehs Erstling Adler und Engel (2001): “Es ist erstaunlich, es ist bewundernswert, wie die gerade mal dreißig Jahre alte Schriftstellerin auf sämtlichen Pferden einer durchtrainierten Sprache und eines hoch gebildeten Scharfsinns ihre Geschichte über 500 Seiten durchs Ziel jagt, eine Geschichte, wie sie ungemütlicher nicht sein kann.” ((Ulrich Greiner, “Das Zeitalter der Fische”, Rezension zu Juli Zehs Roman Spieltrieb, erschienen in Die Zeit am 21.10.2004 und auf Zeit Online [Stand: 13.3.2008]. Es lohnt sich, diese Rezension auch wegen Greiners klugen einführenden Bemerkungen zum Thema des Romans, auf das in meinem Aufsatz nicht eingegangen werden kann, zu lesen.)) So ansteckend ist ihre vielthematisierte ‘metaphernreiche Sprache’, dass sich der Rezensent selbst zum bildhaften Ausdruck hinreißen lässt. Seine (völlig kritiklose) ‘Kritik’ imitiert Zehs Kunst — das gilt nicht nur für diesen Kritiker. Auf den Zeh hier attestierten Scharfsinn wird später noch eingegangen, spielt dieser doch gerade beim Ersinnen von Vergleichen und Metaphern eine wichtige Rolle. Was den einen zu recht beeindruckt, ist für andere zu viel des Guten. Dennoch veranlasst es auch Stephan Maus, in dessen Augen Adler und Engel “ein perfekt gebauter, spannungsgeladener Schmöker” ist, der das “obsessive Tertium Comparationis” gar nicht nötig habe, selbst imitativ dem Komparativ zu verfallen: “Wenn das Wörtchen ‘wie’ nicht wäre, würden Adler und Engel abstürzen wie, wie, wie… Ikarus? Verglühende Meteoriten? Beim nächsten Roman sollte die vergleichswütige Juli Zeh die rhetorische Effektpedale vielleicht um ein, zwei Zusatzmodule erweitern.” ((Stephan Maus, “Im Rahmen des Lehrplans”, Rezension zu Juli Zehs Roman Adler und Engel, erschienen in der Frankfurter Rundschau am 8.9.2001 und auf Lyrikkwelt.de [Stand: 13.3.2008].)) So konventionell wie die Vergleiche des Kritikers sind diejenigen von Zeh eben gerade nicht. Und auch nicht so unbedacht gewählt. Maus hat die Auswirkungen des Meteoriten unterschätzt: Denn, abgesehen von dem Leuchten, das er erzeugt, schlägt er mächtig ein und hinterlässt einen tiefen Krater. An Effektpotenzial mangelt es ihm jedenfalls nicht. Während Maus genau genommen gar nicht weniger, sondern noch mehr, aber verschiedenartiges rhetorisches Ornat fordert, hat Zeh nach Meinung von Matthias Rüb jedes Maß überschritten. Die vielgelobten Sprachfertigkeiten der Autorin hält er für begrenzt: “Der Erzählhabitus kommt zwar obercool daher. Doch in Wahrheit ist die von Metaphern geradezu überwucherte Sprache ungelenk bis peinlich.” ((Matthias Rüb, “Verkokste Roadshow”, Rezension zu Juli Zehs Roman Adler und Engel, erschienen in der Frankfurter Allgemeine Zeitung am 09.10.2001 und auf Buecher.de [Stand: 13.3.2008].)) Als Beispiel für einen von zu vielen unoriginellen Vergleichen zitiert er den folgenden: “Von draußen preßt die Nacht ihre glatte schwarze Haut gegen die Fensterscheibe.” ((Die im Folgenden diskutierten Beispiele stammen aus: Adler und Engel, [Frankfurt a.M. 2001] München 2003 (fortan zitiert als Adler); Die Stille ist ein Geräusch, [Frankfurt a.M. 2002] München 2003 (fortan zitiert als Stille); Spieltrieb, [Frankfurt a.M. 2004] München 2006 (fortan zitiert als Spiel).)) (Adler 67) Rübs Kritik weiß sich nicht präziser auszudrücken, als Zehs Stil als “verschärft expressiv” anzuprangern — ein Etikett, das ebenso neutral oder positiv konnotiert sein könnte. Zur Begründung seines überaus positiven Urteils führt der oben zitierte Ulrich Greiner in seiner Rezension mitunter jene Worte aus Spieltrieb an: “Ada zog den Blick aus seinem [Alevs] Gesicht wie ein Messer aus einem Stück Butter, […].” (Spiel 130) Die vielleicht prominenteste Kritik an derart ‘entlegenen Vergleichen’ stammt von Nietzsche: “Wenn die gewagten Vergleichungen nicht Beweise vom Mutwillen des Schriftstellers sind, so sind sie Beweise seiner ermüdeten Phantasie. In jedem Falle aber sind sie Beweise seines schlechten Geschmackes.” ((Friedrich Nietzsche, “Gewagte Vergleichungen”, in: Menschliches, Allzumenschliches. Ein Buch für freie Geister, Bd. II, Zweite Abteilung, Der Wanderer und sein Schatten,139.)) Was ist es, was die Kritiker an den Vergleichen in Zehs Prosa so sehr reizt, sei es zum Lob oder zum Verriss? Zweifelsohne lassen sich Ge- und Missfallen nicht allein durch Maß bzw. Maßlosigkeit in der Verwendung der rhetorischen Figur erklären. Es ist die spezifische Art ihres Vergleichens, oder, offener formuliert, ihres bildlichen Sprechens, die für Aufsehen sorgt. Die beiden bisher zitierten Beispiele geben Sinneswahrnehmungen wieder, das eine Mal wird der Erzählinstanz bewusst, dass es draußen längst Nacht geworden ist, das andere Mal beobachtet sie den Blickkontakt bei einer signifikanten Begegnung zweier Figuren. Einmal wird ein alltäglicher atmosphärischer Zustand personifiziert bzw. anthropomorphisiert und dadurch ein subjektiver Eindruck vermittelt, ein anderes Mal wird ein Handlungsvorgang (das Abwenden eines Blickes), der realiter allenfalls den Bruchteil einer Sekunde dauert, durch die ‘wie’-Konstruktion mit einem anderen alltäglichen, allen vertrauten Vorgang verglichen, den wohl sonst niemand als tertium comparationis gewählt hätte. Obwohl man diesbezüglich wohl gemeinhin von einem ‘entlegenen Vergleich’ sprechen würde, erfüllt er seinen Zweck, dieses Abwenden des Blickes näher zu charakterisieren.
“Am Hang ballen sich Schafe zusammen und sehen aus wie schmutzige Wolken” — Vergleich und Metapher
Die rhetorischen Figuren, die Kritiker in Rezensionen zu Zehs Romanen gleichermaßen häufig und stets undifferenziert als ‘Metaphern’ und ‘Vergleiche’ bezeichnen, verdienen eine genauere Betrachtung — weil sie jene Elemente sind, die für ihren ‘Stil’ verantwortlich gemacht werden. Vergleich und Metapher sind Sprachbilder gleichen Ursprungs, doch keineswegs ein und dasselbe. Ein Vergleich ist das sprachliche Nebeneinander-Stellen oder Verknüpfen zweier mindestens in einem Punkt ähnlicher Elemente aus getrennten Sphären, wobei trotz Unterschieden auch Ähnlichkeiten erkennbar werden sollen. ((Vgl. G. Schenk/A. Krause, “Vergleich”, in: Historisches Wörterbuch der Philosophie, hg. v. Joachim Ritter u.a., Bd. 11, Basel 2001, S. 675–679; Fritz Peter Knapp, “Vergleich”, in:
Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft, S. 755–757, hier 755; sowie Heinrich Lausberg, “simile (§§400–406)”, in: Elemente der literarischen Rhetorik, 10. Aufl. München 1990, S. 132.)) Er besteht aus den verglichenen Elementen (
comparata) und einem Vergleichsbezug, dem tertium comparationis. Verglichen werden Eigenschaften, Zustände, Vorgänge und Handlungen, indem die so genannte ‘Grundvorstellung’ und die ‘Vergleichsvorstellung’ syntaktisch explizit entweder durch Vergleichspartikel (‘wie’ oder ‘als’) oder durch ein Verbum des Scheinens bzw. Gleichens verbunden werden. Um dies mit einem Beispiel von Juli Zeh zu illustrieren: “Im Eingang ruht eine weiße Hundedame mit zwei braunen Flecken im Gesicht, als trüge sie eine große Sonnenbrille aus den sechziger Jahren.” (Stille 204) Der Vergleichsbereich kann, wie hier, mehrere, oft hypothetische Sätze umfassen oder sich auf ein Wort beschränken. Die Grundintention des Vergleichs ist, so schon in der griechischen Grammatik, die Darstellung einer unbekannten Sache mit Hilfe einer bekannten. ((Nach Ciceros
Rhetorica ad Herennium ist der Vergleich “eine Rede, die auf irgendeine Sache von einer anderen etwas Vergleichbares überträgt” (“Similtudo est oratio traducens ad rem quampiam aliquid ex re dispari simile”) IV,45.59.)) Umkompliziert ist die Unterscheidung von Vergleich und Metapher, wenn man letztere als verkürzten Vergleich ansieht, in dem das zu Vergleichende (die Grundvorstellung oder das
verbum proprium) nicht mehr erwähnt, sondern substituiert wird, ((Vgl. Heinrich Lausberg, “metaphora (§§ 228–231)”, in: Elemente der literarischen Rhetorik, 10. Aufl. München 1990, S.78.)) wie hier in Zehs Die Stille ist ein Geräusch: “Das Gebrüll einer Motorsäge schneidet schon seit Stunden meinen Schlaf in Scheiben.” (250) Die Referenz dieser Form der uneigentlichen Rede muss über den Kontext und die Sprecher-Intention erst erschlossen werden. Metaphorischer und explizit komparativer Ausdruck können freilich auch miteinander kombiniert auftreten: “Am Hang ballen sich Schafe zusammen und sehen aus wie schmutzige Wolken.” (
Stille 63) Graduell kann man differenzieren zwischen dem partiellen Vergleich (‘Die wolligen Körper der Schafe glichen schmutzigen Wolken’) und dem totalen Vergleich (‘Die Schafe waren Wolken’) sowie der identifizierenden (‘die Schafe, schmutzige Wolken, …’) und substituierenden Metapher (‘Schmutzige Wolken standen im Hang…’), wobei der Metaphernbegriff meist auf den substituierenden eingeschränkt ist. Das Reallexikon unterscheidet zwischen uneigentlichen, bildhaften Vergleichen wie den oben angeführten und bildlosen Vergleichen, die beispielsweise lauten könnten: ‘Ein Schaf ist wie das andere’ oder ‘die Hündin hat weniger braune Flecken im Gesicht als ihr Welpe’. Besagte Unterscheidung war in der lateinischen Grammatik angelegt durch die Differenzierung des Oberbegriffs
comparabile bzw. simile in die Unterarten collatio (comparatio), exemplum und
imago. Der bildhafte Vergleich verdanke “seine stilistische Funktion gerade der essentiellen Verschiedenheit der nicht aneinandergrenzenden Vorstellungssphären.” ((Fritz Peter Knapp, “Vergleich”, in: Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft, Bd. III, Weimar 2003, S. 755–757, hier 755.)) In Kritiken zu Zehs Romanen wird angesichts der Verwendung von Metaphern und Vergleichen oft von ‘bildhafter Sprache’ gesprochen: Dies ist gängig — schon Aristoteles verwendete den Begriff ‘Bild’ (eikón) für den Vergleich ((Vgl. Aristoteles, Rhetorik, 1406b 20–22; 1407a 14–15; 1410b16. Vgl. auch Hendrik Birus, “Metapher” in Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft, Bd. II, Weimar 2000, S. 572.)) -, aber nicht unproblematisch, wird der Bildbegriff dabei doch selbst metaphorisch verwendet. In der antiken Rhetorik sind die Metapher als eine der Tropen sowie auch der Vergleich als eine der figurae feste Bestandteile des
Ornatus, die allerdings gern in den Dienst der Beweisführung gestellt werden, nämlich als Mittel der amplificatio, also um einem Argument Gewicht zu verleihen. Der Vergleich ist ein logischer Akt und zielt auf Erkenntnis. Für einen gelungenen Vergleich sind Witz und Scharfsinn nötig: um eben nicht comparata aufgrund offensichtlicher Gemeinsamkeiten zu wählen, sondern entfernteste Ähnlichkeiten zu entdecken. Gelungene Vergleiche befördern also nicht nur die Erkenntnis über die comparata, sondern beleben die Einbildungskraft und dienen der Belustigung — mit anderen Worten: sie unterhalten. Von Interesse ist nun, ob es sich bei den Vergleichen und Metaphern in Juli Zehs Romanen um überflüssigen Schmuck handelt, ob sie tatsächlich stilbildend sind und welche Funktion sie in ihrem poetischen Programm erfüllen.
Das Spektrum der Sprachbilder in Zehs Prosa
Zehs “Metaphernergüsse” ((Matthias Rüb, “Verkokste Roadshow”, Rezension zu Juli Zehs Roman
Adler und Engel, erschienen in der Frankfurter Allgemeine Zeitung am 09.10.2001 und
auf Buecher.de [Stand: 13.3.2008].)) lassen sich nicht sinnvoll erfassen und beurteilen, solange man, alle ihre bislang erschienenen Bücher zusammengenommen, rund 2000 Seiten Text überblicken will, woran man zwangsläufig scheitert. Es lohnt deshalb, die Vielfalt versuchsweise zu ordnen: nach dem jeweiligen ‘Gegenstand’ (Mensch — Landschaft und Naturphänomene — Abstrakta), zu dessen Charakterisierung jeweils ein Vergleich gesucht wird; nach dem Vergleichsbereich und schließlich nach Art und Funktion des Vergleichs. An repräsentativen Beispielen mangelt es nicht. Eine falsche Vorstellung bekäme man allerdings von Zehs Romanen — dies muss vorab gesagt sein -, wenn man sich die Vergleiche so dicht aneinandergereiht vorstellt, wie hier präsentiert. Tatsächlich sind sie luftiger in den Text eingewebt. Meine Collage vermittelt einen verzerrten Eindruck der Texte, da ich die einzelnen Bilder aus ihrem Kontext herauslöse und Bezüge zu anderen herstelle, um ihre Spezifik ebenso wie ihre unsichtbare Vernetzung zu zeigen.
Merkwürdige Menschen, filigrane Figuren
Partielle oder totale Vergleiche, die mit einem einzelnen Wort auskommen und auf einen naheliegenden Vergleichsbereich zurückgreifen, sind Juli Zeh zu simpel — soviel sei vorweggenommen. Beginnen wir mit partiellen Vergleichen, die einzelne physische und psychische Eigenschaften sowie Handlungen der Protagonisten beschreiben und damit im Dienst der Figurencharakterisierung stehen. Der erste Satz des Romans
Adler und Engel lautet programmatisch: “Sogar durch das Holz der Tür erkenne ich ihre Stimme, diesen halb eingeschnappten Tonfall, der immer klingt, als hätte man ihr gerade einen Herzenswunsch abgeschlagen.” (
Adler 9) Nun wissen wir genau, wie man sich ihren Tonfall vorstellen muss. Anstatt ihn mit einem gängigen Adjektiv wie ‘beleidigt’ oder ‘enttäuscht’ zu kennzeichnen, wird eine bekannte Situation suggeriert. Wie hier die Stimme, so wird an anderer Stelle die zunehmende Sprachlosigkeit einer Figur aus der Perspektive einer anderen wahrgenommen: “Seit Wochen tropften die Wörter nur noch einzeln aus ihr heraus, und Smutek stand vor diesem Schauspiel wie einer, der duschen will und den Rohrbruch im Keller noch nicht bemerkt hat.” (
Spiel 299) Auch diese Situation können wir uns bestens vorstellen. Dennoch würde kaum einer denselben Vergleich wählen; der Vergleichsbereich ist vertraut und wirkt trotzdem entlegen. Zwei weitere Beispiele funktionieren auf ähnliche Weise. Auch sie beschreiben partiell die Protagonisten. Max wurde am Telefon Zeuge des Selbstmords seiner (ehemaligen) Freundin: Er musste mitanhören, wie sich diese eine Kugel in den Kopf jagte. Abgesehen von einem Trauma hat er einen Trommelfellriss: “[…] meine linke Hand presste ich gegen das linke Ohr, von dem ich wusste, dass darin die Fetzen meines geplatzten Trommelfells herumflatterten wie Vorhänge an einem offenen Fenster.” (
Adler 13) Kann man die Verletzung noch anschaulicher beschreiben und gleichzeitig die Abgebrühtheit des Sprechers demonstrieren? Er nähert sich dem vor Erschöpfung kranken Mädchen (seiner zukünftigen Freundin): “Ich muss mein […] Ohr vor ihre Lippen halten, um sie zu verstehen. Dabei steigt mir ihr Atem in die Nase, er riecht wie das Blumenwasser in einer Vase, aus der man gerade die schleimigen Stengel eines drei Wochen alten Straußes gezogen hat.” (
Adler 280) Diesmal kein entlegener Vergleich, doch hätten ihn die meisten Autoren wohl auf zwei Wörter (‘[er riecht wie]
abgestandenes Blumenwasser’) beschränkt und damit üblicher Redekonvention entsprochen. Juli Zeh aber wählt die ausführlichere, konkretere Vorgangsbeschreibung, die eine größere Wirkung auf das Nachempfinden des Lesers hat, zumal sie an der Ästhetik des Ekels partizipiert. Zwei andere partielle Vergleiche, die den Körper des Mädchens bzw. ein physisches Phänomen beschreiben, verlassen den alltäglichen situativen Rahmen. So lautet die Selbstbeobachtung des Mädchens: “Mir fällt plötzlich auf, wie stark ich abgenommen habe, meine Rippen werfen Schatten wie Bergkämme kurz vor Sonnenuntergang, mein Bauch ist konkav, die Knie wie eine Ansammlung von Kieselsteinen, die Waden Kabelstränge.” (
Adler 184) Auch diese Kette von partiellen Vergleichen involviert bekannte Elemente, ausgewählt aufgrund ihrer optischen Ähnlichkeit zum Verglichenen, doch sind die Zuordnung der
comparata und die Reihung ungewöhnlich. Die menschlichen Formen eines einzigen Körpers werden zunächst mit einem Naturphänomen, dann mit anorganischem sowie schließlich mit künstlichem Material korreliert. Aufgrund der Vermischung heterogener Vergleichsbereiche wirkt das Ensemble merkwürdig inkohärent — ein Effekt, der nicht thematisiert, aber vermutlich beabsichtigt ist, sieht man ihn im Kontext von Vergleichen, die von einem instabilen Subjektverständnis zeugen. Wiederum auf andere Weise ungewöhnlich ist eine Beschreibung des Mädchens, als es Nasenbluten hat: “Das Taschentuch hing ihr aus der Nase und sah aus wie der ausgerissene Flügel einer weißen Taube. Wenn sie nickte, war es, als winkte sie mir damit zu.” (
Adler 314) Eher selten sieht man im Alltag einen ausgerissenen Flügel einer weißen Taube. Die Erzählerfigur verfügt offenbar über große visuelle Imaginationskraft, zumal sie das Bild dynamisiert und dem Mädchen dadurch eine bestimmte Motivation unterstellt. Die Absurdität des Bildes mag spontan Mitleid bewirken oder ein Lächeln auslösen. Wer diesen Vergleich nicht ‘schief’ findet, nennt ihn vielleicht ‘poetisch’. Jedenfalls handelt es sich um einen höchst subjektiven Eindruck. Vom Wissen um die Wirkungskraft ihrer Bilder zeugt die Tatsache, dass Zeh ihre originellen Vergleiche gezielt platziert, so am Ende eines Kapitels, das mit dem Ende eines Tages zusammenfällt: “Ihr heller Kopf lag eingesunken in den Kissen wie ein großes Straußen-Ei in seinem Nest.” (
Spiel 373) Oder, ebenso strategisch platziert, zu Beginn eines Kapitels, wo eine Gruppe von Menschen in allzu bekannter Situation mit Tieren verglichen wird: “Am Ende der zweiwöchigen Osterpause tauchten alle Beteiligten in den Schulalltag wie Fische, die man in letzter Sekunde vom Land ins Wasser zurückgeworfen hat.” (
Spiel 416)
Gesichter — glanzlos, grinsend und greise
Besonders augenfällig sind die Beschreibungen von Gesichtern und damit auch von Mimik in Zehs Romanen. Claras Gesicht “ist nicht glatt und unschuldig, sondern verbraucht und schlecht aufgehängt zwischen den Ohren.” (
Adler 322) Max schildert das Mädchen folgendermaßen: “Sie schiebt ihr Gesicht vor mir her, ihre Augen sind merkwürdig, ohne bestimmte Blickrichtung, wie hellblaue Milchglasscherben. Möglicherweise hat sie dahinter den Blick abgewendet und schaut durch die Ohren heraus, in eine ganz andere Richtung.” (
Adler 166) Die Erzählinstanz muss uns nicht explizit mitteilen, dass dieses und andere Gesichter ausdruckslos, unbeteiligt und maskenhaft wirken. Die Besonderheit der Schilderung liegt nicht darin, dass die Leblosigkeit des Blicks durch die Assoziation mit Milchglas suggeriert wird. Es ist der Folgesatz, der die Eigenheit der Vorstellungskraft Zehs offenbart: Sie gesteht dem einzelnen Ding besondere Flexibilität und Autonomie zu, indem sie den Oberflächeneindruck hinterfragt und dahinter verspielt ein Eigenleben vermutet. An anderer Stelle wird die Erzählerin — um es mit ihrer Metaphorik zu beschreiben — von einem Grinsen angefallen, das sich nicht vertreiben lässt: “Ich spüre, wie sich meine Miene auseinander zieht, es fühlt sich an, als würde mir eine dünne Schicht flüssigen, schnell erstarrenden Wachses übers Gesicht gegossen. Das Grinsen kriege ich nicht mehr weg, es ist wie eingemeißelt. Genau so verlasse ich das Wohnzimmer und versuche, mein Grinsen von mir fern zu halten wie man einen stinkenden Lappen am ausgestreckten Arm vor sich her trägt. Es grinst auf meinem Gesicht, ich habe nichts damit zu tun.” (
Adler 164) Hier wird die Verselbständigung der Mimik und die bemühte Distanzierung des Menschen davon überdeutlich gemacht durch drei aneinandergeknüpfte Vergleiche, die jeweils verschiedene Bilder anbieten, um den einen Grundgedanken zu vermitteln. Einen ebenso freudigen Gesichtsausdruck eines alten Mannes kommentiert sie schließlich wie folgt: “In seinem Gesicht fließt das Lächeln in dafür vorgesehene Bahnen und muss sich nicht wie im Gesicht junger Menschen einen immer neuen Weg bahnen.” (
Adler 260) Wie die anderen scheint diese Beschreibungen nur die Oberfläche zu fokussieren, hat aber Tiefgang, impliziert sie doch unaufdringlich viel mehr, nämlich dass der Alte im Gegensatz zum Jungen weiß, worüber er lachen kann und worüber nicht: Er lässt sich nicht mehr überraschen und verunsichern, sein Lachen ist ein sicheres, angewöhntes. Um den Protagonisten aus
Adler und Engel in seiner Totalität zu beschreiben, heißt es: “Er ist ein komischer Typ, wie falsch zusammengesetzt aus Puzzleteilen, die jemand ungeduldig ineinander verhakt und gepresst hat, bis das letzte Stück verbraucht war, ohne darauf zu achten, wohin sie eigentlich gehören.” (
Adler 425) Prinzipielle Zweifel daran, dass jede Person bzw. Romanfigur ohne Weiteres charakterisierbar ist, gehen aus einer Äußerung über Jessie hervor: “Man konnte sie nicht kennen, wie man andere Menschen kennt oder […] einen Hund. Höchstens so, wie man einen Schwarm Fische kennen kann.” (
Adler 433) Ein solches Menschenbild beinhaltet zwangsläufig eine gewisse Skepsis gegenüber simplen, eindimensionalen Vergleichen. Außerdem prägt es die Figurencharakterisierung auf eine Weise, die nur ein weiterer Aufsatz erörtern könnte. Hier sei lediglich festgehalten, dass die Figuren vor allem in ihrer Wirkung auf andere, das heißt, aus Figurenperspektive beschrieben werden. So berichtet der Protagonist Max angesichts der überwältigenden Präsenz des Mädchens: “Ganze Flutwellen von Energie gehen in konzentrischen Kreisen von Hund und Mädchen aus, ich fühle mich wie ein Weinkorken, der schaukelnd an die Peripherie getrieben wird.” (
Adler 225) Eine Herausforderung an den Leser sind solche ‘Bilder’ auch deshalb, weil sie unvollständig sind: Nirgends steht, ob man sich ein volles Weinglas mit Korken oder einen Kübel vorstellen soll, auf dessen Flüssigkeitsspiegel ein Korken treibt — allein die zentrifugale Bewegung zählt. Häufig vergleicht Zeh den Menschen mit unbelebten Gegenständen oder Alltagsphänomenen. Ihre Vergleiche mögen entlegen wirken, sind sie es aber wirklich? Zeigen sie uns nicht vielmehr die Nähe einer scheinbar fremden Sache zum Vertrauten? Zeh macht damit auf ein Alltagsdetail aufmerksam, dem wir zuvor kaum Aufmerksamkeit geschenkt haben. Den ‘Bildern des Menschen’ könnte man hier noch Vergleiche, die schwer beschreibbare Gefühle und Seinszustände der Figuren näher bringen sollen, hinzufügen; sie finden jedoch erst später im Rahmen der ‘Abstrakta’ Erwähnung.
Anthropomorphisierte Stadt- und Natur-Landschaften
Im Anschluss an die vorwiegend aus Adler und Engel entnommenen Bilder des Menschen soll nun dessen Lebensraum betrachtet werden. Stadt- und Natur-Landschaften mitsamt allen ihren (an-)organischen Elementen bilden den zweiten großen Bereich, für den Zeh Vergleiche und Metaphern ersinnt. Besonders dicht gedrängt findet man sie in der Beschreibung ihrer Reise durch Bosnien mit dem Titel Die Stille ist ein Geräusch. “Wie ein Nadelkissen sieht die Stadt aus mit ihren vielen Minaretten” (Stille 238) — so lautet ein erster totaler Vergleich einer muslimisch geprägten Stadt mit einem unbelebten Alltagsgegenstand. Er gehört zu jenen auf optischer Assoziation beruhenden Vergleichen, welche die Lokalisierung des Sprechers — nämlich in einiger Entfernung, noch außerhalb der Stadt — und damit die Rekonstruktion der Perspektive erlauben. Über eine andere Stadt heißt es aus ähnlicher Perspektive: “Ka?tel kniet im Wasser, mittelalterliche schmale Häuser drücken Wange an Wange, mit dem Rücken an die Festungsmauer gelehnt.” (
Stille 200) Derart beschaulich bleibt es jedoch nie länger als wenige Zeilen. Zerstört wird das Mittelalterflair durch diverse Nahaufnahmen: “Stromleitungen steigen hochbeinig über alles hinweg.” (
Stille 37) Sobald die Reisende in der Stadt ankommt, erkennt sie: “Das Parlamentshochhaus, im Stehen gestorben, von allen Seiten in Fetzen geschossen, es zeigt seine zerfledderten Innereien. Ich scheue mich hinzusehen, man starrt auch einen Behinderten nicht an.” (
Stille 59) ((Zur Erinnerung: Inkohärenzen in der Zusammenschau dieser Stadtbeschreibungen erklären sich dadurch, dass hier Ausschnitte aus Beschreibungen diverser Städte zusammengefügt wurden, um die Bilder zu vergleichen.)) Die Personifikation und damit die Anthropomorphisierung von Stadt und Landschaft ist Zehs meistverwendetes Stilmittel, das einem impliziten Vergleich entspricht. In der Regel ‘vermenschlicht’ bzw. animiert sie einzelne Elemente stillschweigend; so explizit wie im zuletzt zitierten Satz wird sie selten. Alternativ zum Vergleich des Anorganischen mit dem Menschen finden sich auch Assoziationen mit Tieren, diesmal in
Spieltrieb: “Fettleibig kauerte der Altbau samt Seitenflügeln auf der dunklen Asphaltfläche und sah aus wie ein Albatros, der sich vor dem Abheben zusammengeduckt hat und dabei eingeschlafen ist.” (
Spiel 54) Auffällig ist, dass der Mensch in der anthropomorphisierten Stadtlandschaft — insbesondere im fremden Land Bosnien — seine Autorität und Willensfreiheit verliert: “Eine kopfsteingepflasterte Straße führt selbstbewusst den Berg hinauf, ich folge willenlos.” (
Stille 234) Daher lautet das Fazit der Reisenden: “Ich fühle mich, als wäre das Land durch mich gereist und kehrte nach Hause zurück, während ich übrigbleibe, mit hängenden Armen. Bereist.” (
Stille 263) Hier dienen Ihr die Vergleiche also zur Vermittlung von schwer beschreibbaren Gefühlen. Ähnlich wie die Stadt, werden auch Naturlandschaften und ‑phänomene zum Zweck genauerer Charakterisierung personifiziert bzw. anthropomorphisiert, hier zum Beispiel allein durch die Wahl der Verben: “Schnell fällt die Dunkelheit, die Bäume rücken zusammen, eilig robben die Wolken über den schwarzen Himmel Richtung Norden.” Um das Hereinbrechen der Nacht mimetisch zu vermitteln, erfährt die Beschreibung eine Beschleunigung. Ein Wechsel der Perspektive weckt stets neue, originelle Assoziationen im Betrachter: “Die alten Bäume ragen hoch auf und sehen in ihrer Schwärze aus wie die dicken Beine einer Elephantenherde, deren Bauchunterseiten den Nachthimmel bilden.” (
Adler 42) Dieses Bild assoziiert man mit dem typischen Kinderblick, zumal die Bäume bzw. Elefantenbeine aus der Zwergenperspektive betrachtet werden. Unter all den auf optischen Eindrücken basierenden Vergleichen sind solche, die sich auf akustische Wahrnehmungen beziehen, in der Minderheit. Einer sei dennoch wiedergegeben: Der heftige Donner klingt “als wäre der ganze Himmel aus Holz und würde von einer riesigen Axt getroffen.” (
Adler 107) Um die Isotopie des nächtlichen Waldes abzuschließen, sei ein letztes Zitat angeführt, das den Vergleich von Baum und Mensch wieder nur impliziert, anstatt ihn syntaktisch auszuführen, aber viel Einblick in die gewollt kindlich-naive Vorstellungswelt der Autorin gibt: “Falls der Wald sich zum Schlafen hinlegt, ist er jedenfalls als erstes wieder auf den Beinen und steht im oberen Drittel der Berghänge stramm.” (
Stille 74) Auch die Jahreszeiten und ihr jeweils spezifisches Wetter macht Zeh durch Vergleiche und Metaphern lebendig. Nachdem die Reisende aus dem Norden nach ihrer ersten Nacht in Mostar erwacht ist, tritt sie vors Hotel auf die Straße: “Die Hitze wartet vor der Tür, als hätte sie die ganze Nacht dort gesessen. Sie beißt mich mit spitzen Zähnen, und das so früh am Tage.” (
Stille 51) Effektiv wird die durch den Klimawechsel verstärkte Empfindung vermittelt — wer kennt es nicht, das Gefühl, gegen eine Wand aus warmer Luft zu laufen, wie es der erste Satz suggeriert? Konventionell wäre es gewesen, von eben dieser Wand zu sprechen. Zehs Schilderung ist verspielter und zugleich präziser. Dass sie die
comparata wohlüberlegt wählt, zeigt die Gegenüberstellung mit einer anderen metaphorischen Beschreibung: “Die Sonne brüllte wie ein zahnloser Tiger vom Himmel, schoss Licht ohne Wärme in die Straßen der Stadt, blendete wintertrübe Augen, holte Staub und zerknüllte Taschentücher unter den Heizkörpern hervor, verhöhnte die Nacktheit kahler Bäume und Büsche, entdeckte Fettfingerspuren auf Windschutzscheiben und bewarf die Fenster der oberen Stockwerke mit explodierenden Blitzen.” (
Spiel 359) Hier geht es um andere Temperaturen, statt spitzzähnig ist diese Sonne zahnlos, dafür ihr Licht aber umso gnadenloser: Statt der spürbaren Sommerhitze wird die Wintersonne geschildert, und zwar als dominant visuell wahrgenommenes Phänomen. Der Blick schweift vom Innenraum durchs Fenster nach Draußen und informiert
en passant über die Umgebung, während es in jener Passage doch eigentlich nur um die Wetterlage geht. Ist dieses Surplus an
comparata als manieristische Überwucherung zu kritisieren oder als Anschaulichkeit im besten Sinne zu loben? Im Kontrast zur gleißenden Sonne, die ‘entdeckt’, zeitigt heftiger Niederschlag andere Wirkung: “Der Regen lässt den Menschen Buckel wachsen und nimmt ihnen die Hälse. Es wird ruckartig dunkler und dunkler, als würde die Sonne in Stößen sinken.” (
Adler 438) Wie beim vorherigen Beispiel wird auch hier auf jegliche Erklärung der Situation verzichtet, weil sie als bekannt vorausgesetzt wird. Dennoch wirkt der beschriebene Eindruck subjektiv, was noch mehr für die Äußerung einer Figur nach Ende des Regens gilt: “Es hat geregnet, sagte Jessie am Telephon, und die Nacktschnecken liegen hier überall im Hof verteilt, wie herausgeschnittene Zungen.” (
Adler 192) Schließen wir die Jahreszeiten-Bilder mit einem Vergleich, den so mancher Kritiker vielleicht nicht nur als entlegen, sondern als ‘schief’ bezeichnen würde: “Es war Anfang Oktober, der Sommer hatte seine glühende Umklammerung gelöst, war abgefallen von der Stadt wie eine vollgesogene Zecke und langsam über den Horizont gen Süden davongekrochen.” (Spiel 156) Im Anschluss an Wetter und Jahreszeiten würde es sich anbieten, im Sinne einer zunehmenden Ausweitung des Gegenstands vom Menschen über seine Umgebung bis zur Atmosphäre, nun Zehs Beschreibungen der Himmelskörper zu fokussieren. Dies geschieht jedoch erst im Zusammenhang mit der abschließenden Frage, inwiefern Zehs Bilder ‘kitschig’ wirken. Stattdessen betrachten wir den schwierigsten Gegenstandsbereich, das Abstrakte, das Zeh mithilfe ihrer Vergleiche auf einzigartige Weise konkretisiert.
Abstraktes wird konkret
Immer wieder reflektiert die Protagonistin in Adler und Engel das Phänomen Zeit, genauer das menschliche, bisweilen ihr individuelles Zeitempfinden. Einen der wenigen Orte, mit dem sie ein angenehmes Lebensgefühl verbindet, charakterisiert sie wie folgt: “Dort vergehen die Stunden spurlos, man fühlt sich in der Zeit wie ein Körper, der in exakt körpertemperaturwarmes Wasser eingelegt ist.” (Adler 273) Die Worte evozieren das Gefühl von Zeitenthobenheit. Das gegenteilige, ebenso schwer beschreibbare Unwohlsein kommuniziert die Figur dementsprechend so: “Die Zeit ist manchmal wie ein zu enges Kleidungsstück, ich kann mich schlecht in ihr bewegen.” (Adler 434) Lässt ihr hier die Zeit, mit anderen Worten, zu wenig Raum, ist dort wiederum das Gegenteil der Fall. Die Welt scheint beinahe zum Stillstand zu kommen “[…] während ich in der Hängematte liege und durch bloße Willenskraft dafür sorge, dass die Zeit nicht stehen bleibt, dass eine Sekunde schwerfällig die nächste über die Kante schubst und der Tag Schrittchen für Schrittchen nach Westen davonkriecht.” (Adler 225) Auf anschauliche Weise sieht sie der Zeit beim langsamen Verrinnen zu. Ein Stilpurist würde vielleicht die Nase rümpfen, weil sie dabei zwei Bilder miteinander kombiniert und zu einem verschmilzt. Anders geht sie beim Versuch vor, des Gefühl der Schläfrigkeit und den Schlaf zu beschreiben und voneinander abzugrenzen: “Schläfrigkeit ist ein Geruch, nach dem eigenen Scheitel, ganz leicht nach Hausstaub und erhitzten Glühbirnen, nach Dunkelheit, Buchseiten und Rauhfasertapete. […] Der Schlaf hingegen ist eine Farbe, schwarzrandig, aber nicht schwarz, in die wir hinter geschlossenen Lidern starren, nachdem die Augen umgekippt sind, um die Kopf von innen zu betrachten.” (Spiel 329) Dank ihrer definitorischen Qualität ist diese Konkretisierung des Abstrakten isolierbar wie ein Aphorismus.
Synthese und Multiperspektive
Die bisher vorgestellten Vergleiche genügen längst für ein Resümee ihrer wesentlichen Merkmale. Prinzipiell findet Zeh für alles Vergleiche und zieht alles zum Vergleich heran. Isoliert man Zehs ‘sprachliche Bilder’ aus dem Textgewebe, so hält man jedoch einige rote Fäden in der Hand, die über die Grenzen der einzelnen Romane hinweg als unsichtbare Isotopien zusammen hängen. Besonders häufig sucht sie nach Vergleichen für die physischen Eigenschaften ihrer Figuren und deren Gefühlslagen sowie für den städtischen oder landschaftlichen Lebensraum des Menschen mitsamt sämtlichen Naturphänomenen. All dies charakterisiert sie sodann entweder durch eine wenige Worte umfassende Skizze einer aus dem Alltag bekannten Situation oder durch Assoziation mit dem jeweils Anderen, das heißt, sie vergleicht den Mensch mit dem Unbelebten und animiert und personifiziert dieses wiederum. Auffällig ist, dass ihre Vergleiche, die oft in einem gezielt naiven Hinterfragen der bekannten Oberflächenstrukturen gründen, jedem Gegenstand Autonomie zugestehen, ja oft verspielt dessen Verselbständigung vorführen. Bisweilen scheinen sich nicht nur die Gegenstände, sondern auch die Vergleiche zu verselbständigen, wenn nämlich eine Beobachtung mit mehreren Bildern assoziiert wird bzw. jede Assoziation weitere hervorruft, was der Vorstellungskraft und Synthesefähigkeit des Lesers große Flexibilität abverlangt. Der Gewinn ist ein erfrischender Perspektivenwechsel, oft sogar eine Multiperspektive, auf den Gegenstand. Zeh vermag Mensch und Natur zu beschreiben, als hätte sie schon alles gesehen und trotzdem nicht verlernt, sich zu wundern. Selbst schwer beschreibbare Gefühls- und Seinszustände übersetzt sie in anschauliche Bilder. Die Beobachtung, dass sie dabei die visuelle Wahrnehmung insgesamt eindeutig privilegiert, verdient eine genauere Betrachtung.
Der Vergleich als Seh-Hilfe und Imaginations-Krücke
In zahlreichen Vergleichen Zehs wird das Sehen als diejenige Wahrnehmung, die Assoziationen auslöst, diskret thematisiert. In einigen steht es sogar im Mittelpunkt, nämlich wenn die Art und Weise des Betrachtens beschrieben wird, so nicht nur an der bereits zitierten Stelle (“Ada zog den Blick aus seinem Gesicht wie ein Messer aus einem Stück Butter.” Spiel 130) Im selben Kontext heißt es einige Zeilen später, als sie ihn im Gespräch erneut ansieht: “Als sie den Kopf wieder senkte, blieb ihr Blick an Olafs Stirn hängen wie ein altes, schlecht haftendes Stück Klebeband.” (Spiel 131) Das Sehen wird als bewusste Aktion vorgeführt, so auch hier, diesmal in freier Natur: “Sie gibt ihrem Blick Auslauf über die Felder, auf denen Sonnenblumen ihre schwarz gewordenen Köpfe der Erde zuwenden, als würden sie wie alte Menschen gebeugt den Boden betrachten, unter dem sie bald zu liegen kommen werden. (Adler 335) Jeder Betrachtung liegt der Wunsch nach Erkenntnis zugrunde, impliziert diese metareflexive Passage, die den Vorgang des Vergleichens nachvollziehbar macht. Überdies ist es auch die Betrachtung, welche die Vorstellungskraft erst in Gang bringt, wie im folgenden Satz deutlich wird, dessen Kontext mühelos imaginiert werden kann: “Ich starre in meinen Kaffeebecher, als könnte es sich bei dem glatten schwarzen Flüssigkeitsspiegel um ein Fluchtloch handeln, durch das ich wegtauchen kann.” (Adler 182) Juli Zeh ist ein Augenmensch, ihre Vergleiche und Metaphern sind ‘Seh-Hilfen’, ‘Imaginations-Krücken’ und ‘Bildanweisungen’. In ihrem Buch über Bosnien reflektiert sie selbst ihr Beobachten und ihr Memorieren von Momentaufnahmen, das Voraussetzung für die Entstehung ihrer Texte ist: “Manchmal bilden Kopf und Augen zusammen eine Kamera, und man kann sicher sein, die aufgenommenen Bilder nicht zu vergessen.” (Stille 256) Eine ihrer Figuren erklärt ihr poetisches Programm: “die Wahrheit liegt immer an der Oberfläche.” (Stille 236) Eben diese Fokussierung der Oberfläche kritisiert der kosovo-albanische Schriftsteller Beque Cufai in seiner Rezension zum selben Buch, indem er konstatiert, Zeh habe ihr Buch mit schneller Hand geschrieben und alles, was ihr vor die Augen gekommen sei, sofort festgehalten, ohne dabei die Ursachen zu benennen: “Sie sieht nur, was sie sieht.” ((Beque Cufai, “Nicht ohne meinen Hund”, Rezension zu Juli Zehs Die Stille ist ein Geräusch, aus dem Albanischen von Joachim Röhm, erschienen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung am 14.09.2002 und auf Buecher.de [Stand: 13.3.2008].)) Je nach Betonung des Satzes stecken darin zwei Vorwürfe, zum einen, dass sie nur das Sichtbare zur Kenntnis nehme, zum anderen, dass ihre Perspektive sehr subjektiv sei. ((Matthias Rüb formuliert diesbezüglich eine interessante, wenngleich meines Erachtens auf Juli Zeh nicht zutreffende These: “Der Roman ‘Adler und Engel’ ist, mit einem Wort, spießig. Ein Spießer ist jemand, der die Welt in ihren vielfältigen Ausgestaltungen immer nur auf sich selbst bezieht und jede Wahrnehmung in die engen Grenzen seines beschränkten Horizontes zwängt.” In: “Verkokste Roadshow”, Rezension zu Juli Zehs Roman Adler und Engel, erschienen in der Frankfurter Allgemeine Zeitung am 09.10.2001 und auf Buecher.de [Stand: 13.3.2008].)) In der Tat erhebt Zeh Anspruch auf eine subjektive Wahrnehmung und eine individuelle Ausdrucksweise. Explizit tut sie dies im besagten Bosnien-Buch mit einer nebenbei geäußerten Bemerkung, die man als Rechtfertigung ihrer speziellen ‘Bilder’ verstehen kann: “Wäre ich Photograph geworden, brächte ich den Menschen genau jene Bilder mit, die sie erwarten.” (Stille 238) Als Schriftsteller hingegen fühlt sie sich nicht verpflichtet, dies zu tun. Wie also wirken ihre Bilder? Auch diesbezüglich ist die Meinung der Feuilleton-Kritiker gespalten, ihre Urteile lauten “poetisch” vs. “kitschig”.
Kunst oder Kitsch?
Adler und Engel besitze, so der Kritiker Maus, “den wichtigtuerischen Gestus einer Prosa, die […] eigentlich als Poesie begriffen werden möchte. […] Die schnell voranschreitende Handlung umspült lyrische Inseln, die Zeh mit ihrem bilderreichen Stil in den Erzählstrom setzt. […] Trotz aller lyrischen Qualität poetelt es manchmal gar sehr in der Bilderwelt des Ich-Erzählers Max. Etwas zu oft greift er nach den Sternen, dem Mond und der Sonne, wodurch sich der Text zu astrologischer Dimension bläht, die ihn geradewegs in die verheerende Umlaufbahn des Kitschplaneten katapultiert.” ((Stephan Maus, “Im Rahmen des Lehrplans”, Rezension zu Juli Zehs Roman Adler und Engel, erschienen in der Frankfurter Rundschau am 8.9.2001 und
auf Lyrikwelt.de [Stand: 13.3.2008]. Im scharfen Gegensatz zu Maus hält Ilma Rakusa Zehs bildhafte Sprache für äußerst “poetisch”. Sie konstatiert: “Juli Zeh weiß, was Poesie ohne Pathos ist”. Es gelinge ihr, das “entzauberte Bosnien momentweise in einen prekären Zustand poetischer Gnade überzuführen”. Ilma Rakusa in ihrer Rezension zu Juli Zehs Die Stille ist ein Geräusch, erschienen in der Neuen Zürcher Zeitung am 17.09.2002.)) (Am Rande bemerkt: Auch in dieser Äußerung versucht der Kritiker offenkundig, mit Zehs Metaphorik zu konkurrieren.) Überprüft man diese provokative Behauptung, so findet man folgende Vergleiche: Der Mond “steht blass und schmal wie ein abgeschnittener Daumennagel am Himmel.” (Adler 42) und, nach weiteren 350 Seiten, in denen genug Zeit verstrichen ist, um ihn ein anderes Aussehen annehmen zu lassen: “Der Mond steht wie eine halbe Zitronenscheibe im dunklen Himmel und die Sterne funkeln dazu wie Kohlensäureblasen in einer Cola.” (Adler 375) Beide Vergleiche sind ungewöhnlich und vielleicht entlegen, daher jedoch nicht kitschig, versteht man darunter ein unoriginelles, sentimentales Klischee, oder anders: den misslungenen Versuch, das Schöne zu beschreiben. Natur, Landschaft und Gestirne sind bekanntlich beliebte Gegenstände von Poesie. Zehs Blick zum Himmel strebt jedoch weniger nach Verklärung als nach Entzauberung. So konstatiert sie trocken bei einer Übernachtung im Freien: “Die Sterne vermehren sich schnell wie eine Bakterienkultur.” (Stille 191) Besonders anschaulich wird die Desillusionierung der Betrachterin, als ihr Blick im Rahmen der Beschreibung eines Friedhofes auf die Grasfläche zwischen den Gräbern fällt: “Dabei sehe ich, dass auf quadratmetergroßen Wiesenstücken jeder einzelne Halm dicht mit kalkweißen, erbsengroßen Schneckenhäusern besetzt ist, als hätte jemand versucht, das ganze Land mit Perlen zu besticken, und hier damit begonnen. An manchen Stellen klumpen sie wie Froschlaich zusammen. Nicht eine Schnecke lebt. Mir wird schwindlig […]” (Stille 182) Zeh entdeckt etwas Schönes, doch der Versuch, in dessen Oberflächenbetrachtung das Gute zu erkennen, endet mit Enttäuschung, die zur Gewohnheit wird. Sie selbst erklärt, dass sie “im Schönen immer Hässliches argwöhne und aus Trotz im Hässlichen das Schöne suchen” müsse (Stille 228). Dies tut sie allerdings nicht verzweifelt: Im Zusammenspiel mit ihrem Scharfsinn unterläuft ihr ungerührter Blick jegliche Tendenz zum Kitsch. Poetisch sind viele ihrer Metaphern und Vergleiche trotzdem. Sie sind Teil deskriptiver Passagen bzw. sind selbst verkürzte Beschreibungen. Die Beschreibung, als “die Kunst, […] mit Worten einen bildlichen Eindruck beim Zuhörer bzw. Leser hervorzurufen,” ((Albert Halsall, “Beschreibung”, übers. v. Lisa Gondos, in: Gert Ueding (Hg.), Historisches Wörterbuch der Rhetorik, Bd. 1, Tübingen 1992, S. 1495–1510, hier S. 1495.)) besitzt durch ihre große Evokationskraft prinzipiell poetisches Potenzial. Die durch Zehs Beschreibungen im Leser ausgelösten Vorstellungen sind dominant visuell, mitunter aber auch artikulatorisch, akustisch und bisweilen sogar synästhetisch. Zwar verlangsamen oder arretieren die zeitenthoben- kontemplativen deskriptiven Passagen zwangsläufig den narrativ-sukzessiven Handlungsfortgang, doch bereichern sie ihn dafür durch eine Anschaulichkeit, welche die Gesamtwirkung stark steigert. Zehs Metaphern und Vergleiche sind zwar auch, aber nicht nur Redeschmuck, denn ihre Veranschaulichung hat kognitive Funktion: Trotz ihrer komprimierten Form geben sie Einblicke in komplexe, längst nicht auf den ersten Blick erkennbare Analogieverhältnisse. Zehs Hauptmotivation ist jedoch nicht die Belehrung, sondern eine Lust an Assoziation und Korrelation, eine Freude an Vergleich und uneigentlicher Rede, wie sie Hegel in seiner Ästhetik einleuchtend erklärt: als “das Bedürfnis und die Macht des Geistes und Gemüths […], die sich nicht mit dem Einfachen, Gewohnten, Schlichten befriedigen, sondern sich darüber stellen, um zu Anderem fortzugehen, bei Verschiedenem zu verweilen und Zweifaches in Eins zu fügen”. Als Gründe hierfür nennt er mehrere, nämlich die “Verstärkung” der Vorstellungen, die “Erhebung” über alles Äußerliche, die “schwelgerische Lust der Phantasie” und den “Witz der subjektiven Willkür”. ((Georg Wilhelm Friedrich Hegel, “Metapher, Bild, Gleichnis”, in: ders. Vorlesungen über die Ästhetik, hg. v. Friedrich Bassenge, 2 Bde., Berlin/Weimar 1965, 1, 390–395. Vgl. die Zusammenfassung der längeren Passage aus Hegels Ästhetik von Hendrik Birus (“Metapher”, Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft, Bd. II, Weimar 2000, S. 574.))) Ihre Lust an der Assoziation, an der Ausweitung und Variation von Komparativen und Metaphern reflektiert Zeh schließlich selbst in einem Denkmuster und Poesis offenbarenden Vergleich: “Die Schuppentür klingt wie ein ganzer Frühlingswald voller Vögel. Drei Wochen hat niemand sie in den Angeln bewegt, jetzt mache ich sie nur zum Spaß ein paar Mal auf und zu und lausche dem Gezwitscher, wobei ich hellgrünes Gras vor mir sehe und leicht bewegte Wasserflächen im Sonnenlicht, aus tausend Silberplättchen zusammengesetzt.” (Adler 347) Ein vergleichbares Erlebnis hat der Leser, wenn er Zehs Bücher aufschlägt.